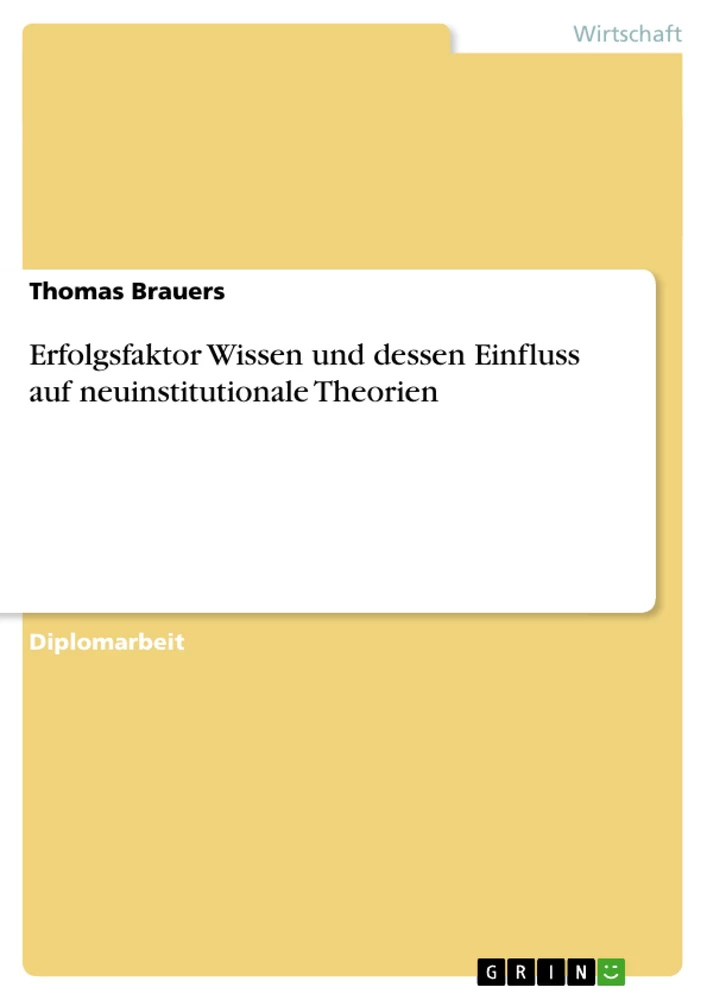Wissen hat die Gesellschaft geändert und nimmt einen immer höheren Stellenwert
ein. Unternehmen müssen verstärkt auf den Faktor Wissen eingehen, um Wettbewerbsvorteile realisieren zu können. Wissen muss geschaffen, aktualisiert und verteilt werden. Dazu bedarf es Wissensmanagementtechniken um gezielt auf die unternehmensspezifischen Anforderungen einzugehen. Die theoretischen Ansätze des Wissensmanagements stellen dabei den Menschen und sein Wissen in den Vordergrund der Betrachtung. Doch auch Spezialisierung und Arbeitsteilung werden durch Wissen verstärkt. Arbeitsteilung zieht Delegation von Aufgaben nach sich. Der Mensch besitzt jedoch nur begrenzte Verarbeitungskapazitäten, so dass es zu Informationsasymmetrien kommen kann. Die Theorien der Neuen Institutionenökonomik befassen sich mit der Thematik. Sie gehen davon aus, dass durch das opportunistische Ausnutzen dieser Asymmetrien, Unternehmen Schäden entstehen können. Die ransaktionskostentheorie befasst sich im Detail mit der Ausgestaltung der Organisationsform. Die Prinzipal-Agenten-Theorie betrachtet das Verhältnis der Individuen innerhalb einer Firma und dessen Eigentumsstrukturen.
In Zeiten der fortschreitenden Internationalisierung fließen vermehrt kulturelle Einflüsse in die Unternehmen ein, die die Situationen zusätzlich beeinflussen. Das
Unternehmen muss in der Unternehmensstrategie diese Einflussfaktoren umfassend
berücksichtigen. Die Theorien werden auf eine Fallstudie der SAFT AG angewendet.
Durch eine Befragung und Experteninterviews wird die Aktualität der Theorien überprüft und Handlungsempfehlungen für die Problemstellung entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Executive Summary
- Gang der Arbeit
- Problemstellung
- Definition der Problemstellung
- Motivation und Relevanz
- Untersuchung Methodologie
- Sekundärquellen
- Primärquellen
- Theoretische Ansätze
- Relevante Theorien
- Ausgewählte Theorien
- Erfolgsfaktor Wissen
- Historische Entwicklung
- Definition von Wissen
- Bedeutung von Wissen für Gesellschaft und Unternehmen
- Bedeutung und Anwendung von Wissensmanagement
- Überblick Transaktionskostentheorie
- Historischer Hintergrund
- Definition der Transaktion und der Transaktionskosten
- Der Transaktionskostenansatz
- Transaktionskosten als Einflussgröße für Organisationen
- Überblick Prinzipal-Agenten-Theorie
- Historische Entwicklung
- Der Prinzipal-Agenten-Ansatz
- Unternehmensüberwachung und Corporate Governance
- Wissen und neoinstitutionale Theorien
- Weitere Einflussgrößen einer erfolgreichen Unternehmensführung
- Kultur
- Unternehmensstrategie
- Praktische Ansätze
- Fallbeispiel SAFT AG
- Anwendung der Theorien auf das Fallbeispiel
- Interpretation der Forschungsmethoden
- Umfrage
- Allgemeines zur Umfrage
- Ergebnisse der Umfrage
- Interpretation der Umfrageergebnisse
- Experteninterviews
- Allgemeines zu den Experteninterviews
- Ergebnisse der Experteninterviews
- Interpretation der Interviewergebnisse
- Falllösung aus der Problemstellung
- Fazit, kritische Würdigung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den Einfluss des Erfolgsfaktors Wissen auf die Theorien der Neuen Institutionenökonomik. Ziel ist es, die Relevanz des Themas in der Praxis aufzuzeigen und zu analysieren, ob Wissen ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Wissensbegriffs sowie die Bedeutung von Wissen für Gesellschaft und Unternehmen.
- Das Verständnis von Wissen und dessen Bedeutung in der modernen Wirtschaft
- Die Herausforderungen des Wissensmanagements und die Notwendigkeit eines systematischen Umgangs mit Wissen
- Der Einfluss von Wissen auf die Theorien der Neuen Institutionenökonomik, insbesondere auf die Transaktionskostentheorie und die Prinzipal-Agenten-Theorie
- Die Rolle von Kultur und Unternehmensstrategie im Kontext von Wissen und Organisation
- Praktische Ansätze und Fallbeispiele zur Veranschaulichung der theoretischen Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und der Definition der Problemstellung. Sie beschreibt die Motivation für die Arbeit und die Relevanz des Themas. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den theoretischen Ansätzen und behandelt die Relevanz verschiedener Theorien für die Arbeit. Insbesondere werden Theorien zum Faktor Wissen, die Transaktionskostentheorie, die Prinzipal-Agenten-Theorie und die Verbindung von Wissen zu neoinstitutionalen Theorien beleuchtet. Außerdem werden weitere Einflussfaktoren wie Kultur und Unternehmensstrategie aufgezeigt. Kapitel 4 widmet sich den praktischen Ansätzen und präsentiert eine Fallstudie der SAFT AG. Anhand dieses Fallbeispiels werden die Theorien aus Kapitel 3 auf die Praxis angewendet und durch eine Umfrage sowie Experteninterviews überprüft. Es werden Lösungsansätze für die im Fallbeispiel dargestellten Probleme entwickelt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, einer kritischen Würdigung und einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Themas.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Wissen, Wissensmanagement, Neue Institutionenökonomik, Transaktionskostentheorie, Prinzipal-Agenten-Theorie, Kultur, Unternehmensstrategie, Unternehmenskultur, Corporate Governance, Wirtschaftskriminalität, Intangible Assets, und Mitarbeitermotivation.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Wissen als zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen angesehen?
In der modernen Wirtschaft ermöglicht Wissen die Differenzierung vom Wettbewerb, fördert Innovationen und stellt eine Ressource dar, die sich durch Nutzung vermehrt statt zu verbrauchen.
Was untersucht die Prinzipal-Agenten-Theorie?
Sie analysiert das Verhältnis zwischen einem Auftraggeber (Prinzipal) und einem Beauftragten (Agent) sowie die Probleme, die durch Informationsasymmetrien und unterschiedliche Interessen entstehen können.
Welchen Einfluss haben Transaktionskosten auf die Organisation?
Die Transaktionskostentheorie hilft zu entscheiden, ob eine Leistung im Unternehmen selbst erbracht (Make) oder am Markt eingekauft (Buy) werden sollte, basierend auf den Kosten für Information, Verhandlung und Kontrolle.
Wie hängen Wissen und neoinstitutionale Theorien zusammen?
Wissen beeinflusst die Informationsasymmetrien zwischen Akteuren. Ein effektives Wissensmanagement kann opportunistisches Verhalten reduzieren und Transaktionskosten senken.
Was ist das Ziel der Fallstudie zur SAFT AG?
Anhand der SAFT AG wird die praktische Relevanz der Theorien überprüft und gezeigt, wie Wissensmanagement und Unternehmensstrategie zur Lösung realer Managementprobleme beitragen können.
- Quote paper
- Diplom-Kaufmann (FH) Thomas Brauers (Author), 2006, Erfolgsfaktor Wissen und dessen Einfluss auf neuinstitutionale Theorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81015