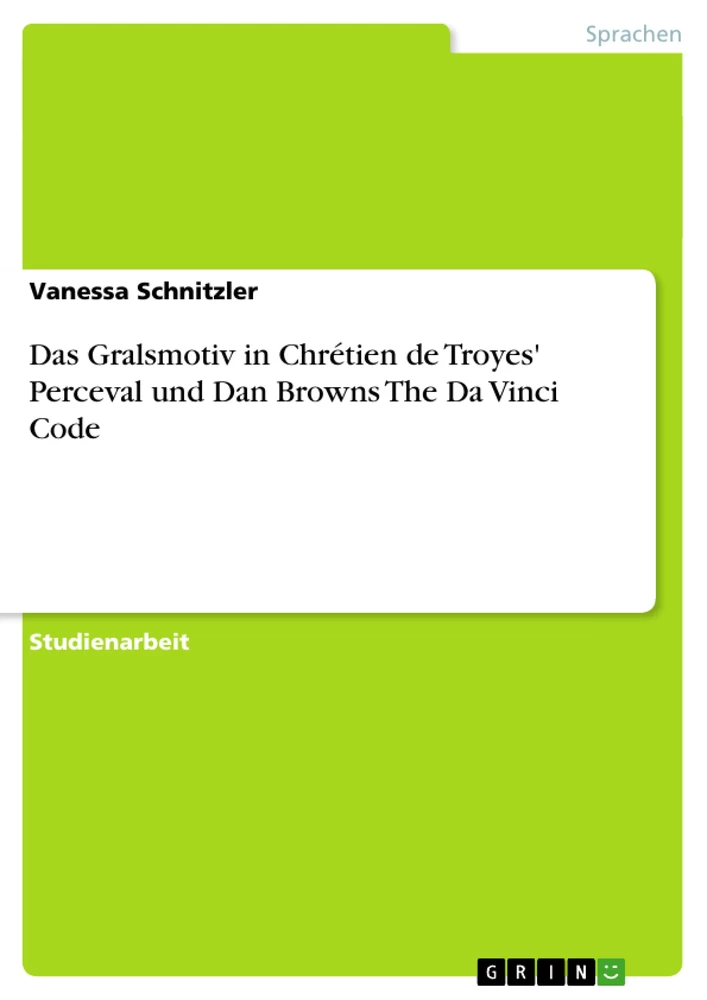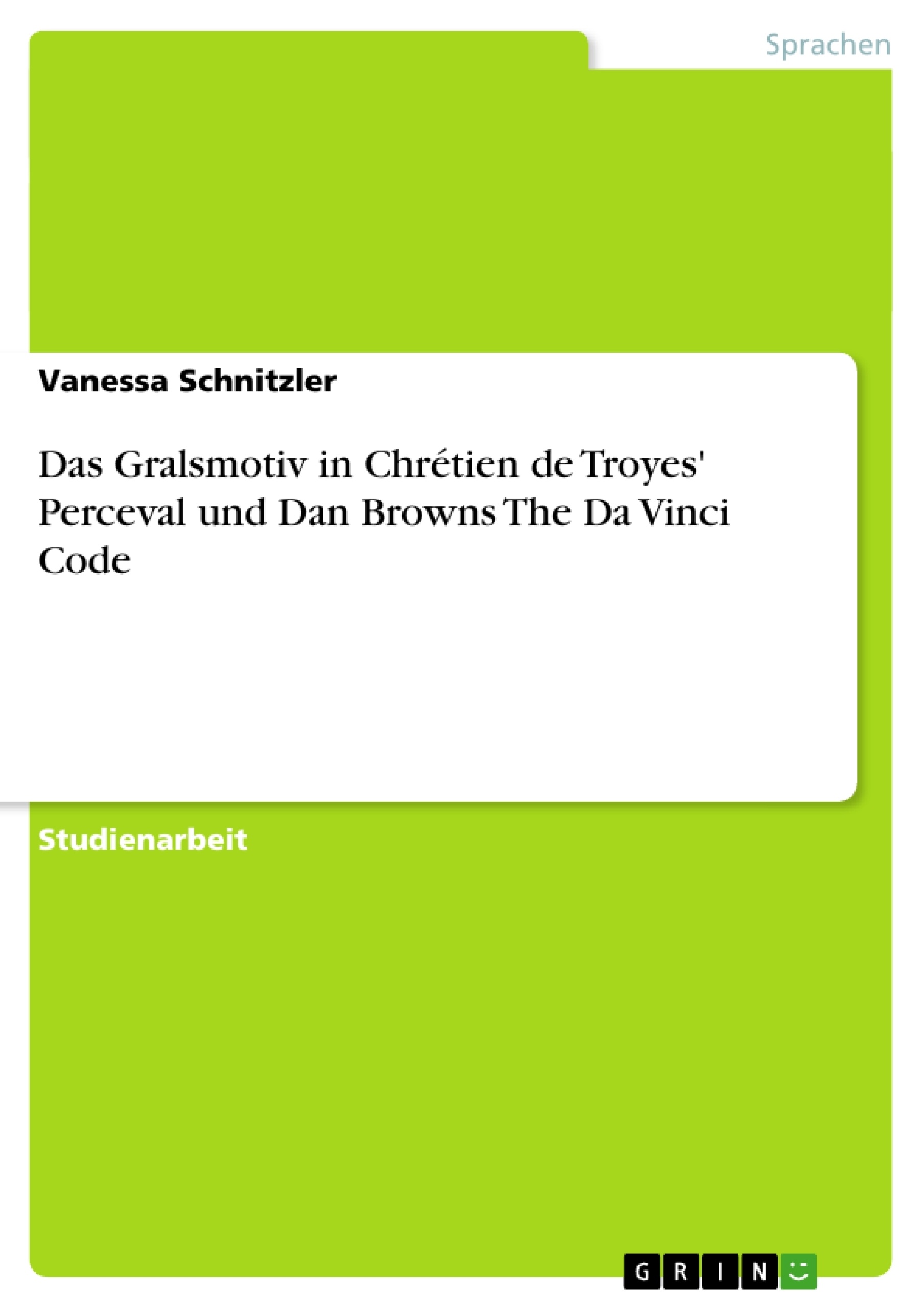Mit dieser Beschreibung bringt Dan Brown den Reiz der Unfassbarkeit des
Gralsmotivs treffend zum Ausdruck. Die Faszination, die vom Gralsstoff ausgeht,
besteht nicht zuletzt darin, dass er eine solch immense Fülle an Deutungsmustern
zulässt, von christlichen, über kultisch-ritualistische bis hin zu keltischen und
psychoanalytischen.
In dieser Arbeit werde ich mich jedoch auf einige Aspekte der christlichen
Deutung sowie der Sexualisierung des Gralsmotivs beschränken.
In einem ersten Schritt soll versucht werden, die Schwierigkeiten der
Etymologiefindung des Gralsbegriffs aufzuzeigen. Anschließend soll die
allmählich eintretende Christianisierung des Gralsmotivs nachgezeichnet werden.
In Kapitel 3.2. und 3.3 sollen schließlich die eucharistische Interpretation sowie
die Lichtmetaphorik im Mittelpunkt stehen.
Das einleitende Zitat aus Dan Browns Bestseller The Da Vinci Code liefert einen
ersten Hinweis auf die Sexualisierung des Gralsmotivs. Da im modernen Englisch
bei Gegenständen und Abstrakta normalerweise keine Genusunterscheidung
stattfindet3, kann davon ausgegangen werden, dass der Autor das feminine
Possessivpronomen „her“ absichtlich gewählt hat, um dem Gral eine weibliche
Konnotation zu verleihen. Hier wird auch deutlich, dass die deutsche Übersetzung
dem nicht gerecht werden kann. Es würde seltsam anmuten, diesen Satz mit „Der
Reiz der Gral liegt in ihrer Unfassbarkeit“ zu übersetzen. Dennoch geht durch die
Übersetzung ein nicht unerhebliches Detail verloren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Etymologie des Gralsbegriffs
- 3. Christliche Deutungsmuster
- 3.1 Die Christianisierung des Gralsmotivs
- 3.2 Eucharistische Interpretation
- 3.3 Lichtmetaphorik
- 4. Sexualisierung des Gralsmotivs
- 4.1 Die Dreieckssymbole
- 4.2 Die Dreieckssymbole bei Chrétien de Troyes und der Fruchtbarkeitsmythos
- 4.3 Die Dreieckssymbole bei Dan Brown und seine Interpretation von Leonardo Da Vincis Abendmahl
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Gralsmotiv in Chrétien de Troyes' Perceval und Dan Browns The Da Vinci Code. Die Zielsetzung besteht darin, die etymologischen Herausforderungen des Begriffs "Gral" aufzuzeigen und verschiedene Deutungsmuster, insbesondere christliche und sexualisierte Interpretationen, zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Gralsmotivs und seinen unterschiedlichen Auslegungen in den beiden betrachteten Werken.
- Etymologie des Gralsbegriffs
- Christianisierung des Gralsmotivs
- Eucharistische und Lichtmetaphorik des Grals
- Sexualisierung des Gralsmotivs
- Vergleichende Analyse der Gralsinterpretation in Chrétien de Troyes und Dan Brown
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Gralsmotivs ein und hebt dessen Vieldeutigkeit und die Fülle an möglichen Interpretationen hervor. Sie benennt den Fokus der Arbeit auf christliche und sexualisierte Deutungsmuster und skizziert den methodischen Ansatz, der die etymologische Untersuchung des Begriffs "Gral" und die Analyse der jeweiligen Interpretationen in Chrétien de Troyes' Perceval und Dan Browns The Da Vinci Code umfasst. Das Zitat aus Dan Browns Werk dient als Ausgangspunkt für die Betrachtung der Sexualisierung des Grals.
2. Etymologie des Gralsbegriffs: Dieses Kapitel befasst sich mit den etymologischen Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Herkunft des Wortes "Gral". Es werden verschiedene Theorien vorgestellt, die vom altfranzösischen "graal" über mittelalterliche lateinische Bezeichnungen wie "gradalis" bis hin zu keltischen Wurzeln reichen. Die Diskussion beinhaltet verschiedene literarische Belege aus der altfranzösischen Literatur, wie z.B. L'Alexandre und La Première Continuation de Perceval, um die Verwendung des Begriffs im Mittelalter zu illustrieren. Es wird deutlich, dass "Gral" ursprünglich ein eher unspezifischer Begriff für einen Behälter war, der sich erst im Laufe der Zeit mit spirituellen Bedeutungen anreicherte. Die verschiedenen Theorien werden kritisch gewürdigt und die Gemeinsamkeiten aller Ansätze hervorgehoben: Der Gral wird als ein Gefäß, eine Schale oder ein Behälter beschrieben.
Schlüsselwörter
Gral, Chrétien de Troyes, Perceval, Dan Brown, The Da Vinci Code, Etymologie, Christliche Deutung, Sexualisierung, Lichtmetaphorik, Eucharistie, Dreieckssymbolik, Fruchtbarkeitsmythos, Maria Magdalena, mittelalterliche Literatur, Symbolinterpretation.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Gralsmotivs in Chrétien de Troyes' Perceval und Dan Browns The Da Vinci Code
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Gralsmotiv in zwei Werken: Chrétien de Troyes' Perceval und Dan Browns The Da Vinci Code. Der Fokus liegt auf der etymologischen Untersuchung des Begriffs "Gral" und der Analyse verschiedener Deutungsmuster, insbesondere christlicher und sexualisierter Interpretationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Etymologie des Gralsbegriffs, Christliche Deutungsmuster, Sexualisierung des Gralsmotivs und Fazit. Kapitel 3 und 4 untergliedern sich in weitere Unterkapitel, die spezifische Aspekte der jeweiligen Deutungsmuster untersuchen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die etymologischen Herausforderungen des Begriffs "Gral" aufzuzeigen und verschiedene Deutungsmuster, insbesondere christliche und sexualisierte Interpretationen, zu analysieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Gralsinterpretation in den beiden untersuchten Werken.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Etymologie des Gralsbegriffs, die Christianisierung des Gralsmotivs (einschließlich eucharistischen und lichtmetaphorischen Interpretationen), die Sexualisierung des Gralsmotivs und einen vergleichenden Analyse der Gralsinterpretation bei Chrétien de Troyes und Dan Brown.
Wie wird der Begriff "Gral" etymologisch untersucht?
Das Kapitel zur Etymologie des Gralsbegriffs beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Herkunft des Wortes "Gral". Es werden verschiedene Theorien vorgestellt und anhand literarischer Belege aus der altfranzösischen Literatur (z.B. L'Alexandre und La Première Continuation de Perceval) diskutiert. Es wird gezeigt, dass "Gral" ursprünglich ein unspezifischer Begriff für einen Behälter war, der erst später spirituelle Bedeutungen erhielt.
Wie werden christliche Deutungsmuster des Grals behandelt?
Die christliche Deutung des Grals wird unter verschiedenen Aspekten betrachtet: die Christianisierung des Motivs selbst, eucharistische Interpretationen und die Verwendung von Lichtmetaphorik im Zusammenhang mit dem Gral.
Wie wird die Sexualisierung des Gralsmotivs analysiert?
Die Sexualisierung des Gralsmotivs wird insbesondere anhand der Dreieckssymbolik untersucht. Die Analyse bezieht sich auf die Verwendung dieser Symbolik bei Chrétien de Troyes, im Kontext des Fruchtbarkeitsmythos, und in Dan Browns Interpretation von Leonardo da Vincis Abendmahl.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Gral, Chrétien de Troyes, Perceval, Dan Brown, The Da Vinci Code, Etymologie, Christliche Deutung, Sexualisierung, Lichtmetaphorik, Eucharistie, Dreieckssymbolik, Fruchtbarkeitsmythos, Maria Magdalena, mittelalterliche Literatur, Symbolinterpretation.
Wie werden die Gralsinterpretationen bei Chrétien de Troyes und Dan Brown verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Gralsinterpretationen in Chrétien de Troyes' Perceval und Dan Browns The Da Vinci Code, um die Entwicklung und die unterschiedlichen Auslegungen des Motivs in den beiden Werken aufzuzeigen. Der Vergleich fokussiert die jeweiligen Deutungsmuster (christlich und sexualisiert) und deren spezifische Ausprägungen.
- Quote paper
- Vanessa Schnitzler (Author), 2006, Das Gralsmotiv in Chrétien de Troyes' Perceval und Dan Browns The Da Vinci Code, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81057