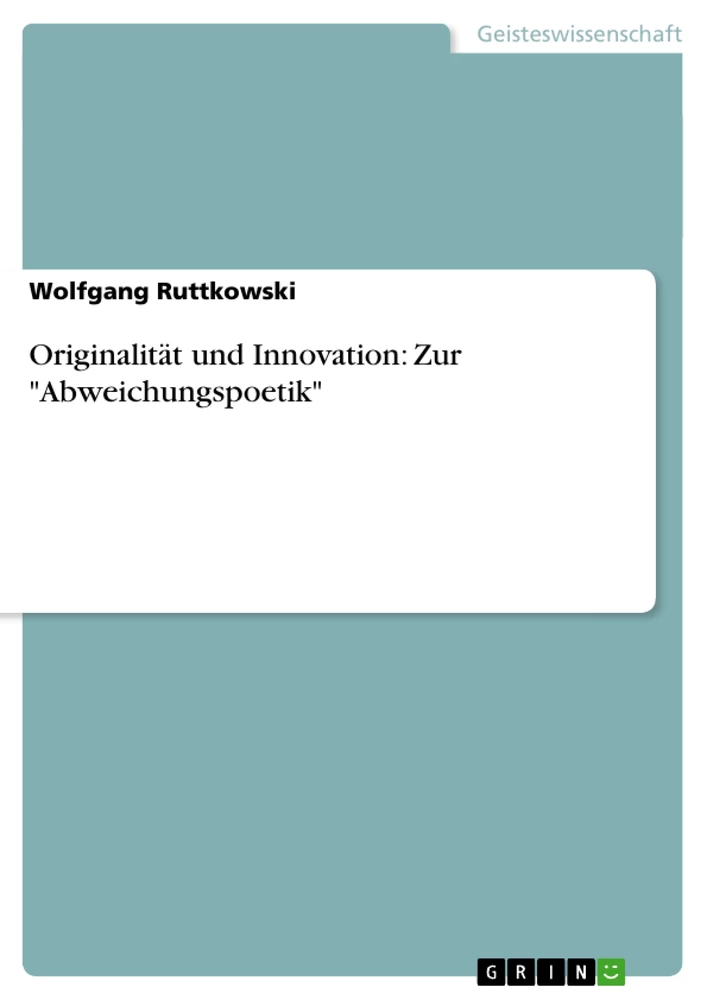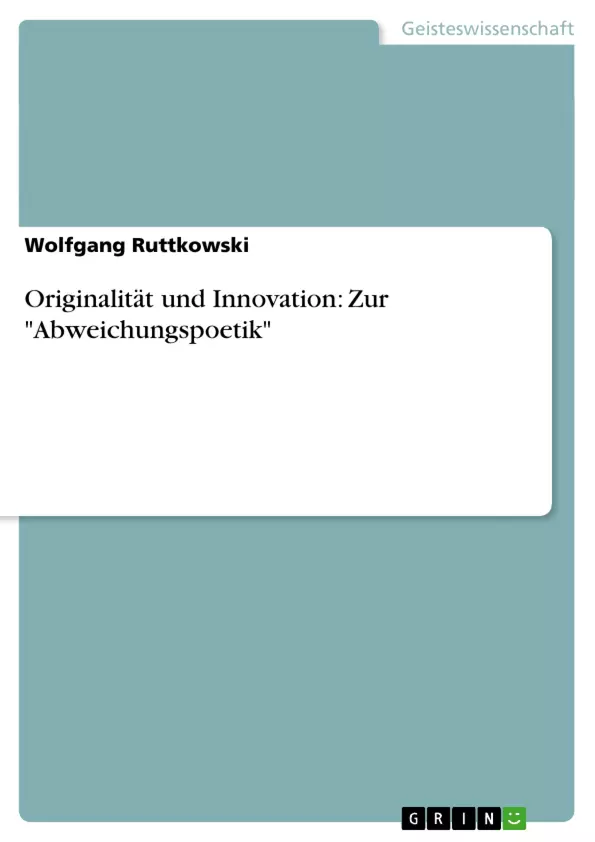Die Verallgemeinerung der momentan in Deutschland dominierenden "Abweichungs¬poetik", welche die poetische Wirkung von Literatur hauptsächlich aus deren Abweichung vom normalen Sprachgebrauch erklärt, wird als eine moderne Form von ,,Eurozentrik" entlarvt.
Dafür werden Erkenntnisse von Sprachpsychologen (Hoffstädter), Philosophen (Rampley / Wittgenstein) und vor allem Komparatisten herangezogen (u. a. für altorien¬talische Literatur Röllig; für Griechenland Tartarkiewicz; für China Bush, Debon und Robertson; für Indien Coomaraswamy, Glasenapp, Hoffmann und Jacobi; für orale Lite¬raturen Thompson).
Im einzelnen wird dargelegt, dass die ästhetische Stimulierung durch "Abweichung" in Frickes Sinn von der beim „Konkretisieren von Unbestimmtheitsstellen" in Ingardens Sinn unterschieden werden muss; ebenso die Abweichungen im Text von deren Voraus¬setzungen für ihre Verarbeitung im Leser; dass Abweichung als solche keinen ästhetischen Wert darstellt (Horn), auch wenn sie, nach Fricke, "eine nachweisbare Funk¬tion erfüllt."
Schließlich wird (mit Assmann) gezeigt, dass die Kanon(e)s (noch) verschiedener Kulturen letztlich unvergleichbar sind und dass es sinnlos ist, ästhetische Kategorien wie die der Abweichung auf Literatur zu projizieren, die nicht nach solchen ausgesucht (kanonisiert) wurde.
(Vortrag, 16.2.2000, Germanistentagung in Tokyo, in: Acta Humanistica, Humanities S. No. 28, (March 2001) 84-115)
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Originalität als Wert
- Das poetologische Diktat des „Neuen“ und der Kanon
- Genauere Festlegung des Anwendungsbereichs des Abweichungsbegriffs
- Ist Originalität als solche ein ästhetischer Wert?
- Seit wann gibt es „Abweichungspoetik“?
- Ist ,,Abweichungspoetik“ auf jegliche Literatur anwendbar?
- Die Gegenposition zur Abweichungspoetik
- Indien
- China
- Japan
- „Literarische-“ und „kulturelle“ Texte
- Anmerkungen
- Zitierte Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die weit verbreitete „Abweichungspoetik“, welche die ästhetische Wirkung von Literatur vor allem aus deren Abweichung vom normalen Sprachgebrauch erklärt. Er argumentiert, dass diese Perspektive eine moderne Form von „Eurozentrik“ darstellt und die vielfältigen poetischen Prinzipien anderer Kulturen ignoriert.
- Kritik an der „Abweichungspoetik“ als eurozentrischer Sichtweise
- Untersuchung der ästhetischen Stimulierung durch „Abweichung“ im Vergleich zu anderen poetischen Prinzipien
- Analyse der Rolle des Kanons und seiner Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Originalität in verschiedenen Kulturen
- Diskussion der Bedeutung von „Mehrdeutigkeit“ und „Abweichung“ in der Textverarbeitung
- Bedeutung des Lesers und seiner literarischen Erfahrung für die Wahrnehmung von „Poetizität“
Zusammenfassung der Kapitel
- Zusammenfassung: Der Text kritisiert die dominierende „Abweichungspoetik“ in Deutschland, die die poetische Wirkung von Literatur hauptsächlich aus deren Abweichung vom normalen Sprachgebrauch erklärt. Der Autor argumentiert, dass diese Sichtweise eine moderne Form von „Eurozentrik“ darstellt und die vielfältigen poetischen Prinzipien anderer Kulturen ignoriert.
- Originalität als Wert: Der Autor untersucht die Bedeutung von Originalität in der Literatur und wie verschiedene literaturwissenschaftliche Richtungen und „Schulen“ eigene Wertesysteme auf die Literatur projizieren. Er stellt fest, dass die Konzentration auf originellen Sprachgebrauch oft mit der Annahme verbunden ist, dass „echte“ und „wahrhafte“ Erlebnisse sich in neuartiger Sprachformung ausdrücken müssen.
Schlüsselwörter
Abweichungspoetik, Eurozentrik, Originalität, Kanon, Poetizität, Mehrdeutigkeit, Textverarbeitung, Sprachpsychologie, Komparatistik, altorientalische Literatur, Indien, China, Japan, „Literarische-“ und „kulturelle“ Texte.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Abweichungspoetik“?
Es ist die Theorie, dass die poetische Wirkung von Literatur primär durch deren Abweichung vom normalen Sprachgebrauch entsteht.
Warum wird die Abweichungspoetik als „eurozentrisch“ kritisiert?
Weil sie ästhetische Kategorien auf Weltliteratur projiziert, die in anderen Kulturen (z.B. Indien, China, Japan) oft keine Entsprechung in dieser Form haben.
Ist Originalität immer ein ästhetischer Wert?
Die Arbeit hinterfragt dies und legt dar, dass Abweichung an sich noch keinen ästhetischen Wert darstellt, selbst wenn sie eine nachweisbare Funktion erfüllt.
Welche Rolle spielt der „Kanon“ bei der Bewertung von Literatur?
Die Kanons verschiedener Kulturen sind oft unvergleichbar. Es ist wenig sinnvoll, Kategorien wie „Abweichung“ auf Texte anzuwenden, die nach ganz anderen Kriterien kanonisiert wurden.
Wie unterscheidet sich die Textverarbeitung beim Leser?
Die Arbeit differenziert zwischen der Abweichung im Text selbst und den Voraussetzungen, die ein Leser mitbringen muss, um diese als ästhetisch wahrzunehmen.
Welche Gegenpositionen zur Abweichungspoetik werden genannt?
Es werden literarische Traditionen aus Indien, China und Japan herangezogen, um zu zeigen, dass Poetizität auch ohne das Diktat des „Neuen“ funktionieren kann.
- Arbeit zitieren
- Dr. Wolfgang Ruttkowski (Autor:in), 2001, Originalität und Innovation: Zur "Abweichungspoetik", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81067