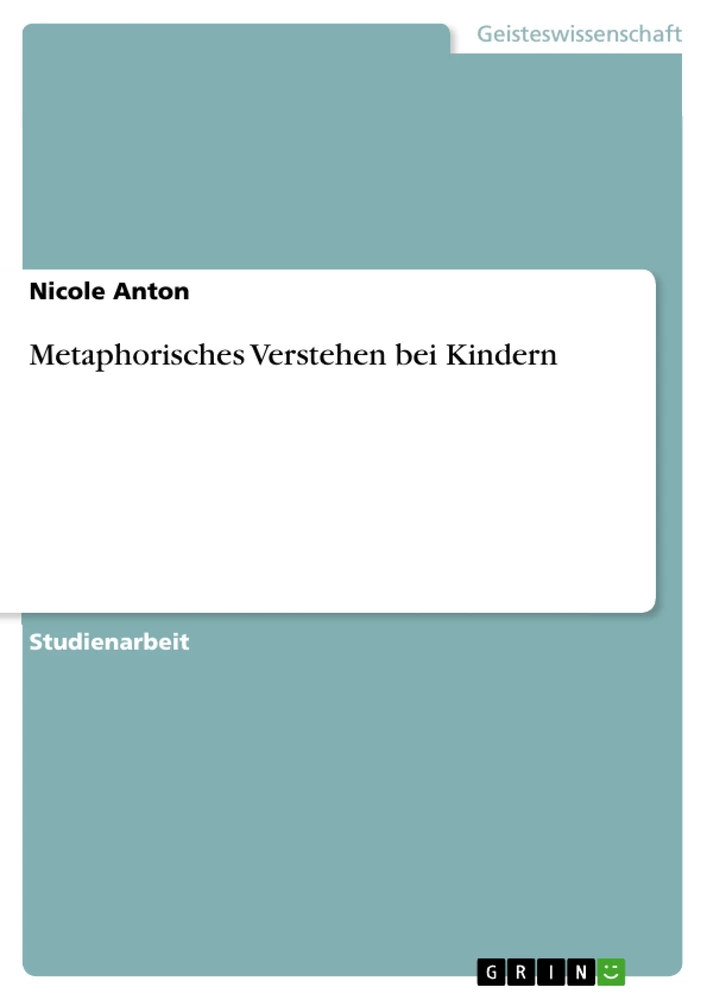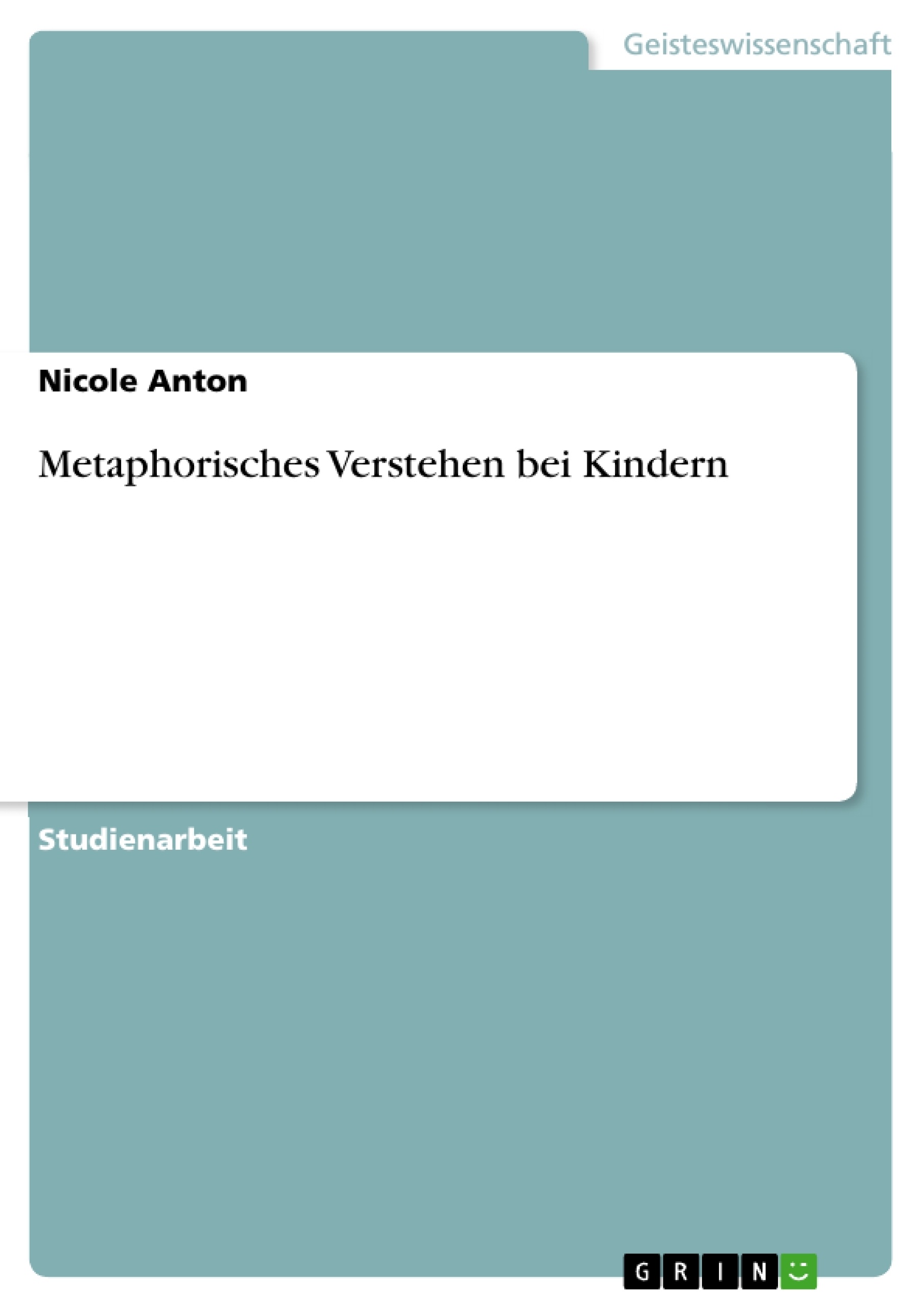Metaphorisches Verstehen von Kindern - Wie ist es angelegt, wie entwickelt es sich und welche Konsequenzen hat dies für den Unterricht? Hierzu wird zunächst der Begriff „Metapher“ erläutert. Die Position Baldermanns zum Gleichnisverständnis von Grundschülern wird ebenso wie die drei Entwicklungsstadien des Gleichnisverständnisses nach Anton A. Bucher und die dazu gewonnenen empirischen Befunde dargestellt. Buchers Plädoyer für die „Erste Naivität“, das für viele Diskussionen in der Religionspädagogik gesorgt hat, wird umrissen sowie eine Skizzierung der wichtigsten religionspädagogischen Forderungen Buchers vorgenommen. Die daraus entstandene Kontroverse beleuchtet, im Hinblick auf die Frage, in welchem Alter Kinder Metaphern, speziell die metaphorischen Gleichnisse, verstehen können. Es folgt ein Diskurs zu den Wundergeschichten, deren Einsatz als metaphorische Erzählungen in der Grundschule ebenso umstritten ist wie der der Gleichnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung: Die Metapher
- 3. Gleichnisse - eine Sprache für Kinder?
- 3.1 Die Stadien des Gleichnisverständnisses nach Anton A. Bucher
- 3.1.1 Stadium 1
- 3.1.2 Stadium 2
- 3.1.3 Stadium 3
- 3.1.4 Empirische Befunde zu Mt 20,1ff.
- 3.1 Die Stadien des Gleichnisverständnisses nach Anton A. Bucher
- 4. Anton A. Buchers Plädoyer für die „Erste Naivität“
- 4.1 Die Weltbildvorstellungen und der Realismus des Kindes
- 4.2 Anthropomorphisierung und Artifizialismus
- 4.3 Animismus und Magie
- 4.4 Religionspädagogische Forderungen Buchers
- 5. Die Kontroverse um die „Erste Naivität“
- 5.1 Bernhard Grom - Anton A. Bucher
- 5.2 Hubertus Halbfas - Anton A. Bucher
- 5.3 Die Sichtweise Rainer Oberthürs
- 6. Wundergeschichten in der Grundschule?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das metaphorische Verstehen von Kindern, insbesondere im Kontext von Gleichnissen. Sie analysiert verschiedene Theorien zum kindlichen Verständnis von Metaphern und deren Anwendung im Religionsunterricht. Ein Schwerpunkt liegt auf Anton A. Buchers Plädoyer für die „Erste Naivität“ und der daraus resultierenden Kontroverse.
- Kindliches Verständnis von Metaphern und Gleichnissen
- Entwicklungsstufen des Gleichnisverständnisses nach Bucher
- Buchers Konzept der „Ersten Naivität“ und dessen Kritik
- Didaktische Implikationen für den Religionsunterricht
- Geeignetheit von Wundergeschichten im Grundschulalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des metaphorischen Verstehens bei Kindern ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die zentralen Fragestellungen, die im Verlauf der Arbeit behandelt werden, insbesondere die Frage nach dem Alter, in dem Kinder Metaphern und Gleichnisse verstehen können. Die Einleitung gibt einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Ansätze und empirischen Befunde, die im Folgenden diskutiert werden.
2. Begriffsklärung: Die Metapher: Dieses Kapitel klärt den Begriff "Metapher" etymologisch und begrifflich. Es werden verschiedene Definitionen von Metaphern vorgestellt und ihre Funktion als bildhafte Übertragung geistiger Inhalte erläutert. Der Unterschied zwischen Gleichnissen und Parabeln wird kurz angerissen, wobei betont wird, dass die Arbeit sich hauptsächlich auf Gleichnisse konzentriert, obwohl empirische Befunde auf einer Parabel basieren. Die Kapitel legt eine Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die wichtigen begrifflichen Grundlagen festlegt.
3. Gleichnisse - eine Sprache für Kinder?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Gleichnisse eine geeignete Sprache für Kinder darstellen. Es werden verschiedene Positionen vorgestellt, inklusive der Ansicht Baldermanns, dass Gleichnisse sich den Kindern direkt erschließen müssen, um verstanden zu werden. Die Bedeutung der Rezeptionsästhetik für das Verständnis kindlicher Interpretationen wird hervorgehoben. Die unterschiedlichen Ansätze zur Gleichnisauslegung (Jülicher vs. neuere Interpretationen) werden ebenfalls beleuchtet. Das Kapitel legt den Grundstein für die detaillierte Auseinandersetzung mit Buchers Stadienmodell im folgenden Unterkapitel.
3.1 Die Stadien des Gleichnisverständnisses nach Anton A. Bucher: Dieses Unterkapitel beschreibt detailliert Anton A. Buchers Modell der drei Stadien des Gleichnisverständnisses. Bucher stützt sich auf die Rezeptionsästhetik und die Entwicklungsstufen Piagets und Oser/Gmünder. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der unterschiedlichen Interpretationsweisen von Gleichnissen in den verschiedenen Entwicklungsstufen und wie sich das Verständnis von Metaphern im Laufe der kindlichen Entwicklung verändert. Das Kapitel legt die Grundlage für die spätere Diskussion über Buchers Plädoyer für die „Erste Naivität“.
4. Anton A. Buchers Plädoyer für die „Erste Naivität“: Dieses Kapitel fasst Anton A. Buchers Argumentation für die "Erste Naivität" zusammen. Es erläutert Buchers Sicht auf die Weltbildvorstellungen, den Realismus, den Anthropomorphismus, Artifizialismus, Animismus und die Magie im Denken von Kindern. Die religionspädagogischen Forderungen Buchers werden im Detail beschrieben. Dieses Kapitel ist zentral für das Verständnis der folgenden Kontroverse um Buchers Theorien. Es bietet eine tiefgehende Analyse seiner Argumentation und ihrer Bedeutung für die Religionspädagogik.
5. Die Kontroverse um die „Erste Naivität“: Dieses Kapitel beleuchtet die Kontroverse um Buchers Plädoyer für die „Erste Naivität“. Die unterschiedlichen Positionen von Grom, Halbfas und Oberthür werden dargestellt und miteinander verglichen. Der Fokus liegt auf den zentralen Kritikpunkten an Buchers Ansatz und den unterschiedlichen Perspektiven auf das kindliche Verständnis von religiösen Inhalten. Das Kapitel analysiert die Argumente der verschiedenen Autoren und zeigt die Komplexität der Debatte um das Thema.
6. Wundergeschichten in der Grundschule?: Dieses Kapitel diskutiert die Frage nach der Eignung von Wundergeschichten als metaphorische Erzählungen im Grundschulbereich. Es wird beleuchtet, inwiefern die Problematik der Vermittlung von Wundergeschichten mit der des Gleichnisverständnisses vergleichbar ist. Das Kapitel wird die zentralen Argumente für und gegen den Einsatz von Wundergeschichten im Religionsunterricht der Grundschule analysieren.
Schlüsselwörter
Metapher, Gleichnis, kindliches Verstehen, Gleichnisverständnis, Anton A. Bucher, Erste Naivität, Religionspädagogik, Entwicklungspsychologie, Wundergeschichten, Grundschule, Rezeptionsästhetik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kindliches Verstehen von Metaphern und Gleichnissen im Religionsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das metaphorische Verstehen von Kindern, insbesondere im Kontext von Gleichnissen und deren Anwendung im Religionsunterricht. Ein Schwerpunkt liegt auf Anton A. Buchers Konzept der „Ersten Naivität“ und der damit verbundenen Kontroverse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das kindliche Verständnis von Metaphern und Gleichnissen, die Entwicklungsstufen des Gleichnisverständnisses nach Bucher, Buchers Konzept der „Ersten Naivität“ und dessen Kritik, didaktische Implikationen für den Religionsunterricht und die Eignung von Wundergeschichten im Grundschulalter.
Was ist das Konzept der „Ersten Naivität“ nach Anton A. Bucher?
Buchers Konzept der „Ersten Naivität“ beschreibt die Art und Weise, wie Kinder die Welt wahrnehmen und interpretieren, bevor sie ein abstrakteres, rationaleres Verständnis entwickeln. Es beinhaltet Aspekte wie Anthropomorphismus, Artifizialismus und Animismus.
Welche Kritikpunkte werden an Buchers Konzept der „Ersten Naivität“ geäußert?
Die Arbeit beleuchtet die Kontroverse um Buchers Konzept, indem sie die unterschiedlichen Positionen von Grom, Halbfas und Oberthür darstellt und deren Kritikpunkte an Buchers Ansatz analysiert. Die Kritikpunkte konzentrieren sich auf verschiedene Aspekte seines Verständnisses der kindlichen Wahrnehmung und Interpretation religiöser Inhalte.
Wie viele Stadien des Gleichnisverständnisses beschreibt Bucher?
Bucher beschreibt drei Stadien des Gleichnisverständnisses, die auf der Rezeptionsästhetik und den Entwicklungsstufen Piagets und Oser/Gmünder basieren. Jedes Stadium zeichnet sich durch eine andere Art der Interpretation von Gleichnissen aus.
Welche Rolle spielt die Rezeptionsästhetik in dieser Arbeit?
Die Rezeptionsästhetik spielt eine wichtige Rolle im Verständnis der kindlichen Interpretationen von Gleichnissen. Sie beeinflusst die Analyse der Entwicklungsstufen des Gleichnisverständnisses und die Bewertung von Buchers Konzept.
Sind Wundergeschichten für die Grundschule geeignet?
Die Arbeit diskutiert die Eignung von Wundergeschichten im Grundschulbereich und analysiert die Argumente für und gegen deren Einsatz im Religionsunterricht, wobei die Vergleichbarkeit mit der Problematik des Gleichnisverständnisses hervorgehoben wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Metapher, Gleichnis, kindliches Verstehen, Gleichnisverständnis, Anton A. Bucher, Erste Naivität, Religionspädagogik, Entwicklungspsychologie, Wundergeschichten, Grundschule, Rezeptionsästhetik.
Welche empirischen Befunde werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf empirische Befunde, unter anderem zu Matthäus 20,1ff., um das kindliche Verständnis von Gleichnissen zu belegen und die Theorien zu untermauern.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsklärung (Metapher), Gleichnisse - eine Sprache für Kinder?, Buchers Stadienmodell des Gleichnisverständnisses, Buchers Plädoyer für die „Erste Naivität“ und die damit verbundene Kontroverse, sowie die Diskussion über Wundergeschichten in der Grundschule.
- Citar trabajo
- Nicole Anton (Autor), 2005, Metaphorisches Verstehen bei Kindern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81087