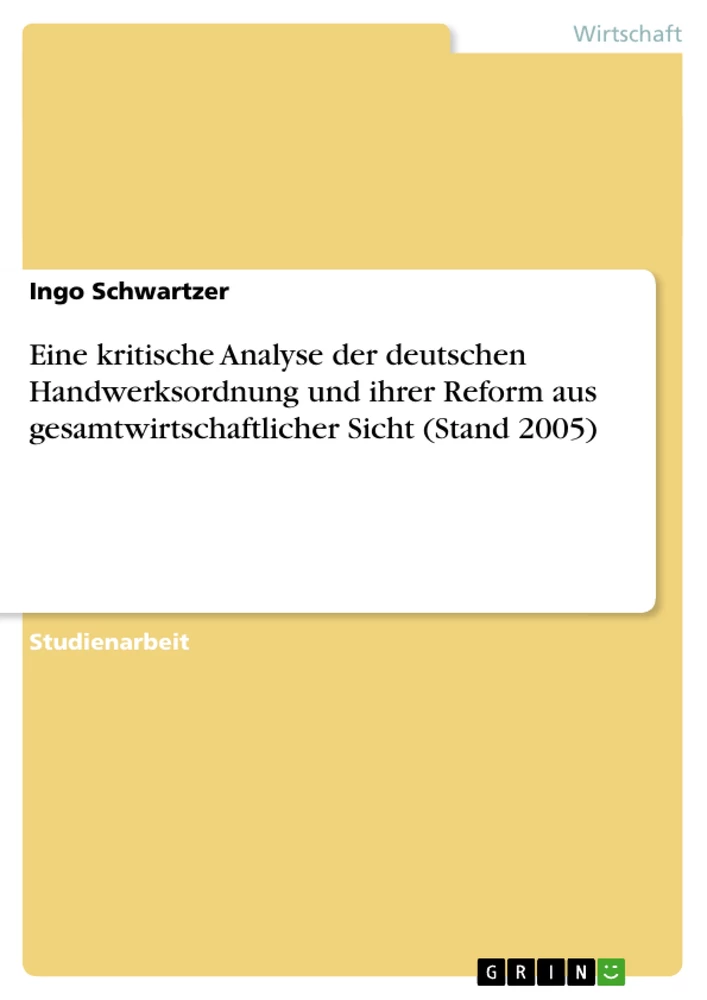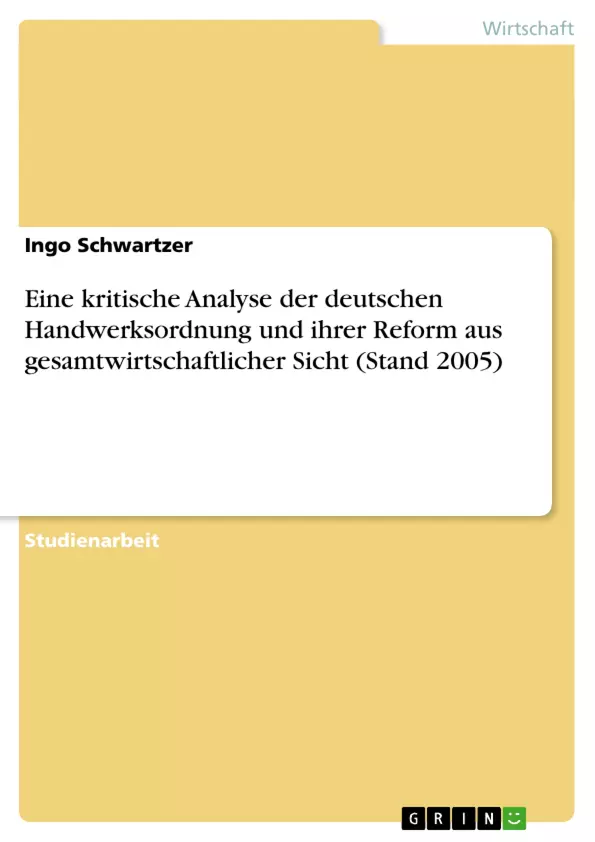Das deutsche Handwerk als zweitgrößter Wirtschaftsbereich in der Bundesrepublik Deutschland, geprägt von kleinen und mittleren Betrieben, weist eine lange Tradition und wechselvolle Geschichte auf. Über Jahrhunderte hinweg hat sich ein ausgedehntes System von Verflechtungen weit über eine bloße marktliche Koordination hinaus in den Zünften entwickelt. Diese lange Geschichte der Regulierung und Reglementierung mündete in die deutsche Handwerksordnung.
Diese Arbeit stellt sich zum Ziel, die Handwerksordnung mit ihren Regulierungen des deutschen Handwerksmarktes zu beleuchten und die resultierenden Auswirkungen aufzuzeigen. Des Weiteren wird eine kritische Abwägung der Argumente für bzw. gegen eine Regulierung stattfinden und schließlich die Reform der Handwerksordnung mit all ihren Effekten kritisch gewürdigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die deutsche Handwerksordnung
- Die Geschichte des deutschen Handwerks
- Der Handwerksbegriff
- Zielsetzung der Handwerksordnung
- Argumente für das Erfordernis einer Marktregulierung
- Kosten
- Auswirkungen
- Eignung der Mittel zur Regulierung und Würdigung
- Die Reform der Handwerksordnung
- Notwendigkeit der Anpassung der Handwerksordnung
- Elemente der Novellierung
- Zielsetzung
- Auswirkungen der Reform
- Auswirkungen auf die Nachfrage
- Auswirkungen auf das Angebot
- Auswirkungen auf die Preise
- Effekte auf die Ausbildungsleistung des Handwerks
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der deutschen Handwerksordnung und analysiert ihre Regulierungen des deutschen Handwerksmarktes. Sie untersucht die Auswirkungen dieser Regulierungen und bewertet kritisch die Argumente für und gegen eine Regulierung. Zudem wird die Reform der Handwerksordnung mit ihren Effekten kritisch gewürdigt.
- Geschichte und Entwicklung der Handwerksordnung
- Regulierung des Handwerksmarktes
- Argumente für und gegen eine staatliche Regulierung
- Auswirkungen der Handwerksordnung auf den Markt
- Bewertung der Reform der Handwerksordnung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das deutsche Handwerk als wichtigen Wirtschaftsbereich vor und beleuchtet seine lange Tradition und wechselvolle Geschichte. Sie führt die Zielsetzung der Arbeit aus, die darin besteht, die Handwerksordnung zu analysieren und ihre Auswirkungen zu beleuchten.
- Die deutsche Handwerksordnung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Geschichte des deutschen Handwerks, dem Handwerksbegriff und der Zielsetzung der Handwerksordnung. Es analysiert die Argumente für eine staatliche Regulierung des Handwerksmarktes und die damit verbundenen Kosten und Auswirkungen.
- Die Reform der Handwerksordnung: Das Kapitel behandelt die Notwendigkeit der Anpassung der Handwerksordnung, die Elemente der Novellierung und die Zielsetzung der Reform. Es untersucht die Auswirkungen der Reform auf Nachfrage, Angebot, Preise und die Ausbildungsleistung des Handwerks.
Schlüsselwörter
Handwerksordnung, Handwerk, Regulierung, Markt, Wettbewerb, Kosten, Auswirkungen, Reform, Ausbildung, Zunftwesen, Berufszulassung, Berufsausübung, Mittelstand, Qualitätssicherung, Verbraucherschutz, Marktregulierung, Marktmängel, Marktversagen, Handwerksorganisationen, Deregulierungskommission, Gesellenprüfung, Meisterprüfung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Zielsetzung der deutschen Handwerksordnung?
Die Handwerksordnung regelt den Marktzugang und die Berufsausübung im Handwerk, um Qualitätssicherung und eine hohe Ausbildungsleistung zu gewährleisten.
Warum wurde die Handwerksordnung im Jahr 2004 reformiert?
Die Novellierung zielte darauf ab, durch Deregulierung den Wettbewerb zu stärken, Existenzgründungen zu erleichtern und die Beschäftigungssituation zu verbessern.
Welche Berufe sind von der Meisterpflicht befreit?
Durch die Reform wurden viele Handwerke in die Anlage B der Handwerksordnung überführt, in denen ein Betrieb auch ohne Meisterbrief geführt werden darf.
Welche Auswirkungen hat die Reform auf die Preise?
Die Arbeit untersucht, inwieweit der erhöhte Wettbewerbsdruck durch die Liberalisierung zu sinkenden Preisen für handwerkliche Leistungen geführt hat.
Gefährdet die Deregulierung die Ausbildungsleistung?
Kritiker befürchten, dass durch den Wegfall der Meisterpflicht in vielen Berufen die Bereitschaft und Qualität der Lehrlingsausbildung sinken könnte.
Was sind die Argumente für eine Marktregulierung im Handwerk?
Befürworter führen Marktmängel, den Schutz der Verbraucher vor minderwertiger Arbeit und die Sicherung des technischen Fortschritts als Gründe an.
- Citar trabajo
- Dipl.-Kfm. Ingo Schwartzer (Autor), 2005, Eine kritische Analyse der deutschen Handwerksordnung und ihrer Reform aus gesamtwirtschaftlicher Sicht (Stand 2005), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81270