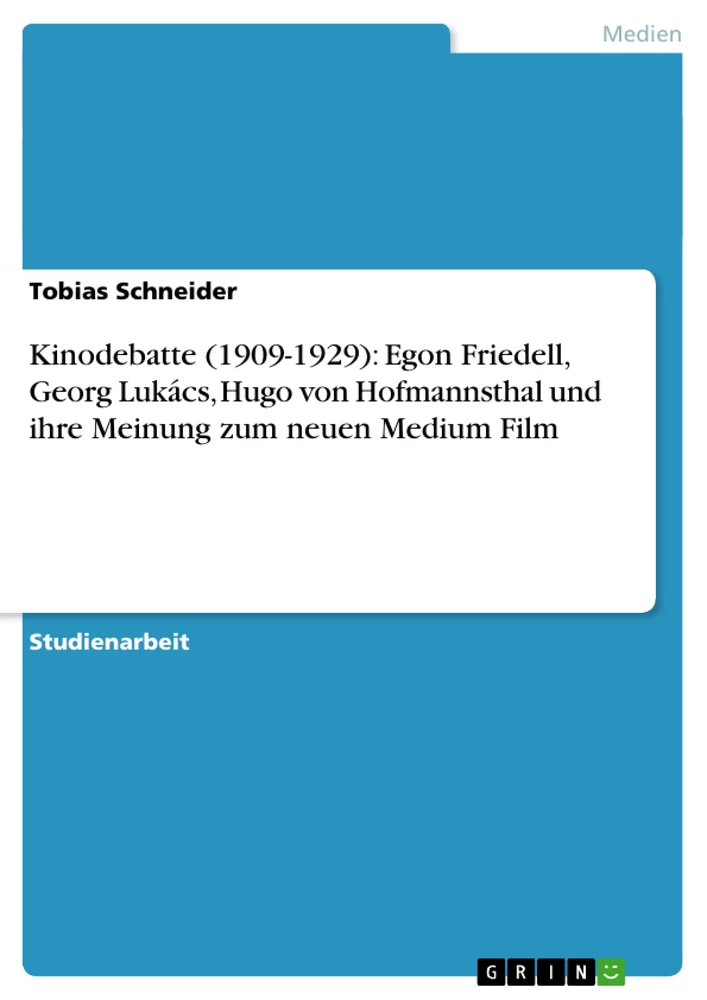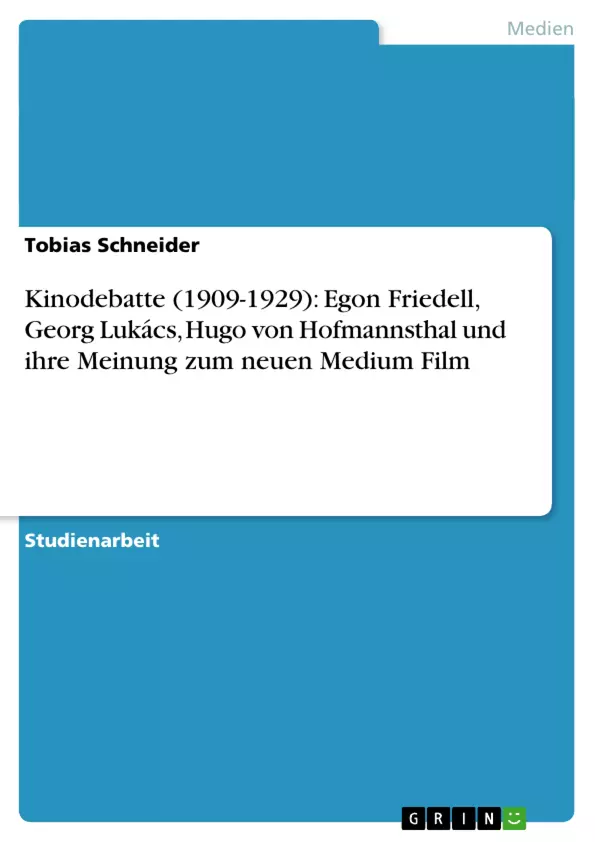Kino und Fernsehen stellen in der heutigen Zeit nicht nur einen selbstverständlichen Teil des gesellschaftlichen Lebens dar, sondern werden auch als wichtige Kulturgüter erachtet. Das war nicht immer so: Seit der Erfindung des Kinematographen durch die Brüder Auguste und Louis Lumière (1895) wurden Filme zunächst als Sensation oder technisches Kuriosum auf Jahrmärkten und Varietés vorgeführt. Sie schienen den ungebildeten unteren sozialen Schichten vorbehalten und wurden deshalb von der offiziellen Kulturkritik wenig beachtet.
In den 1910er Jahren änderte sich die Situation jedoch: Produktionsweisen, Vertriebsstrukturen und Vorführbedingungen der Kinematographie passten sich der wachsenden Nachfrage an. In den Großstädten (zum Beispiel Berlin) gab es immer mehr feste Kinos. Der narrative Film löste nach und nach die bis dahin sehr kurzen filmischen Attraktionen ab, anspruchsvolle Stoffe und Themen aus der Literatur wurden für die Leinwand neu inszeniert. Vor dieser Entwicklung konnte sich nun auch das Bildungsbürgertum nicht länger verschließen. Schriftsteller, Journalisten, Theater- und Kulturkritiker begannen über die Rolle des Kinos in einem kulturellen Kontext zu diskutieren. Viele bekannte Autoren, darunter Alfred Döblin, Thomas Mann und Bertolt Brecht, meldeten sich zu Wort. Hauptsächlich beschäftigten sie sich mit den Eigenschaften und Ausdrucksmitteln des neuen Mediums und untersuchten die Frage nach seiner Abgrenzung zu Literatur, Theater oder Malerei. Die Debatte wurde in Zeitungen und Zeitschriften geführt.
Im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit werden einige ausgewählte Beispiele aus der Kinodebatte ausführlich besprochen: Die Beiträge der Schriftsteller Egon Friedell („Prolog vor dem Film“, 1912), Georg Lukács („Gedanken zu einer Ästhetik des Kinos“, 1913) und Hugo von Hofmannstahl („Der Ersatz für die Träume“, 1921) beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln und setzen jeweils andere Schwerpunkte. Dennoch weisen sie gemeinsame Ansichten und sich überschneidende Gedanken auf. Die wichtigsten Aspekte werden in der Arbeit vorgestellt und miteinander in Beziehung gesetzt, um die jeweiligen Positionen der Autoren zum Kino zu verdeutlichen und – im Kleinen auf das Große verweisend –die Atmosphäre der gesamten zeitgenössischen Debatte wiederzugeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Kino als Ausdruck des Zeitgeistes........
- 3. Kino und Theater.
- 3.1 Das Wesen des Theaters …………….
- 3.2 Das Wesen des Kinos
- 4. Sprache und Bild
- 5) Schlussbetrachtung: Pro oder contra?.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der "Kinodebatte" der 1910er und 1920er Jahre, welche die Frage nach der Rolle des Films in der Gesellschaft und im kulturellen Kontext aufwarf. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Beiträgen von Egon Friedell, Georg Lukács und Hugo von Hofmannsthal, die unterschiedliche Perspektiven auf das neue Medium Film präsentierten.
- Das Kino als Spiegel des Zeitgeistes und Ausdruck der gesellschaftlichen Veränderungen des frühen 20. Jahrhunderts
- Die Beziehung zwischen Kino und Theater und die spezifischen Eigenschaften beider Medien
- Die Rolle von Sprache und Bild im Film
- Die Diskussion um die Akzeptanz des Films als Kunstform
- Die Debatte über die Auswirkungen des Films auf die Kultur und die Wertevorstellungen der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der "Kinodebatte" ein und stellt die historische Entwicklung des Films von seiner Entstehung bis zur wachsenden Bedeutung in den 1910er Jahren dar. Sie beleuchtet die Debatte über die Rolle des Films in der Kultur und die Auseinandersetzung mit seinen spezifischen Eigenschaften und Ausdrucksmitteln.
2. Kino als Ausdruck des Zeitgeistes
Dieses Kapitel befasst sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich auch im Film widerspiegeln. Die Industrialisierung, die Urbanisierung und die beschleunigte Lebensweise prägten den Zeitgeist, der sich in den Filmen widerspiegelte. Egon Friedells Analyse des Zeitgeistes und dessen Auswirkungen auf die Kultur wird in diesem Kapitel behandelt.
Schlüsselwörter
Kino, Film, Debatte, Literatur, Theater, Kultur, Zeitgeist, Medien, Gesellschaft, Ausdruck, Sprache, Bild, Friedell, Lukács, Hofmannsthal, Ästhetik, Unterhaltung, Industrialisierung, Urbanisierung, Verfall, Kunstform.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „Kinodebatte“ der 1910er und 1920er Jahre?
Es war eine intellektuelle Auseinandersetzung zwischen Schriftstellern und Kritikern über den kulturellen Wert des neuen Mediums Film und dessen Abgrenzung zu Theater und Literatur.
Warum wurde das Kino anfangs von der Kulturkritik abgelehnt?
Filme galten zunächst als technisches Kuriosum oder Jahrmarkt-Sensation für ungebildete Schichten und wurden nicht als ernsthafte Kunstform anerkannt.
Welche Autoren stehen im Fokus dieser Hausarbeit?
Die Arbeit analysiert die Positionen von Egon Friedell, Georg Lukács und Hugo von Hofmannsthal zum Thema Film.
Wie sah Hugo von Hofmannsthal das neue Medium Film?
In seinem Beitrag „Der Ersatz für die Träume“ (1921) beschrieb er das Kino als einen Ort, der dem modernen Menschen einen Ausgleich zur technisierten und industrialisierten Welt bietet.
Was war der Kern der Diskussion zwischen Kino und Theater?
Die Debatte drehte sich um das spezifische Wesen beider Medien, insbesondere um das Verhältnis von Sprache im Theater gegenüber dem bewegten Bild im Film.
Wie wirkten sich Industrialisierung und Urbanisierung auf das Kino aus?
Das Kino wurde als Spiegel des beschleunigten Zeitgeistes der Großstädte (wie Berlin) wahrgenommen und passte sich durch narrative Langfilme dem Geschmack des Bildungsbürgertums an.
- Quote paper
- Tobias Schneider (Author), 2005, Kinodebatte (1909-1929): Egon Friedell, Georg Lukács, Hugo von Hofmannsthal und ihre Meinung zum neuen Medium Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81326