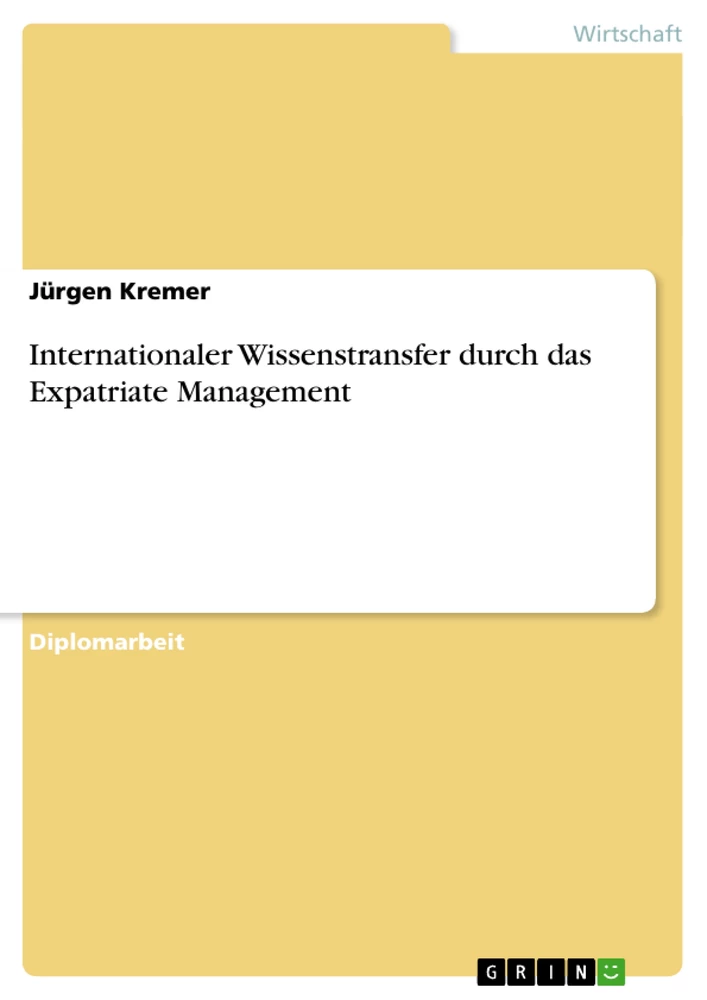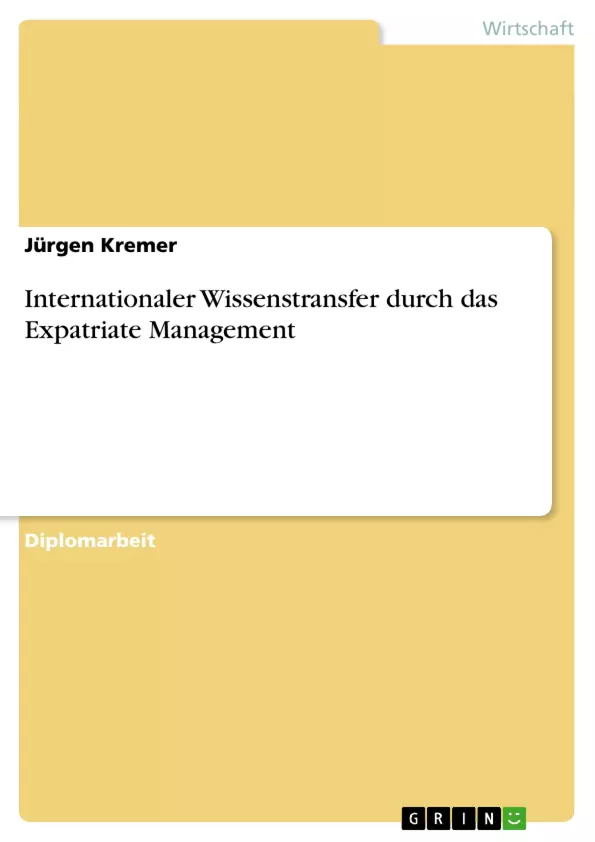In dieser Arbeit werden drei verschiedene Forschungsfelder der Betriebswirtschaftslehre miteinander verbunden: erstens die Theorie der MNU, zweitens das Wissensmanagement und drittens das Expatriate Management. Jeweils einzeln wurden die Themengebiete bereits ausführlich diskutiert, jedoch fand bislang kaum eine integrative Verknüpfung dieser Themenkomplexe statt. So konstatieren Morley und Heraty: „To date, there has been a dearth of research on the role of international assignees in the international knowledge transfer process, and the authors suggest that this has the potential to be a very fruitful line of inquiry, particularly when it is allied with a stickiness factors–based theoretical framework of international knowledge transfer.”
Ziel dieser Arbeit soll es sein, diesen beklagten Mangel zu verringern und die Forschungslücke zumindest teilweise zu schließen. Durch die Integration und Kombination der drei Forschungsfelder soll das Verständnis für Wissenstransferprozesse in MNU durch das Expatriates Management untersucht und erweitert werden. Ferner wird zu prüfen sein, in welcher Art und Weise Expatriates einen Beitrag zum Erhalt und Aufbau von wissensbasierten Wettbewerbsvorteilen leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Multinationale Unternehmen (MNU)
- Definition und Ziele der MNU aus wissensorientierter Sichtweise
- Typologie der MNU
- Typologie der MNU nach Perlmutter
- Wissensmanagement
- Wissen
- Begriffe – Zeichen, Daten, Informationen, Wissen
- Wissensarten
- Implizites Wissen vs. explizites Wissen
- Individuelles Wissen vs. kollektives Wissen
- Wissenstransfer
- Humanorientierter Ansatz des Wissenstransfers
- Wissenstransfer auf individueller Ebene
- Wissenstransfer auf Gruppenebene
- Wissenstransfer auf organisationaler Ebene
- Expatriate Management
- Die Internationalisierung des Personalmanagements
- Die Entsendung als kultureller Interaktionsprozess
- Arbeitsdefinition von Kultur
- Das Kulturmodell von Hofstede
- Formen der Entsendung
- Die Entsendung von Expatriates
- Die Entsendung von Inpatriates
- Die Entsendung von Flexpatriates
- Die Phasen des Auslandseinsatzes
- Mitarbeiterauswahl
- Vorbereitung auf den Auslandseinsatz
- Auslandseinsatzphase und Betreuung
- Wiedereingliederung
- Die Ziele von Auslandseinsätzen
- Kompensation mangelnden Humankapitals im Gastland
- Koordination und Kontrolle der MNU
- Führungskräfteentwicklung
- Erfolgsbestimmung der Entsendung
- Internationaler Wissenstransfer durch das Expatriate Management
- Die Auslandsentsendung als Transfermechanismus impliziten Wissens
- Unterschiedliche Entsendungsformen und die Auswirkungen auf den Wissenstransfer
- Einfluss der kulturellen Distanz auf den Wissenstransfer
- Hindernisses des Wissenstransfers
- Individuelle Hindernisse
- Kollektive Hindernisse
- Organisationale Hindernisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, das Verständnis für Wissenstransferprozesse in multinationalen Unternehmen (MNU) durch das Expatriate Management zu untersuchen und zu erweitern. Durch die Integration und Kombination der drei Forschungsfelder Multinationale Unternehmen, Wissensmanagement und Expatriate Management soll geklärt werden, in welcher Art und Weise Expatriates einen Beitrag zum Erhalt und Aufbau von wissensbasierten Wettbewerbsvorteilen leisten können.
- Die strategische Bedeutung innerorganisationaler Wissenstransfers in MNU
- Expatriate Management als Mittel des Wissenstransfers
- Der Einfluss von Entsendeformen und kultureller Distanz auf den Wissenstransfer
- Die Identifizierung und Analyse von Wissenstransferbarrieren
- Die Ableitung von Gestaltungsanforderungen für einen effektiven Wissenstransfer in MNU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Als Einstieg in die Thematik wird die Theorie der MNU diskutiert und die strategische Bedeutung innerorganisationaler Wissenstransfers in MNU aus ressourcenorientierter bzw. wissensorientierter Sichtweise aufgezeigt. Kapitel 3 beleuchtet das Konzept des Wissensmanagements und Wissenstransferprozesse als Teilbereich des Wissensmanagements. Kapitel 4 widmet sich dem Thema des Expatriate Managements und analysiert verschiedene Formen der Entsendung, typische Phasen und die Ziele von Auslandseinsätzen. Kapitel 5, der Hauptteil der Arbeit, erforscht den Entsendeprozess als Wissenstransfermechanismus von MNU und zeigt, dass Expatriates einen Beitrag zum Erhalt und Ausbau von Wettbewerbsvorteilen leisten können. Es werden außerdem spezifische Transferbarrieren bei der Entsendung herausgearbeitet, um Gestaltungsanforderungen für einen effektiven Wissenstransfer ableiten zu können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet das Thema des internationalen Wissenstransfers durch das Expatriate Management. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen multinationale Unternehmen, Wissenstransfer, Expatriate Management, kulturelle Distanz, Transferbarrieren und Wettbewerbsvorteile. Die Arbeit greift auf verschiedene theoretische Ansätze und empirische Studien zurück, um die Bedeutung des internationalen Wissenstransfers für den Erfolg von multinationalen Unternehmen aufzuzeigen. Die Analyse von verschiedenen Formen der Entsendung und den Einfluss von kulturellen Unterschieden auf den Wissenstransfer liefert wertvolle Einsichten für die Gestaltung und Optimierung von Wissenstransferprozessen in multinationalen Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Forschungsfelder werden in dieser Arbeit verknüpft?
Die Arbeit verbindet die Theorie multinationaler Unternehmen (MNU), das Wissensmanagement und das Expatriate Management.
Welche Rolle spielen Expatriates beim Wissenstransfer?
Expatriates dienen als wichtige Mechanismen für den Transfer von insbesondere implizitem Wissen zwischen verschiedenen Standorten eines multinationalen Unternehmens.
Was sind typische Hindernisse beim internationalen Wissenstransfer?
Es wird zwischen individuellen, kollektiven und organisationalen Hindernissen unterschieden, die den effektiven Austausch von Wissen behindern können.
Wie beeinflusst die kulturelle Distanz den Wissenstransfer?
Die Arbeit untersucht, wie kulturelle Unterschiede (basierend auf Modellen wie dem von Hofstede) den Prozess und Erfolg des Wissenstransfers beeinflussen.
Welche Formen der Entsendung werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen der Entsendung von Expatriates, Inpatriates und Flexpatriates.
Was ist das Ziel des Expatriate Managements aus strategischer Sicht?
Ziel ist der Erhalt und Aufbau von wissensbasierten Wettbewerbsvorteilen durch Koordination, Kontrolle und Führungskräfteentwicklung.
- Arbeit zitieren
- Diplomkaufmann Jürgen Kremer (Autor:in), 2006, Internationaler Wissenstransfer durch das Expatriate Management, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81334