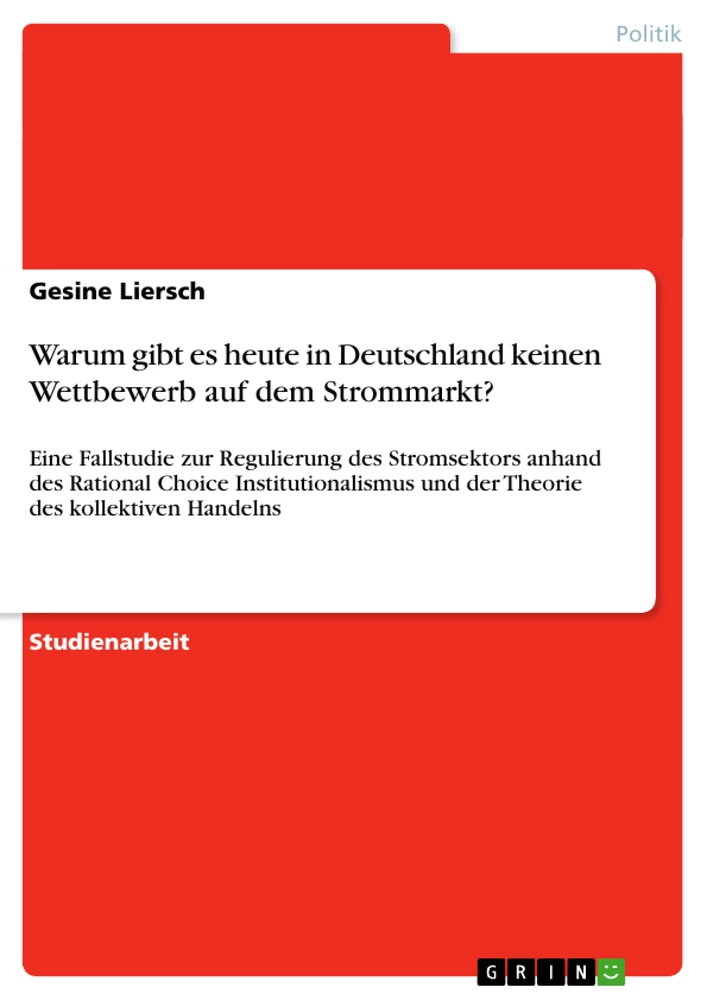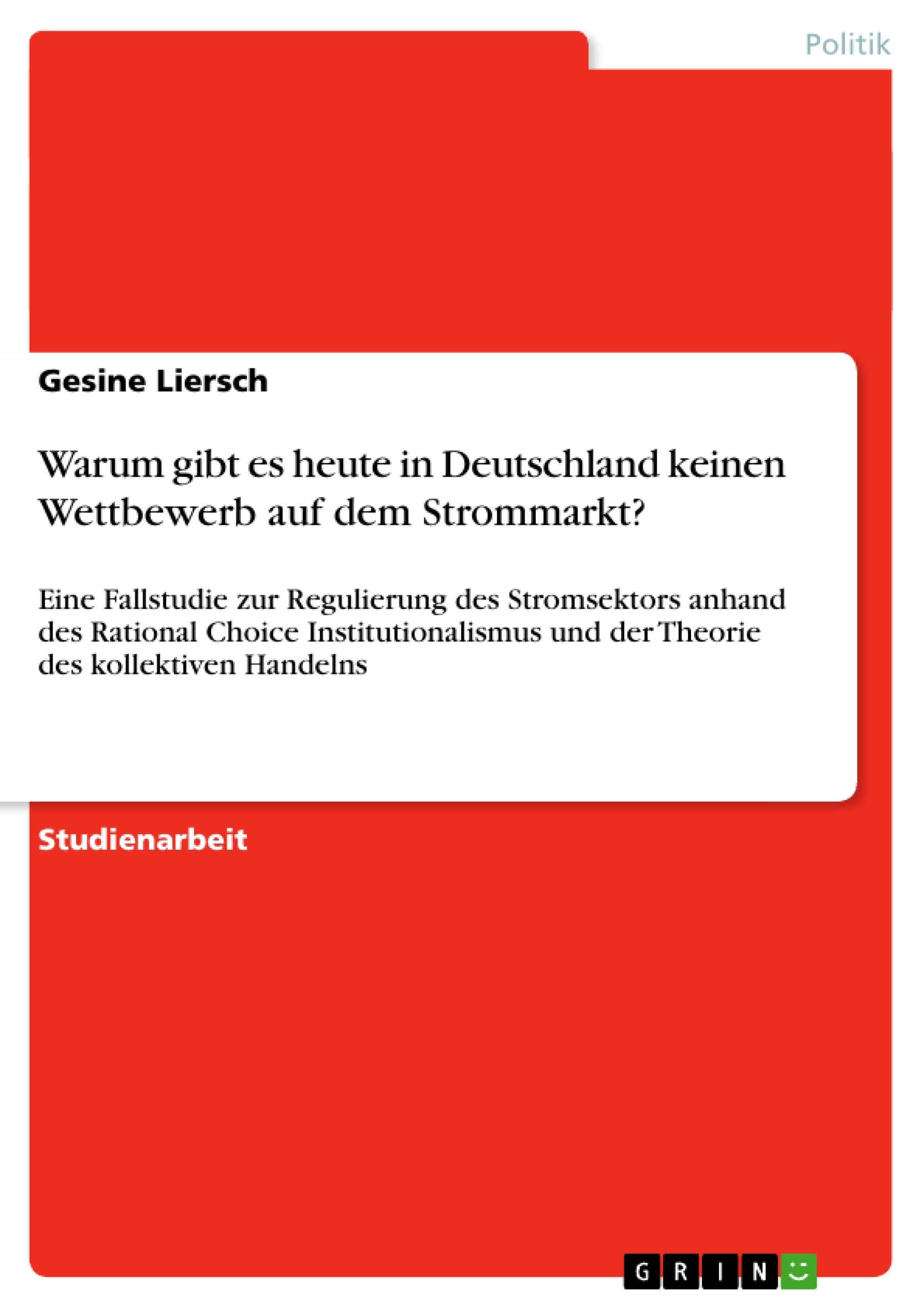Dieser Arbeit soll erklären, warum es auf dem deutschen Strommarkt immer noch keinen wirklichen Wettbewerb gibt, obwohl seit seiner Liberalisierung von 1998 durch unterschiedliche Regulierungsformen versucht wird, Wettbewerb durch einen diskriminierungsfreien Netzzugang herzustellen. Die Stromnetzbesitzer E.on, RWE, EnBW und Vattenfall sollten sich mit den betroffenen Interessengruppen im Modell des verhandelten Netzzugangs auf eine angemessene Preisbestimmungsmethode einigen und diese anwenden. Nachdem dieses Modell keinen Erfolg zeigte, wacht seit 2005 die Bundesnetzagentur über die Preise. Doch nur institutionalisierte staatlich-private
Kooperation mit gleichberechtigten Akteuren kann Marktversagen beheben. Institutionen entstehen aber durch egoistisches menschliches Handeln. Das Eigennutzstreben von Politikern verursacht Staatsversagen und verhindert den gesellschaftlich optimalen
Wettbewerb, der zu niedrigeren Strompreisen führen und langfristig zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands beitragen würde.
This paper shows why there is no real competition on the German electricity market although various regulations aimed at creating non-discriminating access to the powersupply networks have been passed since its liberalisation in 1998. E.on, RWE, EnBW, and Vattenfall – the owners of the power-supply networks – were supposed to negotiate appropriate methods of price determination with the concerned interest groups. Due to the failure of this model, the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway has been regulating the prices since 2005. But only institutionalized cooperation on an equal footing of the state and the private sector can eliminate market failure. Institutions, however, are a result of human egotism. Politicians motivated by self-interest are at the root of governmental failure, preventing
the socially optimal competition that would result in lower electricity prices and further Germany's economic development in the long term.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.2 Vorgehen
- Soziologische Erklärungen
- 2.1 Das handlungstheoretische Modell
- 2.1.1 Die,Logik der Situation'
- 2.1.2 Die, Logik der Selektion'
- 2.1.3 Die, Logik der Aggregation'
- 2.1.4 Zusammenfassung
- 2.2 Die Handlungstheorie
- 2.2.1 Was heißt Handeln?
- 2.2.2 Intentionalerklärungen
- 2.2.3 Webers Handlungstypologien
- 2.3 Die Rational Choice Theorie
- 2.3.1 Die Entwicklung des Rationalitätsbegriffs
- 2.3.2 Der Homo Oeconomicus
- 2.3.3 Der Homo Sociologicus
- 2.3.4,bounded rationality'
- Die Besonderheiten Strommarktes
- Kollektivgüter/ Öffentliche Güter
- Der Rational Choice Institutionalismus
- 5.1 Die Principal-Agent-Theorie
- 5.2 Die Transaktionskostentheorie
- 5.3 Die Theorie der Verfügungsrechte (,property rights')
- 5.3.1 Die Regulierungsformen
- 5.3.2 Das Gefangenendilemma
- 5.3.3 Vom Kooperations- zum Koordinationsdilemma durch institutionelle Regeln
- 5.3.4 Das Kooperationsspiel
- 5.4 Die regulierte Selbstregulierung
- 5.5 Fazit
- Die Public Choice Theorie
- 6.1 Mancur Olsons Theorie des kollektiven Handelns
- 6.1.1 Die Organisationsgröße
- 6.1.2 Das Rentenstreben
- 6.1.3,,Aufstieg und Niedergang der Nationen“
- 6.2 Interessengruppen im Regulierungsprozess
- Bewertung der Theorien
- Die Regulierung des Stromsektors seit 1998
- 8.1. relevante Akteure und ihre Ziele
- 8.2 informelle Beziehungen zwischen Stromlobby und Politik
- 8.3 Der formal institutionelle Rahmen der Regulierung des Strommarktes seit 1998 und die Entwicklung des Marktes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, warum es trotz der Liberalisierung des deutschen Strommarktes im Jahr 1998 keinen wirklichen Wettbewerb gibt. Die Arbeit analysiert die Regulierungsmechanismen, die zur Schaffung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs eingesetzt wurden, und untersucht, warum diese bisher nicht zu einem funktionierenden Wettbewerb geführt haben. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Staates und der privaten Akteure im Regulierungsprozess und zeigt, wie egoistisches Handeln zu Staatsversagen und der Verhinderung eines optimalen Wettbewerbs führen kann.
- Die Regulierung des deutschen Strommarktes nach der Liberalisierung
- Der Einfluss des Rational Choice Institutionalismus und der Public Choice Theorie auf die Regulierung
- Die Rolle des Staates und der privaten Akteure im Regulierungsprozess
- Die Herausforderungen der Regulierung von Kollektivgütern
- Die Auswirkungen von Staatsversagen auf den Wettbewerb im Strommarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Fragestellung und das Vorgehen der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene soziologische Erklärungen für menschliches Handeln, darunter die Handlungstheorie und die Rational Choice Theorie, die als Grundlage für die Analyse des Strommarktes dienen.
Kapitel 3 behandelt die Besonderheiten des Strommarktes und die damit verbundenen Herausforderungen für eine effektive Regulierung.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Theorie der Kollektivgüter, die wichtige Erkenntnisse für die Analyse des Strommarktes liefern, da Strom als öffentliches Gut betrachtet werden kann.
Kapitel 5 erläutert die wichtigsten Elemente des Rational Choice Institutionalismus, darunter die Principal-Agent-Theorie, die Transaktionskostentheorie und die Theorie der Verfügungsrechte. Die Anwendung dieser Theorien auf die Regulierung des Strommarktes wird aufgezeigt.
Kapitel 6 behandelt die Public Choice Theorie, insbesondere die Theorie des kollektiven Handelns von Mancur Olson, und ihre Bedeutung für die Analyse des Regulierungsprozesses.
Schlüsselwörter
Strommarkt, Regulierung, Rational Choice Institutionalismus, Public Choice Theorie, Kollektivgüter, Staatsversagen, Wettbewerb, diskriminierungsfreier Netzzugang, Interessengruppen, institutionelle Regeln, egoistisches Handeln, Politiker, Marktversagen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es kaum Wettbewerb auf dem deutschen Strommarkt?
Trotz Liberalisierung verhindern Faktoren wie Netzmonopole der großen Anbieter (E.on, RWE, EnBW, Vattenfall) und politisches Eigeninteresse echten Wettbewerb.
Welche Rolle spielt die Bundesnetzagentur?
Seit 2005 reguliert sie die Netzentgelte, um einen diskriminierungsfreien Netzzugang für Drittanbieter zu gewährleisten.
Was ist die "Public Choice Theorie" im Kontext Strommarkt?
Sie erklärt, wie das Eigennutzstreben von Politikern und Lobbygruppen zu Staatsversagen führt und gesellschaftlich optimale Lösungen verhindert.
Was versteht man unter "diskriminierungsfreiem Netzzugang"?
Dass jeder Stromanbieter die Netze der großen Betreiber zu den gleichen, fairen Bedingungen nutzen darf, um Kunden zu beliefern.
Warum scheiterte das Modell des "verhandelten Netzzugangs"?
Die ungleiche Machtverteilung zwischen Netzbesitzern und kleinen Interessengruppen verhinderte eine Einigung auf angemessene Preise.
- Quote paper
- Gesine Liersch (Author), 2007, Warum gibt es heute in Deutschland keinen Wettbewerb auf dem Strommarkt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81349