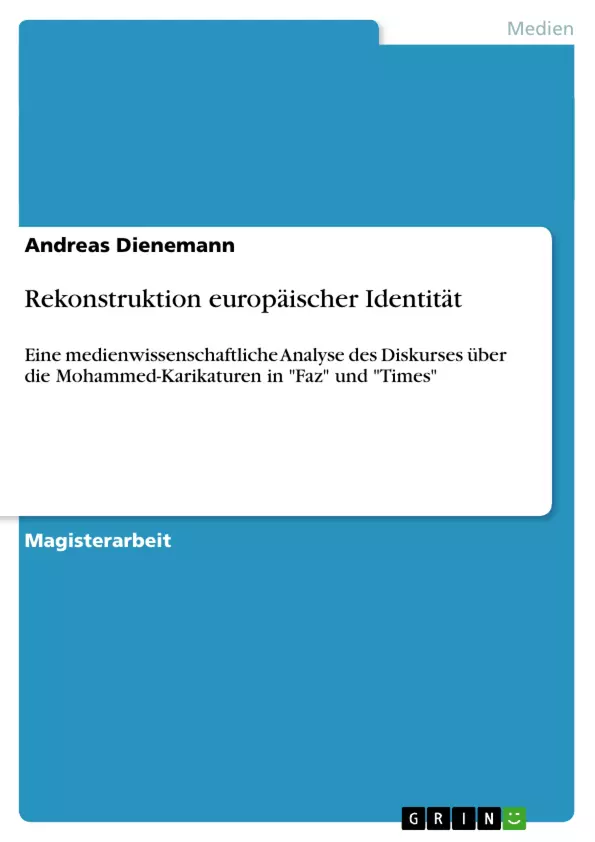Eine gemeinsame Europäische Identität ist von herausragender Bedeutung für die Zukunft der Europäischen Union. Einerseits schafft sie aus politikwissenschaftlicher Sicht belastbare und stabile Loyalitäten für das politische System der EU und anderseits bietet eine kollektive Europäische Identität Haltepunkte und Sicherheit in den von Ungewissheiten und sozialen Isolationsängsten geprägten Gesellschaften der Postmoderne. Allerdings sind sowohl die Existenz der Europäischen Identität als auch die Möglichkeiten ihrer Bestimmbarkeit nach wie vor umstritten.
Die Arbeit spiegelt im ersten Schritt den Stand der Forschung zur Europäischen Identität. Ausführlich werden die theoretischen Versuche historischer Identitätskonstruktionen und die empirischen Untersuchungen zur europäischen Wertepraxis behandelt. Im Hauptteil wird mit der komparativen Medienanalyse ein alternativer Ansatz zur Bestimmung der europäischen Identität vorgestellt. Anhand von Beiträgen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Times aus London wurde der Diskurs über die Mohammed-Karikaturen untersucht. Dieser Diskurs entwickelte sich im Februar 2006 und basierte auf der Eskalation eines Konflikts zwischen Teilen der islamischen Welt und den Europäern, der sich an zwölf Karikaturen des Propheten Mohammed entzündete. Die Vorwürfe der Islamisten und die teils hysterischen Reaktionen der Muslime auf die Karikaturen haben einen komplexen öffentlichen Selbstverständigungsprozess in den europäischen Medien entfacht. Im Rahmen der Arbeit wurden aus den relevanten Beiträgen der zwei europäischen Leitmedien die relevanten Komponenten einer europäischen Identität rekonstruiert. Neben konkreten Aussagen zu Parallelen und Unterschieden hinsichtlich verschiedener ausgewiesener Identitätskerne liefert die Arbeit vor allem einen aktuellen Beitrag zur Europäischen Werterealität, die ein Fundament der Europäischen Identität darstellt.
- Citar trabajo
- Magister Medienwissenschaft Andreas Dienemann (Autor), 2007, Rekonstruktion europäischer Identität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81423