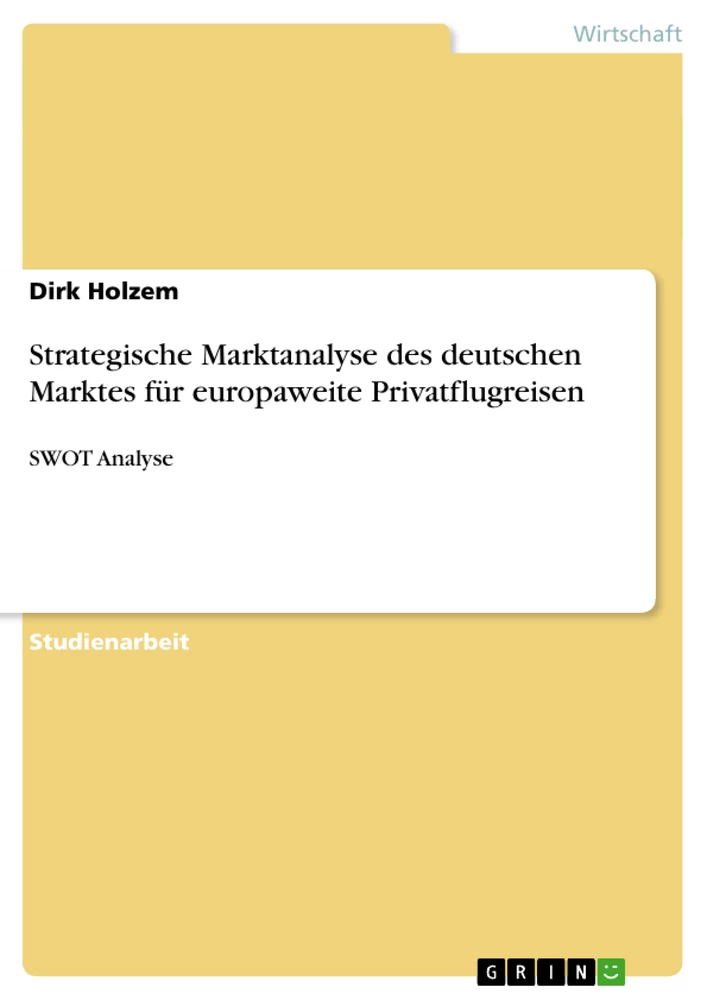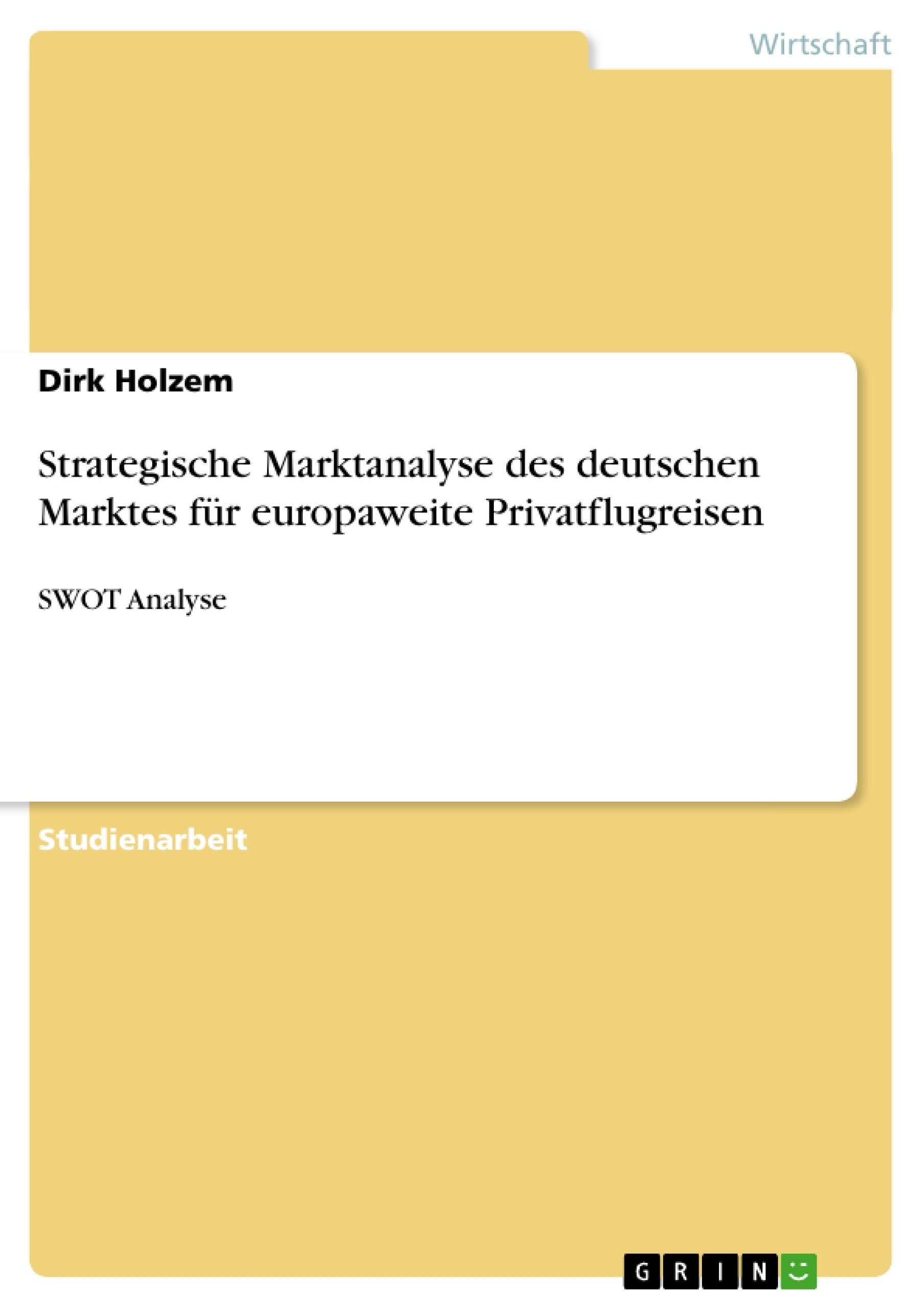Die Marktsituation für europaweite Privatflugreisen unterliegt in den letzen Jahren deutlichen, den Markt verändernden Entwicklungen. Das Zusammenspiel und Gleichgewicht der Wettbewerber wird in Zukunft weiter nachhaltig beeinflusst werden. Die im Laufe des starken Wachstums auf-gebauten Überkapazitäten und Angleichung der Geschäftsmodelle führen zu einem immer stärker werdenden Verdrängungswettbewerb unter den europäischen Fluggesellschaften. Der gesättigte Markt konsolidiert sich zunehmend und unterliegt einer gesteigerten Fragmentierung. Im ersten Teil dieser Arbeit, werden für den bereits durch die Auf- gabenstellung abgegrenzten Markt, Segmentierungsmöglichkeiten in Re-lation der möglichen Geschäftsmodelle aufgezeigt. Für das Makroumfeld werden die generellen Trends und Entwicklungen bzw. Rahmenbeding-ungen ermittelt. Abschließend wird die Branche, anhand des Fünf-Kräfte-Model nach Porter auf ihre Struktur hin untersucht. Im zweiten Teil wird eine SWOT-Analyse am Beispiel der Fluggesellschaft Lufthansa durchgeführt. Es werden Strategien abgeleitet, die dem Unternehmen helfen sollen, unter Betrachtung seiner internen und externen Umwelt, langfristig Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil1: Strategische Marktanalyse
- Segmentierung des deutschen Marktes
- Marketing Umgebung
- Politisch-rechtliche Umgebung
- Gesamtwirtschaftlich
- Soziodemographische Umwelt
- Technologische Umwelt
- Ökologische Umwelt
- Branchenstrukturanalyse
- Existierender Wettbewerb
- Gefahr durch Ersatzprodukte
- Position der Konsumenten
- Macht der Lieferanten
- Gefahr durch neue Marktteilnehmer
- Teil 2: SWOT- Analyse am Beispiel Lufthansa
- SWOT Analyse
- Wesentliches zur Interne Umwelt der Lufthansa
- Ableitung von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit einer strategischen Analyse des deutschen Marktes für europaweite Privatflugreisen. Ziel ist es, die Wettbewerbslandschaft dieser Branche zu beleuchten und die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Marktentwicklung zu identifizieren. Der Fokus liegt auf der Segmentierung des deutschen Marktes, der Analyse des Makroumfelds und der Branchenstrukturanalyse anhand des Fünf-Kräfte-Modells nach Porter.
- Segmentierung des deutschen Marktes für Privatflugreisen
- Analyse des Makroumfelds, einschließlich politischer, wirtschaftlicher, soziodemografischer, technologischer und ökologischer Faktoren
- Branchenstrukturanalyse anhand des Fünf-Kräfte-Modells
- SWOT-Analyse der Lufthansa im Kontext der Wettbewerbssituation
- Entwicklung von Strategien für die Lufthansa, um langfristige Wettbewerbsvorteile zu erzielen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Segmentierung des deutschen Marktes für europaweite Privatflugreisen. Es werden verschiedene Segmente von Nachfragern und Anbietern identifiziert und deren jeweilige Eigenschaften und Bedürfnisse beschrieben. Anschließend wird das Makroumfeld des Marktes untersucht, wobei die politischen, wirtschaftlichen, soziodemografischen, technologischen und ökologischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.
Im nächsten Kapitel erfolgt die Branchenstrukturanalyse anhand des Fünf-Kräfte-Modells nach Porter. Hier werden die Wettbewerbsintensität, die Gefahr durch Ersatzprodukte, die Verhandlungsmacht der Kunden, die Verhandlungsmacht der Lieferanten und die Gefahr durch neue Marktteilnehmer untersucht. Es wird die Bedeutung von Kostenführerschaft, Differenzierung und Schwerpunktlegung für den Erfolg in der Branche herausgestellt.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der SWOT-Analyse der Lufthansa. Es werden die Stärken und Schwächen des Unternehmens im Kontext der Wettbewerbssituation analysiert, sowie Chancen und Risiken, die sich aus der externen Umwelt ergeben. Abschließend werden daraus Strategien abgeleitet, die Lufthansa helfen sollen, langfristige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet das Thema des deutschen Marktes für europaweite Privatflugreisen und fokussiert dabei auf die Bereiche Marktsegmentierung, Branchenstrukturanalyse, Wettbewerb, Kostenführerschaft, Differenzierung, SWOT-Analyse und strategische Planung. Weitere wichtige Themenbereiche sind der Einfluss des Makroumfelds, die Bedeutung von Partnern und Allianzen, sowie die Herausforderungen und Chancen der Branche im Kontext des wachsenden LCC-Segments.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelt sich der Markt für Privatflugreisen in Europa?
Der Markt ist gesättigt, unterliegt einer starken Fragmentierung und einem intensiven Verdrängungswettbewerb zwischen den Fluggesellschaften.
Was ist das Fünf-Kräfte-Modell nach Porter?
Es analysiert die Branchenstruktur anhand von Wettbewerbsintensität, Ersatzprodukten, Kundenmacht, Lieferantenmacht und neuen Marktteilnehmern.
Welche Strategien werden für die Lufthansa abgeleitet?
Basierend auf einer SWOT-Analyse werden Strategien zur Erzielung langfristiger Wettbewerbsvorteile gegenüber Billigfliegern (LCC) entwickelt.
Welche Umweltfaktoren beeinflussen den Flugmarkt?
Die Analyse betrachtet politisch-rechtliche, gesamtwirtschaftliche, soziodemographische, technologische und ökologische Rahmenbedingungen.
Warum ist Marktsegmentierung in der Luftfahrt wichtig?
Sie hilft dabei, verschiedene Geschäftsmodelle an die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Kundengruppen anzupassen.
- Quote paper
- Dipl. Ing., Dipl. wirt. Ing. Dirk Holzem (Author), 2007, Strategische Marktanalyse des deutschen Marktes für europaweite Privatflugreisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81558