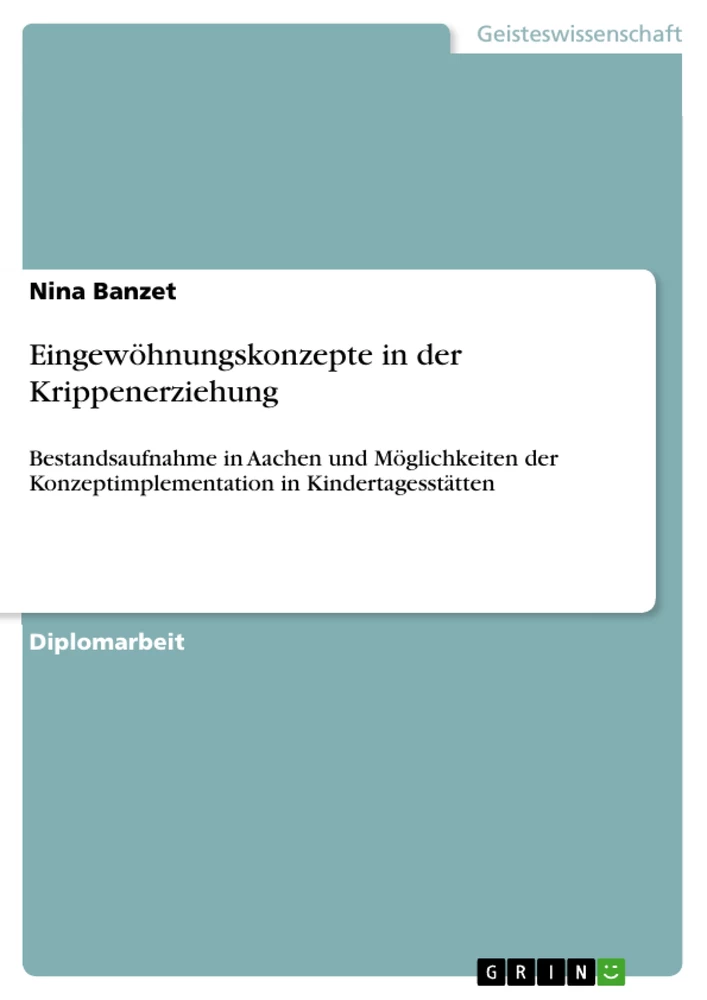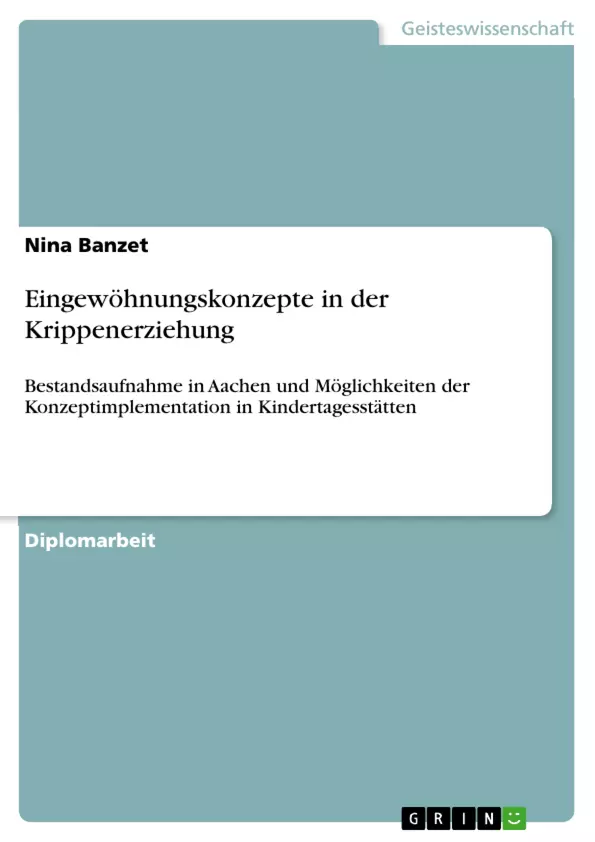Im hier vorliegenden Buch geht es um die Eingewöhnung von Kleinkindern in Kindertagesstätten.
Im Anschluss an eine Einleitung folgt im zweiten Kapitel eine Überblick über bindungstheoretische Grundlagen. Im dritten Kapitel geht es um die Darstellung konkreter Forschungsergebnisse zur Eingewöhnung in der Krippenerziehung und Auswirkungen der Eingewöhnung ohne eine angemessene Beteiligung der Eltern.
Kapitel vier dient einer Zwischenbilanz, in der zusammengefasst wird, was aufgrund bindungstheoretischer Grundlagen und aktueller Forschungsergebnisse zur Eingewöhnung in der Krippenerziehung bei der heutigen Gestaltung der Eingewöhnung von Kindern unter drei Jahren beachtet werden sollte.
In Kapitel fünf folgt schließlich die Sichtung bestehender Eingewöhnungskonzepte in Deutschland und eine ausführliche Darstellung des „Berliner Modells“ nach Laewen.
Im Anschluss daran dient Kapitel sechs der Auswertung einer Bestandaufnahme in Aachen zur Gestaltung der Eingewöhnung.Darauf aufbauend geht es in Kapitel sieben um die Möglichkeiten der Konzeptimplementation in Aachener Kindertagesstätten und die Berufsperspektive, die sich dadurch für SozialpädagogInnen eröffnen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bindungstheorie
- Geschichte der Bindungsforschung
- Grundlagen der ethologischen Bindungstheorie
- Definition von Bindung und erste Grundlagen
- Bindungsverhalten
- Bindungs-, Explorationsverhalten und die sichere Basis
- Das Bindungs- und Fürsorgesystem
- Phasen der Bindungsentwicklung
- Unterschiedliche Bindungsmuster
- Erste Entdeckungen
- Der Fremde-Situation-Test
- Die vier Bindungsmuster
- Stabilität der Bindungsqualität
- Interkulturelle Unterschiede
- Einflussfaktoren zur Bindungssicherheit
- Unterschiedliche Bindungspersonen
- Zusammenfassung
- Forschungsergebnisse zur Eingewöhnung in der Krippenerziehung
- Vorbemerkungen
- Eingewöhnung ohne Beteiligung der Eltern
- Auswirkungen der Eingewöhnung ohne Beteiligung der Eltern
- In Bezug auf die Kinder
- In Bezug auf ErzieherInnen und andere Betreuungspersonen
- Beteiligung der Eltern an der Eingewöhnung in die Krippe
- Zum Zusammenhang zwischen kindlichem Bindungsmuster und Krippeneintritt
- Zwischenbilanz: Was muss demnach bei der Eingewöhnung von Kleinkindern beachtet werden?
- Sichtung bestehender Eingewöhnungskonzepte in Deutschland
- Vorbemerkungen
- Das „Berliner Modell“ nach Laewen, Andres und Hédervári (2003)
- Grundlagen des „Berliner Modells“ nach Laewen, Andres und Hédervári (2003)
- Die fünf Stufen des „Berliner Modells“ nach Laewen, Andres und Hédervári (2003)
- Das Beziehungsdreieck nach Laewen und Andres (1993)
- Leitlinien zur Kooperation von Eltern und ErzieherIn nach Berry (1993)
- Erfahrungen mit dem „Berliner Modell“
- Bestandsaufnahme in Aachen
- Vorbemerkungen
- Vorbereitung und Durchführung der Umfrage
- Auswertung der Fragebögen
- Auswertung der Experteninterviews
- Gesamtergebnisse
- Vermutungen aufgrund der Gesamtergebnisse
- Fazit (Was könnte man daraus schließen?)
- Möglichkeiten der Umsetzung des „Berliner Modells“ in Aachener Kitas
- Vorbemerkungen
- Zielgruppen in Aachen
- Allgemeine Ziele
- Möglicher Aufbau der Veranstaltungen
- Eine Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
- Eine Informationsveranstaltung für Eltern
- Welche Chancen könnten die Veranstaltungen eröffnen?
- Bedingungen zur Realisierung meiner Ideen in Aachen
- Zukunftsperspektive
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit setzt sich zum Ziel, die Eingewöhnungskonzepte in der Krippenerziehung in Aachen zu untersuchen und Möglichkeiten der Implementierung des „Berliner Modells“ in Kindertagesstätten zu erforschen. Dabei stehen die Bindungstheorie und deren Bedeutung für die Eingewöhnung von Kleinkindern im Zentrum der Betrachtung.
- Analyse der aktuellen Eingewöhnungspraxis in Aachener Kitas
- Bewertung verschiedener Eingewöhnungskonzepte, insbesondere des „Berliner Modells“
- Entwicklung von konkreten Handlungsempfehlungen für die Umsetzung des „Berliner Modells“ in Aachener Kitas
- Untersuchung der Auswirkungen der Eingewöhnung auf die Entwicklung von Kindern, Eltern und ErzieherInnen
- Bedeutung der Bindungstheorie für die Gestaltung der Eingewöhnungsphase
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema der Eingewöhnung in der Krippenerziehung ein und zeigt die Relevanz des Themas für die frühkindliche Bildung und Erziehung auf. Sie beleuchtet zudem die Rolle von SozialpädagogInnen in diesem Bereich.
- Die Bindungstheorie: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der Bindungstheorie, beginnend mit ihrer historischen Entwicklung und den zentralen Grundprinzipien. Es erläutert die Bedeutung von Bindungsverhalten für die Entwicklung von Kleinkindern und die Rolle der sicheren Basis.
- Forschungsergebnisse zur Eingewöhnung in der Krippenerziehung: Dieses Kapitel untersucht die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Eingewöhnung in der Krippenerziehung. Es beleuchtet verschiedene Eingewöhnungskonzepte, die Auswirkungen auf Kinder und ErzieherInnen sowie die Bedeutung der Beteiligung der Eltern.
- Zwischenbilanz: Dieses Kapitel fasst die bisherigen Erkenntnisse zusammen und formuliert wichtige Aspekte, die bei der Eingewöhnung von Kleinkindern berücksichtigt werden sollten.
- Sichtung bestehender Eingewöhnungskonzepte in Deutschland: Dieses Kapitel stellt verschiedene etablierte Eingewöhnungskonzepte in Deutschland vor, darunter das „Berliner Modell“, das Beziehungsdreieck und Leitlinien zur Kooperation von Eltern und ErzieherInnen.
- Bestandsaufnahme in Aachen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage und Experteninterviews, die durchgeführt wurden, um die Eingewöhnungspraxis in Aachener Kitas zu untersuchen.
- Möglichkeiten der Umsetzung des „Berliner Modells“ in Aachener Kitas: Dieses Kapitel entwickelt konkrete Handlungsempfehlungen für die Implementierung des „Berliner Modells“ in Aachener Kitas und beleuchtet die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Eingewöhnung, Krippenerziehung, Bindungstheorie, „Berliner Modell“, Beziehungsdreieck, Elternbeteiligung, frühkindliche Bildung, und professionelle pädagogische Arbeit. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Bindungssicherheit für die Eingewöhnung von Kleinkindern in die Krippe und analysiert verschiedene Eingewöhnungskonzepte. Besonderes Augenmerk liegt auf der Implementierung des „Berliner Modells“ in Aachener Kitas.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Bindungstheorie für die Krippeneingewöhnung wichtig?
Die Bindungstheorie erklärt, wie Kinder Sicherheit durch Bezugspersonen gewinnen. Ein Verständnis dieser Bindungsmuster ist essenziell für eine stressfreie Eingewöhnung in die Krippe.
Was ist das "Berliner Modell" der Eingewöhnung?
Das Berliner Modell nach Laewen ist ein strukturiertes Konzept, das eine schrittweise Eingewöhnung unter aktiver Beteiligung der Eltern vorsieht, um dem Kind eine sichere Basis zu bieten.
Welche Folgen hat eine Eingewöhnung ohne Elternbeteiligung?
Forschungsergebnisse zeigen, dass eine fehlende Beteiligung der Eltern negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Kindes und die Belastung der Erzieher haben kann.
Was wurde bei der Bestandsaufnahme in Aachen untersucht?
Es wurde mittels Umfragen und Experteninterviews ermittelt, wie die aktuelle Eingewöhnungspraxis in Aachener Kitas gestaltet ist und ob etablierte Modelle genutzt werden.
Welche Rolle spielen Sozialpädagogen bei der Konzeptimplementation?
Sozialpädagogen können Fortbildungen für Fachkräfte und Informationsabende für Eltern leiten, um moderne Eingewöhnungskonzepte wie das Berliner Modell erfolgreich einzuführen.
- Quote paper
- Dipl. Sozialpädagogin Nina Banzet (Author), 2007, Eingewöhnungskonzepte in der Krippenerziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81560