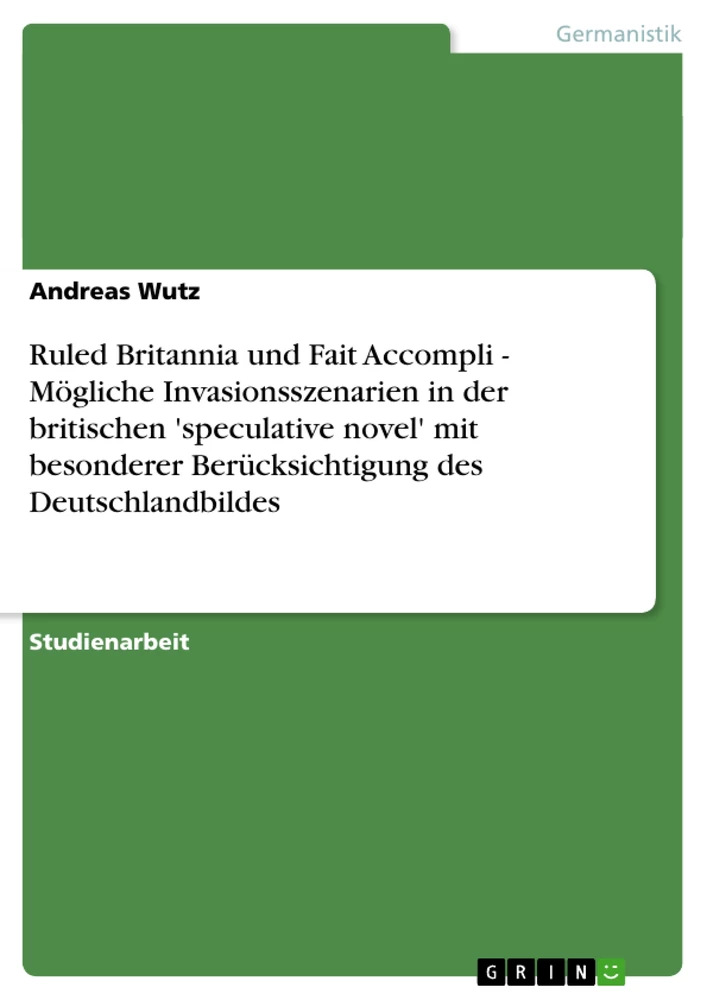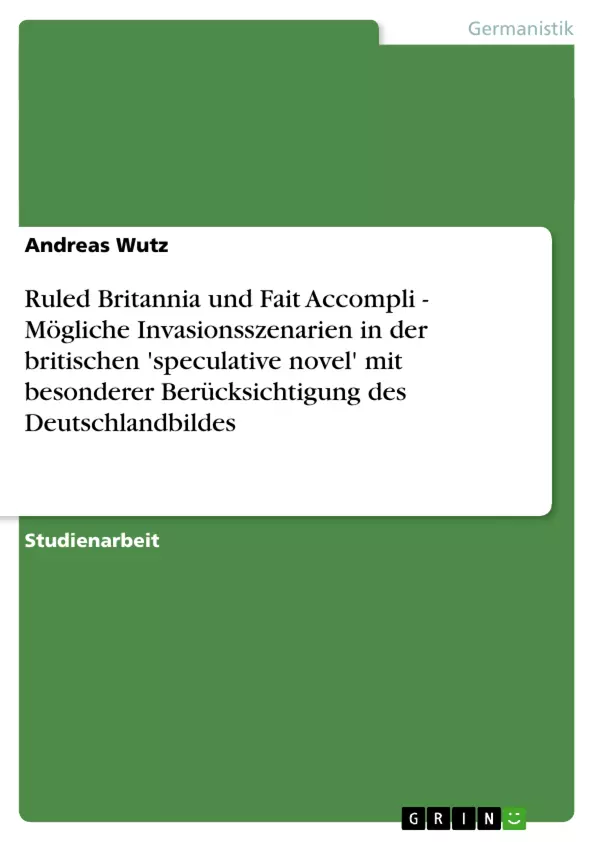Bedingt durch tiefgreifende politische Umwälzungen entsteht ab dem letzten Drittel des 19. Jhdts. eine Flut prophetischer Geschichten über den zukünftigen Konflikt zwischen Briten und Deutschen, die in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg einen ungeheueren Einfluss entfalteten. Die Autoren dieser Utopien vereinte ein gemeinsames Ziel: Sie sahen es als ihre Pflicht an, den nachfolgenden Krieg, der ihrer Überzeugung nach früher oder später zwischen den europäischen Großmächten ausbrechen würde, literarisch vorwegzunehmen und seine Ursachen und weitreichenden Folgen zu beschreiben. Der „Gedanke einer Invasion von draußen [entwickelte] einen morbiden Reiz“, da England, durch seine Insellage isoliert, von Okkupationen fremder Truppen seit der Eroberung durch William the Conqueror im Jahr 1066 verschont geblieben ist und das Königreich durch die Jahrhunderte hindurch seine Souveränität und Unabhängigkeit gewahrt hat. Zwischen 1871 und 1914 wurde England in der Literatur von 21 deutschen Invasionen heimgesucht und allein im Rekordjahr 1907 mussten die Briten vier Angriffe des kriegslüsternen Preußens hinnehmen.
Ziel dieser Arbeit ist, einen Überblick über die Bandbreite möglicher Invasionsszenarien und den damit verbundenen Deutschlandbildern zu geben. Neben den bekannteren englischsprachigen Klassikern des Genres speculative novel wie The Battle of Dorking, The Riddle of the Sands oder When William Came werden kursorisch auch die deutschen Pendants, die heute völlig in Vergessenheit geraten sind, gestreift. Der teilweise sehr unterschiedliche Umfang der einzelnen Kapitel erklärt sich zum einen aus der differierenden Bedeutung und Nachwirkung der Werke, ist aber auch der sehr heterogenen Forschungslage geschuldet. Die speculative novel fristet in der Literaturforschung im Schatten des weitaus populäreren britischen Spionageromans ein vernachlässigtes Dasein, das sich an einer nur äußerst sporadischen wissenschaftlichen Beschäftigung mit ausgewählten und für kanonisch erklärten Autoren wie Le Queux oder Chesney ablesen lässt. Sekundärliteratur zu diesem Themenkomplex existiert kaum. Monographien über den Spionageroman setzen meist mit Erskine Childers ein und widmen der speculative novel bestenfalls ein paar Seiten. Sekundärliteratur zu deutschen Autoren konnte ich nicht ausfindig machen und selbst der Zugang zu den originalen Primärtexten, die oftmals keine Neuauflagen bzw. Nachdrucke erlebt haben, gestaltet sich schwierig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorüberlegungen
- Definition der speculative novel
- Ansätze zur Definition literarischer Stereotype in ästhetischer und psychologischer Hinsicht
- Zeitgeschichtlicher und politischer Hintergrund: Reichsgründung, Flottenrivalität und der Wandel des Deutschlandbildes
- Das Spektrum britischer Invasionsphantasien von 1871 – 1910
- Die Planung der Invasion: Der Wolf im Schafspelz: Vom German Cousin zum Ränkeschmied
- Erskine Childers: The Riddle of the Sands
- William Le Queux: Spies of the Kaiser
- Die Durchführung der Invasion: Einfall der Deutschen in England
- George Tomkyns Chesney: The Battle of Dorking
- William Le Queux: The Invasion of 1910
- Die gelungene Invasion: Leben im besetzten England nach dem "fait accompli"
- Saki (= Hector Hugh Munro): When William Came
- Die Planung der Invasion: Der Wolf im Schafspelz: Vom German Cousin zum Ränkeschmied
- Deutsche Invasionsphantasien: Der unvermeidliche Krieg mit England
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung von möglichen Invasionsszenarien in der britischen speculative novel des späten 19. Jahrhunderts, insbesondere mit dem darin abgebildeten Deutschlandbild. Das Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Bandbreite der Invasionsphantasien und die damit verbundenen Stereotype zu geben.
- Die Entwicklung und Verbreitung von Invasionsphantasien als Reaktion auf politische und gesellschaftliche Veränderungen im späten 19. Jahrhundert
- Die Rolle von Stereotypen in der Konstruktion des Deutschlandbildes in der britischen Literatur
- Die unterschiedlichen Formen und Strategien der Darstellung deutscher Invasionen in der speculative novel
- Die Auswirkungen der Invasionsphantasien auf die politische und gesellschaftliche Debatte in England
- Die Bedeutung der speculative novel als literarisches Genre und ihre Funktion in der Konstruktion von Identität und Nation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Bedeutung von Invasionsphantasien als literarisches Genre dar. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Definitionsansätze der speculative novel und des Spionageromans vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert. Der dritte Abschnitt behandelt den zeitgeschichtlichen und politischen Kontext der Invasionsphantasien, insbesondere die Reichsgründung, die Flottenrivalität und den Wandel des Deutschlandbildes im späten 19. Jahrhundert.
Das vierte Kapitel untersucht verschiedene Beispiele für britische Invasionsphantasien aus den Jahren 1871 bis 1910. Es werden unterschiedliche Aspekte der Planung, Durchführung und Folgen der Invasionen anhand von Beispielen wie The Riddle of the Sands, Spies of the Kaiser, The Battle of Dorking und When William Came beleuchtet.
Schlüsselwörter
Speculative novel, Invasionsphantasien, Deutschlandbild, Stereotype, Flottenrivalität, Imperialismus, Spionageroman, The Riddle of the Sands, Spies of the Kaiser, The Battle of Dorking, When William Came, England, Deutschland, Erste Weltkrieg.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die 'speculative novel' im Kontext des 19. Jahrhunderts?
Es handelt sich um ein literarisches Genre, das zukünftige politische Konflikte und Kriege vorwegnimmt, um die Bevölkerung vor möglichen Gefahren zu warnen.
Warum waren Invasionsphantasien in England so verbreitet?
Trotz der isolierten Insellage Englands erzeugte die politische Umwälzung in Europa (z.B. die Reichsgründung Deutschlands) eine Angst vor dem Verlust der Souveränität.
Wie wandelte sich das Deutschlandbild in der britischen Literatur?
Das Bild wandelte sich vom "German Cousin" (deutschen Cousin) hin zum gefährlichen "Ränkeschmied" und militärischen Aggressor.
Welche Klassiker des Genres werden in der Arbeit untersucht?
Zentrale Werke sind "The Battle of Dorking", "The Riddle of the Sands" und "When William Came", die verschiedene Phasen einer fiktiven Invasion beschreiben.
Gab es auch deutsche Geschichten über eine Invasion in England?
Ja, es existierten deutsche Pendants, die einen unvermeidlichen Krieg mit England thematisierten, diese sind heute jedoch weitgehend in Vergessenheit geraten.
- Quote paper
- M. A. Andreas Wutz (Author), 2004, Ruled Britannia und Fait Accompli - Mögliche Invasionsszenarien in der britischen 'speculative novel' mit besonderer Berücksichtigung des Deutschlandbildes , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81607