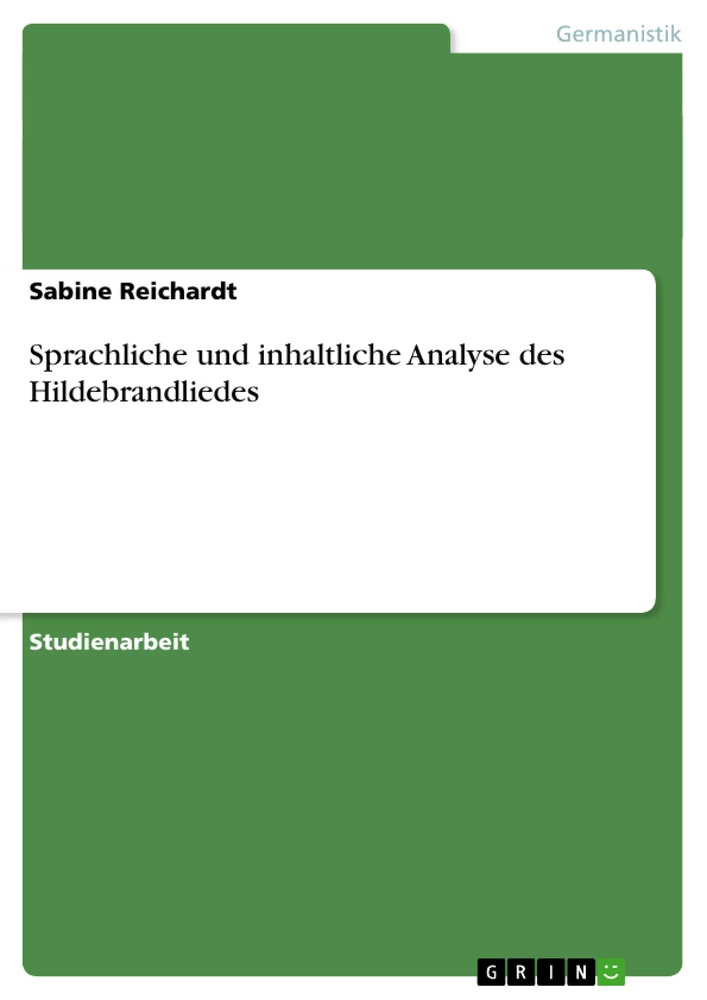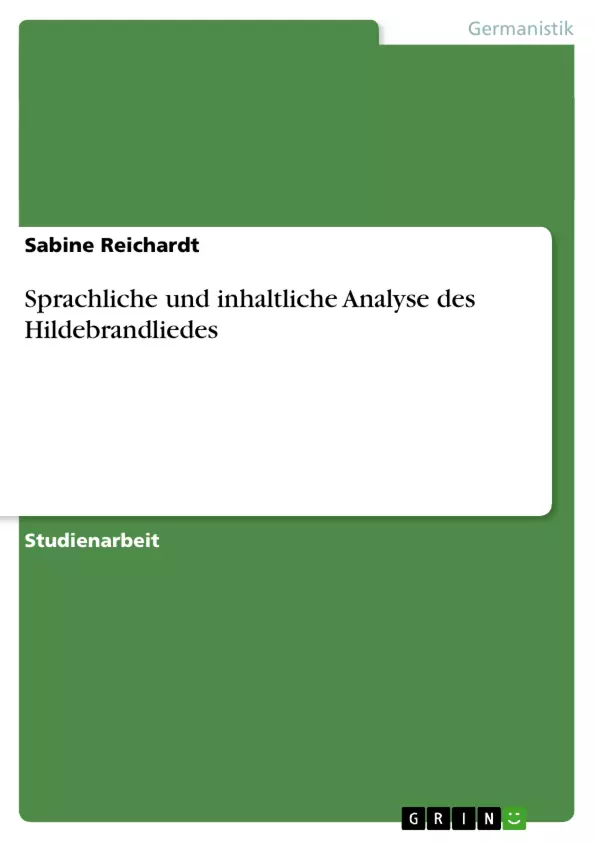Das Hildebrandlied ist das einzige überlieferte Heldenlied seiner Zeit in deutscher Sprache. Das Werk beschreibt eine Episode aus der Sage um Dietrich von Bern. Es ist zudem von besonderem Interesse für jeden Sprachwissenschaftler, da es voller sprachlicher Rätsel steckt und kein vergleichbares Werk in der Literatur bekannt ist. Seine Vermischung von oberdeutsch-bairischen mit niederdeutsch-altsächsischen Formen ist einzigartig. Des Weiteren stellt sich die Frage, warum ein Heldenlied, das doch nur für den mündlichen Vortrag bestimmt ist, aufgezeichnet wurde.
Der erste Teil meiner Hausarbeit soll einen kurzen Überblick über die deutsche Sprachgeschichte und die damit einhergehende Entstehung des Althochdeutschen geben, da das Hildebrandlied die verschiedenen Sprachformen dieser Zeit (9. Jahrhundert) aufweist. Nach der Definition der beiden Begriffe Heldenlied und Stabreim, gehe ich in Kapitel 4 auf die Überlieferung und Entstehung des Hildebrandliedes ein. Dabei sollen neben Informationen über die Handschrift und ihren Entdecker auch Angaben über die vermutliche Entstehungszeit und den Entstehungsort gemacht werden. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem Inhalt des Werkes und einer Erläuterung der Dietrichsage, die dem Heldenlied zugrunde liegt. Im Hauptteil meiner Arbeit (Kapitel 6) geht es um die sprachliche Untersuchung des Hildebrandliedes, die insbesondere aufgrund der vielfältigen Dialektüberschichtungen eine interessante, aber auch schwierige Aufgabe darstellt. Zuletzt folgt ein kurzer Exkurs unter der Fragestellung: Das Hildebrandlied - Nichts weiter als eine Fälschung? In diesem Kapitel werden die Zweifel Süßmanns über die Echtheit der Handschrift des Liedes erläutert. Nach seiner Untersuchung kommt er zu dem Schluss, dass es sich bei der Handschrift um eine Fälschung handelt. Bis zur Durchführung einer naturwissenschaftlichen Untersuchung, wird die Originalität der Handschrift des Hildebrandliedes bezweifelt werden.
Wenn in dieser Arbeit vom Hildebrandlied die Rede ist, handelt es sich ausnahmslos um das ältere Hildebrandlied aus dem 9. Jahrhundert. Zudem wird ein kleines b hinter die Zeilenangabe hinzugefügt, wenn die zitierten Wörter auf dem zweiten Blatt der Handschrift stehen. Als Quelle dient die zeilengenaue Umschrift des Heldenliedes, die auch im Anhang zu finden ist. Der w-Laut wird meist durch die Rune p geschrieben, die in meiner Hausarbeit als p mit Akzent (´p) dargestellt ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Überblick über die deutsche Sprachgeschichte bis zum Althochdeutschen
- 3. Definitionen
- 3.1 Das Heldenlied
- 3.2 Der Stabreim
- 4. Überlieferung und Entstehung des Hildebrandliedes
- 4.1 Entdecker des Heldenliedes
- 4.2 Ort, Zeitpunkt und Überlieferungsform der Dichtung
- 4.3 Informationen über die Handschrift und die Schreiber
- 5. Inhaltliche Aspekte
- 5.1 Inhalt des Werkes
- 5.2 Die Dietrichsage
- 5.3 Orts-, Zeit-, und Namensangaben im Hildebrandlied
- 6. Sprache im Hildebrandlied
- 6.1 Reimschema und Rhythmus
- 6.2 Lautmalerei, Kontraste und Wiederholungen
- 6.3 Dialektüberschichtungen
- 7. Das Hildebrandlied - Nichts weiter als eine Fälschung?
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Hildebrandlied, das einzige erhaltene althochdeutsche Heldenlied. Die Arbeit zielt darauf ab, das Lied sowohl inhaltlich als auch sprachlich zu untersuchen und seine Bedeutung für die deutsche Sprachgeschichte zu beleuchten. Dabei werden die Entstehung, Überlieferung und die sprachlichen Besonderheiten des Werkes im Fokus stehen.
- Sprachliche Entwicklung des Althochdeutschen
- Analyse der literarischen Form des Heldenliedes
- Inhaltliche Einordnung in den Kontext der Dietrichsage
- Untersuchung der sprachlichen Besonderheiten (Dialekte, Reim, Rhythmus)
- Diskussion der Authentizität der Handschrift
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt das Hildebrandlied als einzigartiges Beispiel eines althochdeutschen Heldenliedes, das aufgrund seiner sprachlichen Komplexität und der offenen Frage seiner Entstehung von besonderem Interesse ist. Es wird die Struktur der Arbeit umrissen und die methodischen Vorgehensweisen erläutert.
2. Überblick über die deutsche Sprachgeschichte bis zum Althochdeutschen: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Abriss der Entwicklung der deutschen Sprache vom Indogermanischen bis zum Althochdeutschen. Es beleuchtet die linguistischen Verwandtschaftsverhältnisse des Deutschen mit anderen indogermanischen Sprachen und hebt die Bedeutung dieser Entwicklung für das Verständnis des Hildebrandliedes hervor, welches verschiedene sprachliche Elemente dieser Epoche aufweist.
3. Definitionen: Hier werden die zentralen Begriffe "Heldenlied" und "Stabreim" definiert und erläutert. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die spätere Analyse des Hildebrandliedes, indem sie ein Verständnis der literarischen Gattung und der verwendeten Verstechnik liefern. Es werden die charakteristischen Merkmale der jeweiligen Konzepte im Detail beschrieben.
4. Überlieferung und Entstehung des Hildebrandliedes: Dieses Kapitel befasst sich mit der Überlieferung und Entstehung des Hildebrandliedes. Es beschreibt den Fundort, die vermutete Entstehungszeit und -ort sowie die Besonderheiten der Handschrift und die Informationen über den Schreiber. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte und der Herausforderungen, die sich bei der Interpretation dieser historischen Informationen ergeben. Die Entstehung eines mündlich tradierten Textes in schriftlicher Form wird diskutiert.
5. Inhaltliche Aspekte: Das Kapitel fasst den Inhalt des Hildebrandliedes zusammen und erläutert dessen Einbettung in die Dietrichsage. Es wird auf die zentralen Figuren, Ereignisse und den Handlungsverlauf eingegangen, wobei die Interpretation der verschiedenen Erzählstränge im Mittelpunkt steht. Die Analyse der Handlung, der Charaktere und ihrer Beziehungen zueinander wird in Verbindung mit der literarischen Form des Heldenliedes betrachtet.
6. Sprache im Hildebrandlied: Dieses Kapitel widmet sich der sprachlichen Analyse des Hildebrandliedes. Es untersucht Reimschema, Rhythmus, Lautmalerei, Kontraste, Wiederholungen und Dialektüberschichtungen. Die Analyse beleuchtet die vielfältigen sprachlichen Mittel und ihren Beitrag zum Gesamteindruck des Werkes. Der Einfluss verschiedener Dialekte auf die Sprache des Liedes wird eingehend erörtert.
7. Das Hildebrandlied - Nichts weiter als eine Fälschung?: Das Kapitel diskutiert die von Süßmann geäußerten Zweifel an der Authentizität des Hildebrandliedes. Es wird Süßmanns Argumentation und die darauf folgenden Kontroversen vorgestellt, welche die Frage nach der Echtheit des Textes aufwerfen und wissenschaftliche Methoden zur Klärung heranziehen. Die verschiedenen Perspektiven auf die Urheberschaft und die Datierung werden dargelegt.
Schlüsselwörter
Hildebrandlied, Althochdeutsch, Heldenlied, Stabreim, Dietrichsage, Sprachgeschichte, Dialektüberschichtungen, Handschrift, Authentizität, literarische Analyse, linguistische Analyse.
Hildebrandlied: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist das Hildebrandlied und warum ist es wichtig?
Das Hildebrandlied ist das einzige erhaltene althochdeutsche Heldenlied. Seine Bedeutung liegt in seiner sprachlichen Komplexität und der offenen Frage seiner Entstehung. Es bietet einzigartige Einblicke in die althochdeutsche Sprache und Literatur.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Seminararbeit analysiert das Hildebrandlied sowohl inhaltlich als auch sprachlich und beleuchtet seine Bedeutung für die deutsche Sprachgeschichte. Die Entstehung, Überlieferung und sprachlichen Besonderheiten stehen im Fokus. Weitere Themen sind die Entwicklung des Althochdeutschen, die literarische Form des Heldenliedes, die Einordnung in die Dietrichsage und die Diskussion um die Authentizität der Handschrift.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was wird in ihnen behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Eine Einleitung, ein Überblick über die deutsche Sprachgeschichte bis zum Althochdeutschen, Definitionen von "Heldenlied" und "Stabreim", die Überlieferung und Entstehung des Hildebrandliedes, inhaltliche Aspekte, eine sprachliche Analyse des Liedes, eine Diskussion um die mögliche Fälschung des Liedes und abschließend ein Fazit.
Wie wird das Hildebrandlied in Bezug auf seine Sprache analysiert?
Die sprachliche Analyse umfasst das Reimschema, den Rhythmus, Lautmalerei, Kontraste, Wiederholungen und Dialektüberschichtungen. Der Einfluss verschiedener Dialekte auf die Sprache des Liedes wird eingehend erörtert.
Welche Rolle spielt die Dietrichsage im Kontext des Hildebrandliedes?
Das Hildebrandlied ist in die Dietrichsage eingebettet. Die Arbeit untersucht die Einordnung des Liedes in diesen größeren Kontext und analysiert die relevanten Figuren, Ereignisse und Handlungsstränge.
Wird die Authentizität des Hildebrandliedes in Frage gestellt?
Ja, die Arbeit diskutiert die von Süßmann geäußerten Zweifel an der Authentizität des Hildebrandliedes. Die Argumentation Süßmanns und die darauf folgenden Kontroversen werden vorgestellt, einschließlich der wissenschaftlichen Methoden zur Klärung der Frage nach der Echtheit des Textes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hildebrandlied, Althochdeutsch, Heldenlied, Stabreim, Dietrichsage, Sprachgeschichte, Dialektüberschichtungen, Handschrift, Authentizität, literarische Analyse, linguistische Analyse.
Wo finde ich weitere Informationen zum Hildebrandlied?
(Hier könnten Links zu relevanten Ressourcen hinzugefügt werden.)
- Arbeit zitieren
- Sabine Reichardt (Autor:in), 2006, Sprachliche und inhaltliche Analyse des Hildebrandliedes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81645