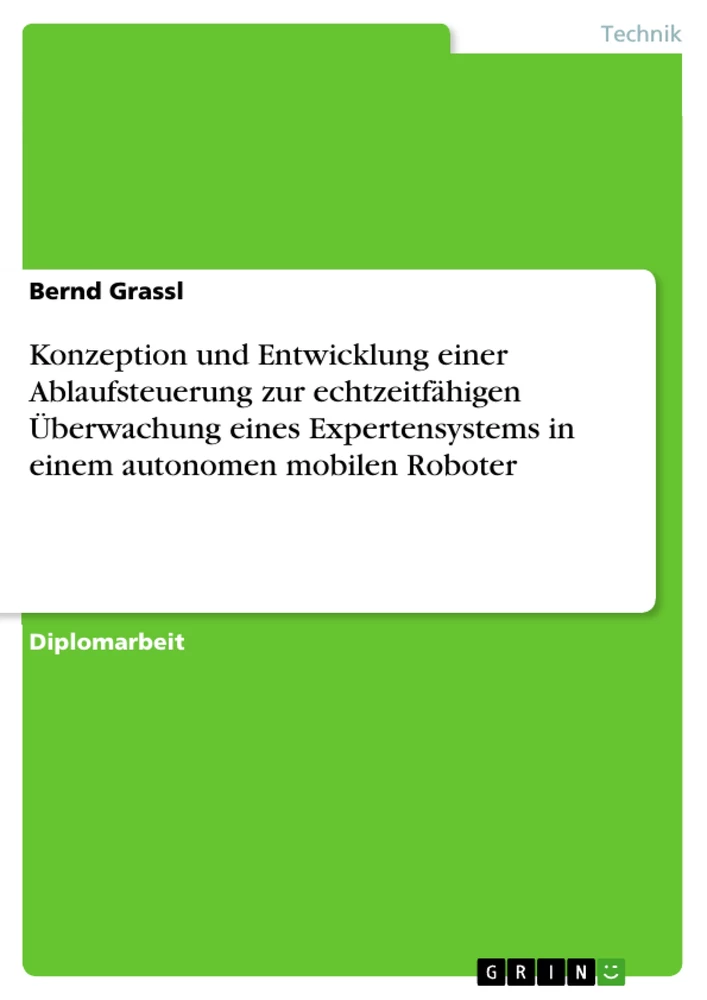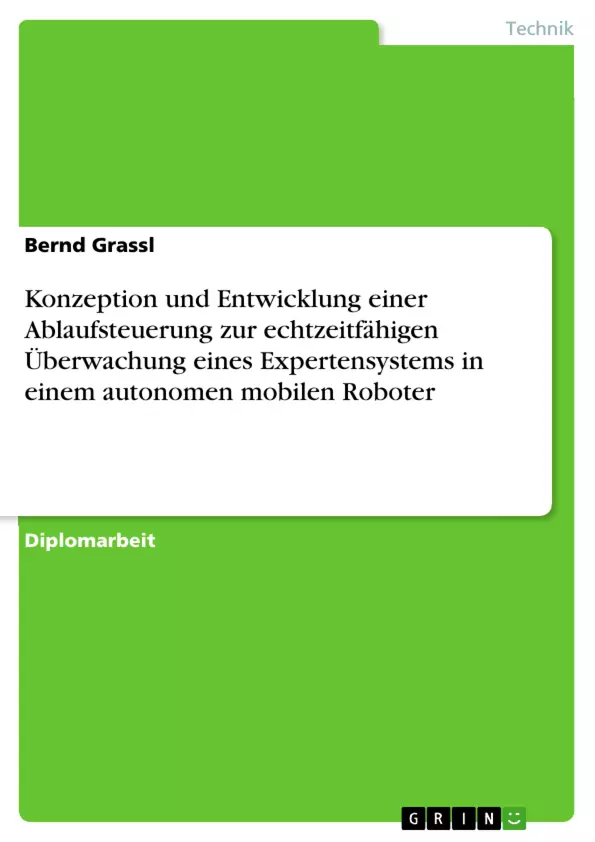Einleitung
1.1 Einführung
Die Marktsituation in der Produktionstechnik erzwingt wegen sinkender Produktzykluszeiten, zunehmender Variantenvielfalt, wachsender Produktkomplexität und Forderungen nach immer kürzer werdenden Lieferzeiten (" Just-in-time") den Einsatz flexibler, automatisierter Produktionseinrichtungen. Ziel der flexiblen Produktion ist eine wirtschaftliche Fertigung von Produkten hoher Qualität bei kleinen Losgrößen.
Deshalb geht in der flexiblen Fertigungsautomatisierung der Trend weg von starr automatisierten Montageanlagen hin zu flexiblen Fertigungs- und Montagezellen.
Dabei versteht man unter einer solchen Zelle eine zeitlich begrenzt autonom arbeitende, rechnergeführte Einheit bestehend aus einer Fertigungsmaschine, einem Handhabungsautomaten (Roboter), Werkstückspeicher und Meßeinrichtungen. Innerhalb der Zelle können auch mehrere Montage - und Handhabungs funktionen von einem Handhabungssystem ausgeführt werden, wenn der Transport dieses Systems und der Materialfluß in der Fertigungszelle automatisiert ist. Die informationstechnische Kopplung der einzelnen Bestandteile einer Zelle erfolgt über einen zentralen Leitrechner. Der Schwerpunkt dieser automatisierungstechnischen Entwicklung ist zur Zeit die Einführung rechnerintegrierter, autonomer Produktionssysteme. Die Betonung liegt hierbei auf "autonom", da man durch eine Autonomie der Systeme eine möglichst hohe Verfügbarkeit der teuren Fertigungseinrichtungen erreichen will. Flexible Fertigungszellen stellen hochkomplexe Systeme dar und besitzen dadurch zwangsläufig eine große Fehleranfälligkeit, was häufig zu Totalausfällen führen kann. Um die Verfügbarkeit und dadurch die Produktivität dieser Einrichtungen zu erhöhen, werden zunehmend autonome Systeme eingesetzt, die zum Erreichen dieser Ziele
bestimmte Merkmale aufweisen. Als erstes ist die Fähigkeit zur zeitlich begrenzten Aufgabenausführung ohne menschliche Eingriffe zu nennen. Ein weiteres Merkmal ist die Aufgabenausführung in einer veränderlichen bzw. gestörten Umgebung, was durch selbständige Anpassung an die Umwelt erreicht wird. Schließlich ist noch die
selbständige Auswertung aufgabenorientierter Zielvorgaben anzuführen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einführung
- 1.2 Ausgangssituation
- 1.3 Aufgabenstellung
- 1.4 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise
- 2 Stand der Forschung im Bereich wissensbasierter Systeme
- 2.1 Grundlagen wissensbasierter Systeme / Expertensysteme
- 2.1.1 Komponenten eines Expertensystems
- 2.1.2 Verschiedene Arten und Einsatzgebiete von Expertensystemen
- 2.2 Wissensbasierte Diagnose und Fehlerbehandlung
- 2.2.1 Begriffe und Grundlagen
- 2.2.2 Dialogorientierte Diagnose-Expertensysteme
- 2.2.3 Diagnose-Expertensysteme mit Prozeßankopplung
- 2.2.4 Bewertung der betrachteten Systeme
- 2.3 Kritische Betrachtung der Expertensystemtechnologie
- 2.3.1 Vorteile und Nutzen von Expertensystemen
- 2.3.2 Nachteile, Schwachstellen und Grenzen von Expertensystemen
- 2.4 Eine "intelligente" Roboter-Steuerung
- 3 Konzeption einer Ablaufsteuerung für die Auftragsbearbeitung
- 3.1 Strukturierung der Auftragsausführung
- 3.1.1 Gründe für die Verwendung einer speziellen Ablaufsteuerung
- 3.1.2 Aufgaben der Ablaufsteuerung
- 3.1.3 Aufbau der Ausführungssteuerung
- 3.2 Ablaufkonzept der Elementarauftragsbearbeitung
- 3.2.1 Strukturierung von Regelmengen
- 3.2.2 Ablauf einer Auftragsbearbeitung im regelbasiertem System
- 3.2.3 Funktionsweise der Ablaufsteuerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Konzeption und Entwicklung einer Ablaufsteuerung für ein Expertensystem, das in einem autonomen mobilen Roboter eingesetzt werden soll. Ziel ist es, ein System zu schaffen, das die Echtzeitfähigkeit des Expertensystems sicherstellt und die effektive Überwachung der Auftragsbearbeitung ermöglicht.
- Echtzeitfähige Überwachung eines Expertensystems in einem autonomen mobilen Roboter
- Entwicklung einer Ablaufsteuerung für die effiziente Auftragsbearbeitung
- Integration von wissensbasierten Systemen in die Steuerung eines Roboters
- Analyse des Standes der Forschung im Bereich wissensbasierter Systeme
- Bewertung der Vorteile und Grenzen von Expertensystemen im Kontext der Robotertechnik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und erläutert die Ausgangssituation, die Aufgabenstellung sowie den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 präsentiert den Stand der Forschung im Bereich wissensbasierter Systeme und beleuchtet die Grundlagen von Expertensystemen, die verschiedenen Arten und Einsatzgebiete sowie die kritische Betrachtung der Technologie. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Diagnose und Fehlerbehandlung. Kapitel 3 widmet sich der Konzeption einer Ablaufsteuerung für die Auftragsbearbeitung. Es werden die Gründe für die Verwendung einer speziellen Ablaufsteuerung, die Aufgaben der Steuerung sowie der Aufbau der Ausführungssteuerung näher beleuchtet. Des Weiteren werden das Ablaufkonzept der Elementarauftragsbearbeitung sowie die Funktionsweise der Ablaufsteuerung im Detail beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Echtzeitfähigkeit, Expertensysteme, autonome mobile Roboter, Ablaufsteuerung, Auftragsbearbeitung, Wissensbasierte Systeme, Diagnose und Fehlerbehandlung. Die Arbeit untersucht die Integration von wissensbasierten Systemen in die Steuerung eines Roboters und bewertet die Vorteile und Grenzen von Expertensystemen in diesem Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Expertensystem in der Robotik?
Ein wissensbasiertes System, das menschliches Expertenwissen nutzt, um komplexe Aufgaben wie Fehlerdiagnosen autonom zu lösen.
Warum ist Echtzeitfähigkeit bei autonomen Robotern wichtig?
Roboter müssen in veränderlichen Umgebungen sofort auf Störungen reagieren können, um Kollisionen zu vermeiden und Aufgaben sicher auszuführen.
Was leistet eine Ablaufsteuerung für Aufträge?
Sie strukturiert die Ausführung von Elementaraufträgen und überwacht die Einhaltung von Regeln innerhalb des Systems.
Was sind die Vorteile von Expertensystemen?
Sie erhöhen die Verfügbarkeit von Anlagen und ermöglichen eine Aufgabenausführung ohne menschliche Eingriffe.
Wie funktioniert die Fehlerbehandlung in diesen Systemen?
Durch eine direkte Prozessankopplung erkennt das System Abweichungen und leitet selbstständig Korrekturmaßnahmen ein.
- Arbeit zitieren
- Bernd Grassl (Autor:in), 1995, Konzeption und Entwicklung einer Ablaufsteuerung zur echtzeitfähigen Überwachung eines Expertensystems in einem autonomen mobilen Roboter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/820