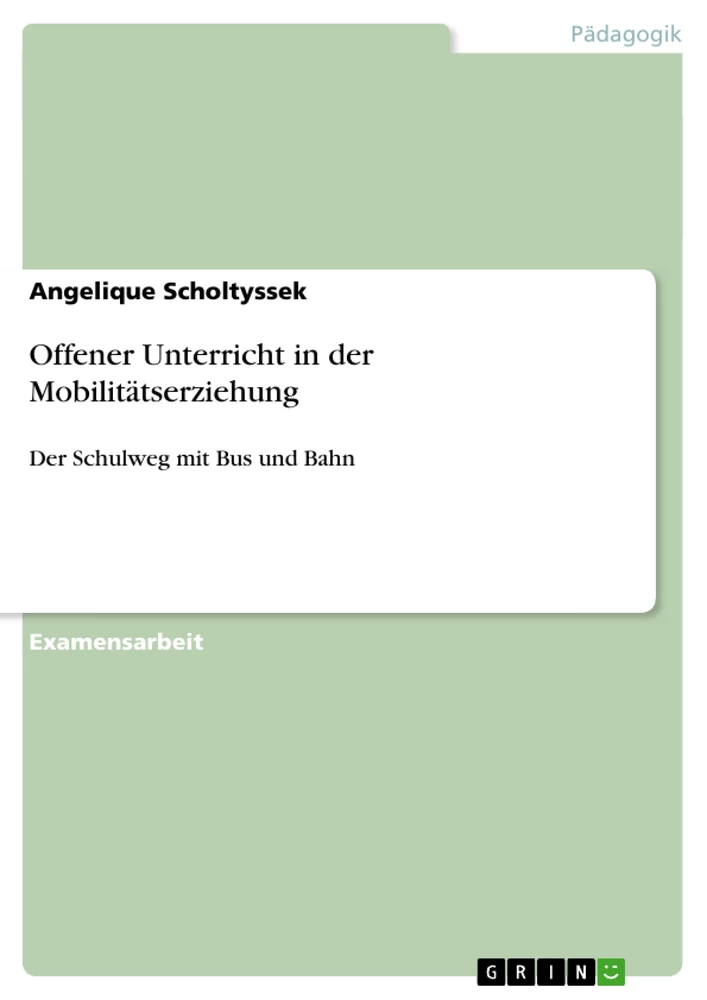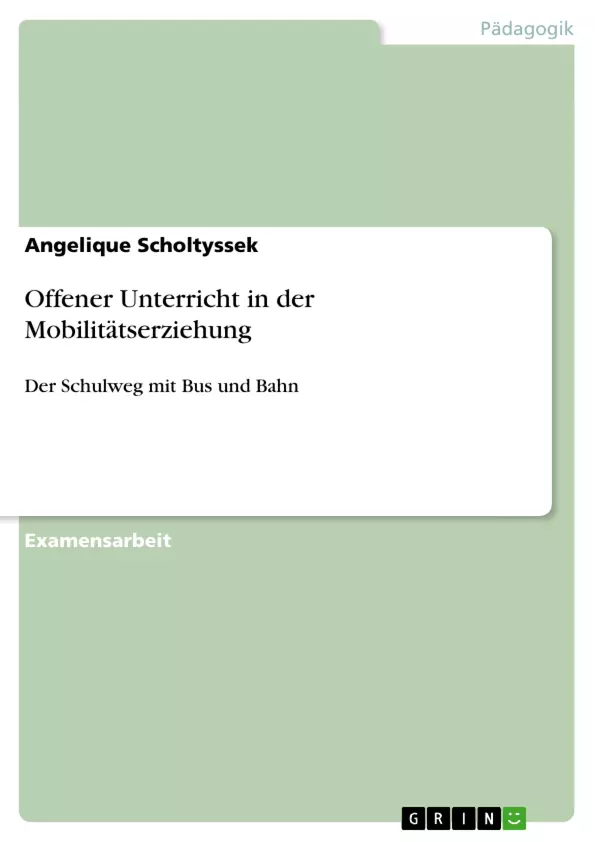Die starke Zunahme des Straßenverkehrs, die Verdichtung der städtischen Ballungsgebiete sowie der Rückgang der Geburtenrate haben dazu geführt, dass die Kinder heutzutage unter anderen Lebens- und Entwicklungsbedingungen aufwachsen als noch vor einem halben Jahrhundert.
Vor allem die zunehmende Vereinsamung und Verhäuslichung, welche als Konsequenz auf den drastischen Rückgang der Geburtenrate zurückzuführen ist, hat dazu beigetragen, dass sich die Lebensverhältnisse der Kinder gewandelt haben. Es gibt immer weniger kinderreiche Familien.
Des Weiteren sind Veränderungen der Familienstrukturen zu vermerken. So ist eine zunehmende Pluralisierung der Lebenswelten in der Gesellschaft erkennbar. Es gibt immer weniger traditionelle Familien, stattdessen mehr Einelternfamilien, nichteheliche Lebensgemeinschaften oder Patchwork-Familien. Dies hat zur Folge, dass die Kinder nach unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen erzogen werden.
Die Medialisierung hat einen sehr großen Einfluss auf die Kindheit. Die Kinder wachsen in einer Gesellschaft auf, in der zum Beispiel der Computer oder das Fernsehen zum alltäglichen Leben gehören. Daraus folgt ein vermehrter Einzug dieser Medien in die Freizeitgestaltung der Kinder.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Theoretischer Teil
- 2. Offener Unterricht
- 2.1 Charakteristika von Offenem Unterricht
- 2.2 Entstehungsgeschichte des Offenen Unterrichts
- 2.3 Begründung des Offenen Unterrichts
- 2.4 Ziele des Offenen Unterrichts
- 2.5 Rahmenbedingungen des Offenen Unterrichts
- 2.6 Formen des Offenen Unterrichts
- 2.6.1 Projektunterricht
- 2.6.2 Wochenplanarbeit
- 2.6.3 Freiarbeit
- 2.6.4 Werkstattunterricht
- 2.6.5 Stationenlernen
- 3. Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule
- 3.1 Die historische Entwicklung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung
- 3.2 Die Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972
- 3.3 Die Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom 17.06.1994
- 3.4 Aufgaben und Ziele der Verkehrs- und Mobilitätserziehung
- 3.4.1 Sicherheitserziehung
- 3.4.2 Sozialerziehung
- 3.4.3 Umwelterziehung
- 3.4.4 Gesundheitserziehung
- 3.5 Inhalte, Methoden und Umfang in der Grundschule
- 3.6 Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Institutionen
- 3.7 Mobilitätserziehung in den Richtlinien
- 4. Der Schulweg
- 4.1 Veränderte Kindheit im Straßenverkehr
- 4.2 Kinder als Verkehrsteilnehmer
- 4.3 Straßenverkehrsunfälle im Kindesalter
- 4.4.1 Schulwegunfallgeschehen
- 4.4.2 Schulbusunfallgeschehen
- 4.4 Ursachen für Verkehrsunfälle im Kindesalter
- 4.5 Unfallpräventionen
- Praktischer Teil
- 5. Die EVAG als Beispiel für die Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Institutionen
- 5.1 Das pädagogische Konzept – „EVAG macht Schule“
- 5.2 Betriebsführung
- 5.3 Mobilitätserziehung und -beratung
- 5.4 EVAG macht Theater
- 5.5 Haltestellenpatenschaften
- 5.6 Unterrichtsmaterialien
- 6. Das Bus- und Bahntraining an der Alfriedschule
- 6.1 Schule und Umgebung
- 6.2 Klassensituation
- 6.3 Planung der Unterrichtsstunde
- 6.4 Ablauf des Bus- und Bahntrainings
- 6.4.1 Theoretische Stunde
- 6.4.2 Praktische Übungen auf dem Betriebshof
- 6.4.3 Die Rallye
- 6.4.4 Das Quiz
- 6.5 Unterrichtsvorschläge zum Thema Bus und Bahn
- 7. Schlusswort
- Charakteristika und Formen des Offenen Unterrichts
- Die historische Entwicklung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung
- Ziele und Inhalte der Verkehrserziehung in der Grundschule
- Der Schulweg als Lernort
- Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Institutionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema "Offener Unterricht in der Mobilitätserziehung". Ziel ist es, den offenen Unterricht im Kontext der Verkehrs- und Mobilitätserziehung an der Grundschule zu beleuchten, insbesondere mit Bezug auf den Schulweg mit Bus und Bahn.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema "Offener Unterricht in der Mobilitätserziehung" ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der heutigen Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern heraus. Der theoretische Teil beleuchtet zunächst die Charakteristika und Formen des Offenen Unterrichts. Anschließend wird die historische Entwicklung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule dargestellt, wobei auf die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz eingegangen wird. Weiterhin werden die Ziele und Inhalte der Verkehrserziehung sowie die Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Institutionen beleuchtet.
Der Kapitel über den Schulweg behandelt die veränderte Kindheit im Straßenverkehr, die Bedeutung des Schulwegs als Lernort sowie die Problematik von Straßenverkehrsunfällen im Kindesalter. Der praktische Teil fokussiert auf die EVAG als Beispiel für die Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Institutionen im Bereich der Mobilitätserziehung. Darüber hinaus wird das Bus- und Bahntraining an der Alfriedschule detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Offener Unterricht, Mobilitätserziehung, Verkehrserziehung, Grundschule, Schulweg, Bus und Bahn, EVAG, außerschulische Institutionen, Unfallprävention.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Offener Unterricht" in der Mobilitätserziehung?
Es handelt sich um Unterrichtsformen wie Freiarbeit oder Stationenlernen, die Schülern ermöglichen, Verkehrsregeln und sicheres Verhalten selbstständig und praxisnah zu erlernen.
Welche Ziele verfolgt die moderne Mobilitätserziehung?
Die Ziele umfassen Sicherheitserziehung, Sozialerziehung (Rücksichtnahme), Umwelterziehung und Gesundheitserziehung.
Welche Rolle spielt die EVAG in dieser Arbeit?
Die EVAG dient als Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Verkehrsbetrieben, etwa durch das Projekt „EVAG macht Schule“ oder Bus- und Bahntrainings.
Warum hat sich die Kindheit im Straßenverkehr verändert?
Zunehmende Verkehrsverdichtung, Medialisierung und veränderte Familienstrukturen führen zu einer "Verhäuslichung" und weniger natürlichem Freiraum für Kinder.
Was ist eine Haltestellenpatenschaft?
Es ist eine Form des bürgerschaftlichen Engagements, bei der Schulen oder Gruppen Verantwortung für die Sauberkeit und Sicherheit einer Haltestelle übernehmen.
- Quote paper
- Angelique Scholtyssek (Author), 2007, Offener Unterricht in der Mobilitätserziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82045