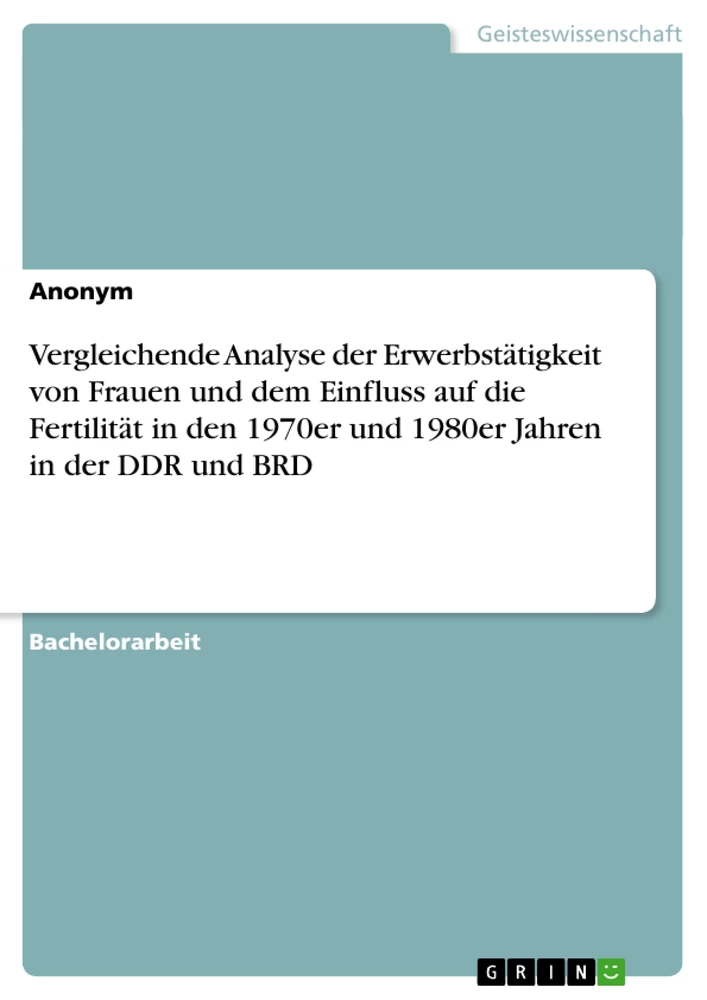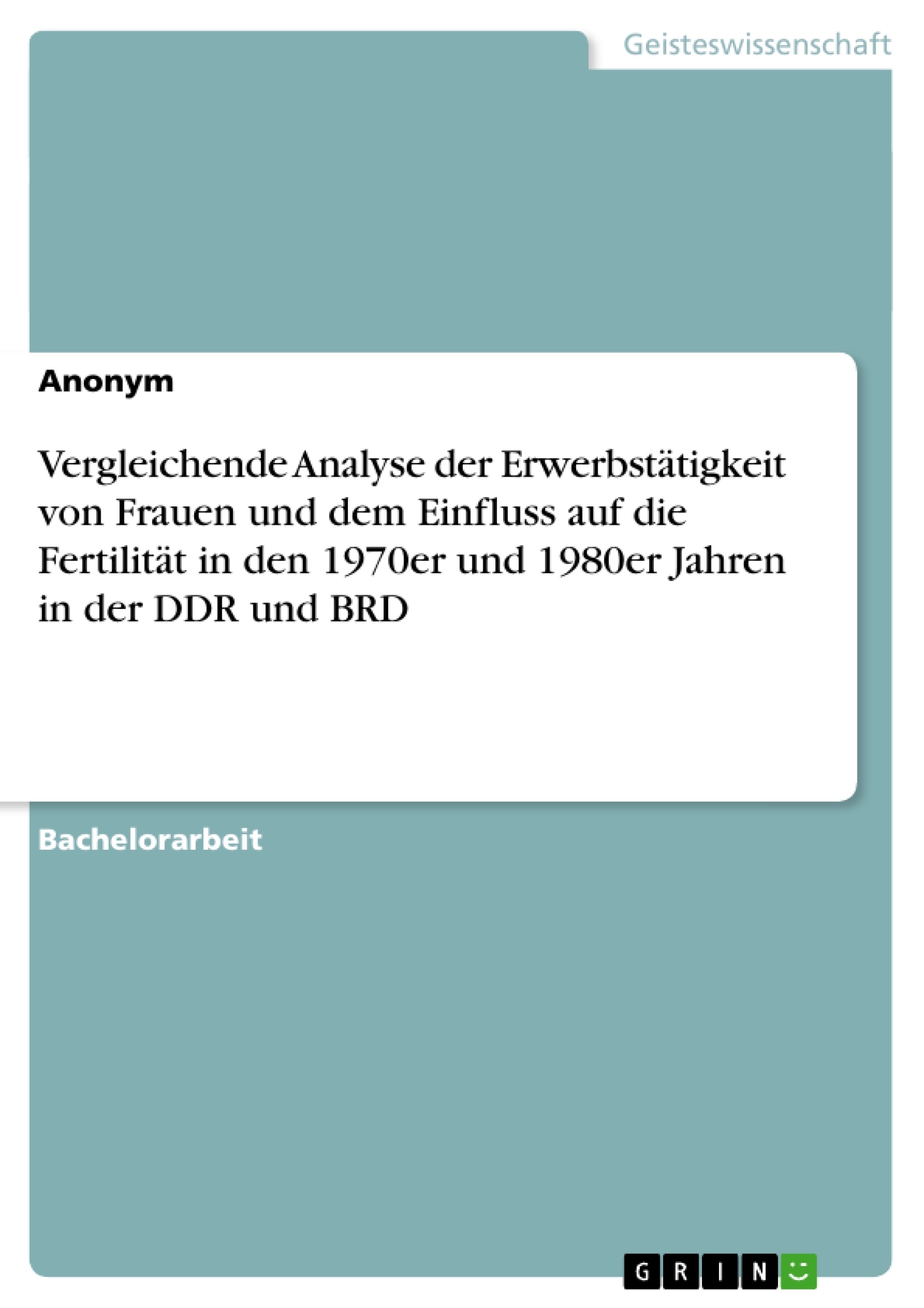Die vorliegende Arbeit ist darauf ausgerichtet, darzustellen, wie sich die Frauenerwerbstätigkeit auf die Fertilität in der alten Bundesrepublik (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) in den 1970er und 1980er Jahren ausgewirkt hat. Dabei muss jedoch immer beachtet werden, dass sowohl die Erwerbstätigkeit als auch die Fertilität nicht ohne die Einbeziehung anderer Faktoren betrachtet werden können, sondern nur im Kontext der in einer Gesellschaft bestehenden Vorstellungen darüber wie unter anderem die Familie, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die staatlichen Rahmenbedingungen miteinander in Verbindung stehen und so die Lebensbedingungen von Individuen beeinflussen. Die Idee zur Bearbeitung dieses Themas ist unter anderem im Zusammenhang mit einem aktuellen Kinofilm entstanden, wodurch die Problematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch aktuelle Bezüge erhält. „Das Streben nach Glück“ stellt auf eindrucksvolle Weise dar, mit welchen Schwierigkeiten Eltern bei der Vereinbarung von beruflicher Karriere und der Kinderbetreuung konfrontiert werden. Es wird deutlich, dass nicht nur Konflikte durch die Ausübung einer Berufstätigkeit entstehen, sondern auch die partnerschaftliche Beziehung unter dem Spannungsverhältnis von Familie und Beruf leidet. Der hier genannte Film spielt in den 1980er Jahren in San Francisco. Beide Partner sind berufstätig und haben einen gemeinsamen Sohn, den sie aus finanziellen Gründen tagsüber zu einer privaten Pflegemutter geben, die jedoch nicht einmal die Landessprache beherrscht. Um die Lebensbedingungen zu verbessern, beginnt der Vater eine Ausbildung, bei welcher er jedoch nicht entlohnt wird. Die Spannungsverhältnisse zwischen den Partnern unter der finanziellen Belastung und dem Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden schließlich so groß, dass die Frau ihre Familie verlässt. Der Vater hat nun eine noch größere Bürde zu tragen, da er nun für die Vereinbarkeit beider Lebensbereiche mit zusätzlichen finanziellen Problemen allein zuständig ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1. Soziologische Theorie sozialpolitischer Intervention
- 2.2. Theorie der kulturellen Leitbilder
- 2.2.1. Grundlegende Kategorien: Geschlechter - Arrangement, Geschlechterkultur und Geschlechterordnung
- 2.2.2. Institutionen und Handlungsfelder der Geschlechterordnung
- 2.2.3. Geschlechterkulturelle Modelle als Grundlage für die Klassifizierung von Geschlechter - Arrangements
- 2.3. Zusammenfassung
- 3. Methodische Probleme beim Ost – West – Vergleich
- 4. Politische Rahmenbedingungen beider deutscher Staaten
- 4.1. Familienpolitische- und Frauenpolitische Leitbilder der DDR und BRD
- 4.1.1. BRD
- 4.1.2. DDR
- 4.2. Familienpolitische Maßnahmen
- 4.2.1. BRD
- 4.2.2. DDR
- 4.3. Umsetzung der Leitbilder und Zielvorstellungen in der Realität
- 4.3.1. Demographische Entwicklungen beider deutscher Staaten
- 4.3.2. Zusammenfassung
- 5. Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit
- 5.1. Arbeitsmarkt
- 5.1.1. Art der Beschäftigung
- 5.1.2. Entlohnung
- 5.2. Erwerbsverhalten von Männern und Frauen
- 5.3. Weibliche Erwerbsbiographien
- 5.4. Motivation der Frauen
- 6. Zusammenhang zwischen sozialpolitischen Interventionen und kulturellen Leitbildern in DDR und BRD in Bezug auf die Frauenerwerbstätigkeit und die Fertilität
- 6.1. Zusammenführung der theoretischen Ansätze
- 6.2. Übertragung der theoretischen Ansätze auf das Verhältnis von Frauenerwerbstätigkeit und Fertilität in der DDR und BRD
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Frauenerwerbstätigkeit auf die Fertilität in der BRD und DDR der 1970er und 1980er Jahre. Sie geht dabei über einen einfachen Nachweis eines möglichen negativen Zusammenhangs hinaus und analysiert die sozioökonomischen und politischen Faktoren, die sowohl die Erwerbstätigkeit von Frauen als auch die Geburtenrate beeinflussen.
- Der Einfluss staatlicher Familien- und Frauenpolitik auf die Erwerbstätigkeit und Fertilität
- Die Rolle kultureller Leitbilder und Geschlechterrollen in beiden deutschen Staaten
- Vergleichende Analyse der Arbeitsmarktbedingungen für Frauen in Ost und West
- Die Motivation von Frauen hinsichtlich Beruf und Familie
- Zusammenhang zwischen soziopolitischen Interventionen und kulturellen Leitbildern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Forschungsfokus auf den Zusammenhang zwischen Frauenerwerbstätigkeit und Fertilität in der BRD und DDR der 1970er und 80er Jahre. Sie betont die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit, verschiedene Faktoren wie Familienstrukturen, Geschlechterrollen und staatliche Interventionen zu berücksichtigen. Ein aktueller Film dient als Beispiel für die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, welche die Relevanz des Themas unterstreicht. Die Arbeit zielt nicht auf den Nachweis eines negativen Zusammenhangs ab, sondern auf die Analyse der Einflussfaktoren.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel präsentiert die soziologischen Theorien, die als Grundlage für die Analyse dienen. Es werden soziologische Theorien sozialpolitischer Interventionen und Theorien kultureller Leitbilder erläutert, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Normen, staatlichen Maßnahmen und individuellen Entscheidungen zu verstehen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Konzepten Geschlechter-Arrangement, Geschlechterkultur und Geschlechterordnung gewidmet und deren Einfluss auf die Erwerbstätigkeit und Fertilität von Frauen untersucht.
3. Methodische Probleme beim Ost – West – Vergleich: Kapitel 3 beleuchtet die methodischen Herausforderungen, die bei einem Vergleich der BRD und DDR auftreten. Hier werden potentielle Schwierigkeiten und methodische Grenzen des Vergleichs zwischen den zwei deutschen Staaten im Kontext der Forschung angesprochen.
4. Politische Rahmenbedingungen beider deutscher Staaten: Dieses Kapitel untersucht die familien- und frauenpolitischen Leitbilder und Maßnahmen in beiden deutschen Staaten. Es analysiert die unterschiedlichen politischen Ansätze und ihre Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Frauen, inklusive der demografischen Entwicklungen wie Geburtenraten, Heirats- und Scheidungsraten. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der politischen Strategien und ihrer jeweiligen Erfolge oder Misserfolge in Bezug auf die angestrebten Ziele.
5. Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit: Kapitel 5 analysiert die Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit von Frauen in der BRD und DDR. Es betrachtet den Arbeitsmarkt, die Arten der Beschäftigung, die Entlohnung und das Erwerbsverhalten von Frauen, einschliesslich deren Erwerbsbiographien und Motivationen. Der Vergleich zwischen Ost und West und zwischen den Geschlechtern soll Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigen.
6. Zusammenhang zwischen sozialpolitischen Interventionen und kulturellen Leitbildern in DDR und BRD in Bezug auf die Frauenerwerbstätigkeit und die Fertilität: Das Kapitel synthetisiert die theoretischen Ansätze und überträgt sie auf das Verhältnis von Frauenerwerbstätigkeit und Fertilität in beiden deutschen Staaten. Es analysiert, wie die politischen und kulturellen Rahmenbedingungen die Entscheidungen von Frauen in Bezug auf Beruf und Kinder beeinflussen und wie sich diese Faktoren gegenseitig bedingen.
Schlüsselwörter
Frauenerwerbstätigkeit, Fertilität, DDR, BRD, 1970er Jahre, 1980er Jahre, Familienpolitik, Frauenpolitik, Geschlechterrollen, kulturelle Leitbilder, soziologische Theorien, Ost-West-Vergleich, Arbeitsmarkt, Demografie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss der Frauenerwerbstätigkeit auf die Fertilität in der BRD und DDR der 1970er und 1980er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Frauenerwerbstätigkeit auf die Fertilität in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) während der 1970er und 1980er Jahre. Sie geht über die bloße Feststellung eines möglichen negativen Zusammenhangs hinaus und analysiert die sozioökonomischen und politischen Faktoren, die sowohl die Erwerbstätigkeit von Frauen als auch die Geburtenrate beeinflussen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf soziologische Theorien sozialpolitischer Interventionen und Theorien kultureller Leitbilder. Konzepte wie Geschlechter-Arrangement, Geschlechterkultur und Geschlechterordnung spielen eine zentrale Rolle im Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Normen, staatlichen Maßnahmen und individuellen Entscheidungen.
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Kapitel 3 widmet sich den methodischen Problemen beim Ost-West-Vergleich. Es werden potentielle Schwierigkeiten und methodische Grenzen eines Vergleichs zwischen BRD und DDR im Kontext der Forschungsfrage thematisiert.
Wie werden die politischen Rahmenbedingungen in BRD und DDR dargestellt?
Die Arbeit analysiert die familien- und frauenpolitischen Leitbilder und Maßnahmen in beiden deutschen Staaten. Es werden die unterschiedlichen politischen Ansätze und ihre Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Frauen, einschließlich demografischer Entwicklungen wie Geburtenraten, Heirats- und Scheidungsraten, verglichen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der politischen Strategien und ihrer jeweiligen Erfolge oder Misserfolge.
Welche Aspekte der Erwerbstätigkeit werden untersucht?
Kapitel 5 analysiert die Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit von Frauen in der BRD und DDR. Es werden der Arbeitsmarkt, die Arten der Beschäftigung, die Entlohnung, das Erwerbsverhalten von Frauen, inklusive deren Erwerbsbiographien und Motivationen, untersucht. Der Vergleich zwischen Ost und West und zwischen den Geschlechtern soll Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigen.
Wie werden soziopolitische Interventionen und kulturelle Leitbilder miteinander verknüpft?
Das Kapitel 6 synthetisiert die theoretischen Ansätze und überträgt sie auf das Verhältnis von Frauenerwerbstätigkeit und Fertilität in beiden deutschen Staaten. Es analysiert, wie politische und kulturelle Rahmenbedingungen die Entscheidungen von Frauen in Bezug auf Beruf und Kinder beeinflussen und wie sich diese Faktoren gegenseitig bedingen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenerwerbstätigkeit, Fertilität, DDR, BRD, 1970er Jahre, 1980er Jahre, Familienpolitik, Frauenpolitik, Geschlechterrollen, kulturelle Leitbilder, soziologische Theorien, Ost-West-Vergleich, Arbeitsmarkt, Demografie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretischer Rahmen, Methodische Probleme beim Ost-West-Vergleich, Politische Rahmenbedingungen beider deutscher Staaten, Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit, Zusammenhang zwischen sozialpolitischen Interventionen und kulturellen Leitbildern, Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel beinhaltet spezifische Unterkapitel, die im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt sind.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant beschreibt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss staatlicher Familien- und Frauenpolitik auf die Erwerbstätigkeit und Fertilität, die Rolle kultureller Leitbilder und Geschlechterrollen, die Arbeitsmarktbedingungen für Frauen in Ost und West, die Motivation von Frauen hinsichtlich Beruf und Familie sowie den Zusammenhang zwischen soziopolitischen Interventionen und kulturellen Leitbildern.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2007, Vergleichende Analyse der Erwerbstätigkeit von Frauen und dem Einfluss auf die Fertilität in den 1970er und 1980er Jahren in der DDR und BRD, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82141