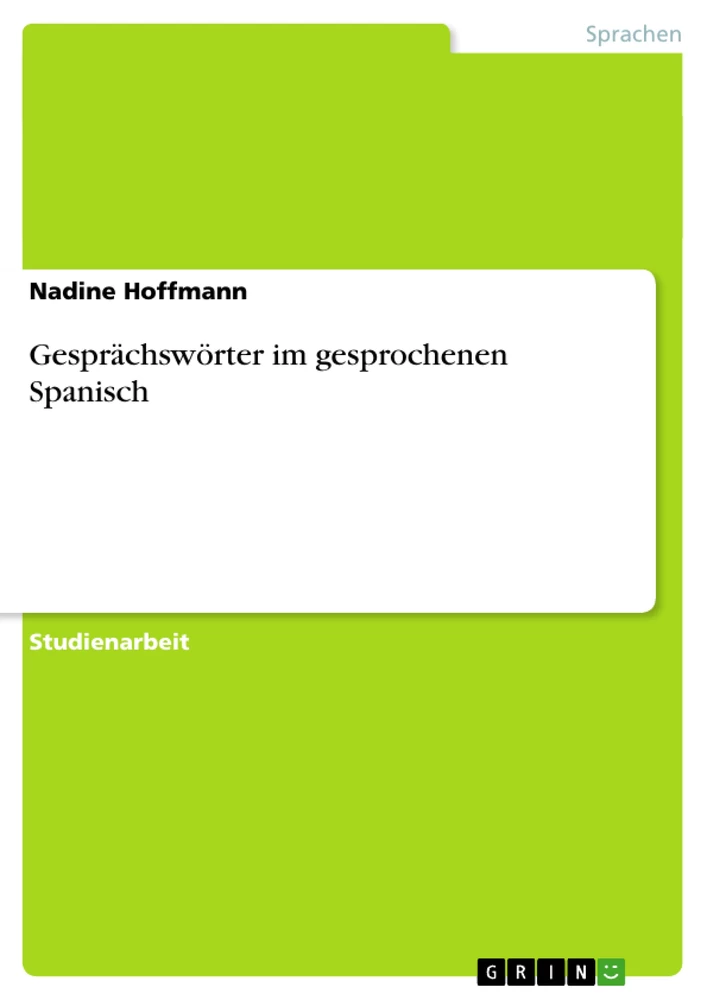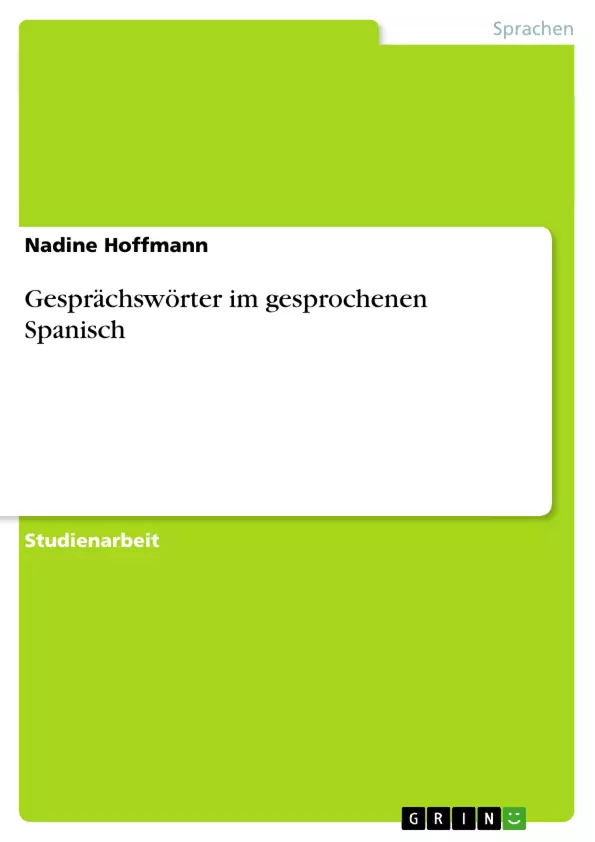"Ich mische unartikulierte Töne ein, ziehe die Verbindungswörter in die Länge, gebrauche auch wohl eine Apposition, wo sie nicht nötig wäre, und bediene mich anderer, die Rede ausdehnender, Kunstgriffe, zur Fabrikation meiner Idee auf der Werkstätte der Vernunft, die gehörige Zeit zu gewinnen.“ stellt Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz (1805) fest. Diesen sprachlichen Phänomenen des gesprochenen Wortes, auf die Kleist in seinem Lobpreis auf die gesprochene Sprache als „Denkhilfe“ aufmerksam wird, ist vorliegende Arbeit gewidmet, genauer den „Gesprächswörtern und äquivalenten Verfahren“1, wie sie Koch/Oesterreicher klassifizieren.
ach einem Überblick über die bisherigen Forschungen zum Thema wird – ausgehend von der K/Oe’schen Definition und Einteilung - zu zeigen sein, inwiefern die Gesprächswörter den spezifisch sprechsprachlichen Bedingungen entspringen. Daraufhin wird kurz der Umgang anderer Autoren mit dieser Erscheinung der gesprochenen Sprache vergleichend betrachtet und abschließend die theoretischen Ergebnisse am konkreten sprachlichen Material eines spanischen Beispiel-Corpus untersucht werden. Zu dem Zweck habe ich aus dem unserem Seminar zugrundeliegenden Corpus5 die ersten Seiten (S. 365-367, Z. 45) herangezogen, da in ihnen sowohl dialogische als auch erzählende Passagen enthalten sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Überblick über die bisherigen Forschungsansätze
- III. Die Kategorien der Gesprächswörter und äquivalenten Verfahren nach Koch/Oesterreicher
- 1. Definition und Einordnung in den textuell-pragmatischen Bereich
- 2. Gliederungssignale
- 3. turn-taking-Signale
- 4. Kontaktsignale (Sprecher- und Hörersignale)
- 5. Überbrückungsphänomene (hesitation phenomena)
- 6. Korrektursignale
- 7. Interjektionen
- 8. Abtönungsphänomene
- 9. Zur Gesamtproblematik der Gesprächswörter im Sinne von Koch/Oesterreicher
- IV. Der Ansatz von Söll/Hausmann und Gülich
- V. Untersuchung der Theorie an einem spanischen Beispiel-Corpus
- VI. Fazit
- VII. Anhang
- VIII. Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gesprächswörter und äquivalenten Verfahren im gesprochenen Spanisch, basierend auf der Klassifizierung von Koch/Oesterreicher. Ziel ist es, die spezifisch sprechsprachlichen Bedingungen aufzuzeigen, die zur Entstehung dieser Wörter führen. Die Arbeit vergleicht verschiedene Forschungsansätze und analysiert ein spanisches Beispiel-Corpus, um die theoretischen Ergebnisse zu überprüfen.
- Klassifizierung und Definition von Gesprächswörtern nach Koch/Oesterreicher
- Vergleichende Betrachtung verschiedener Forschungsansätze zur gesprochenen Sprache
- Analyse der Gesprächswörter im Kontext von kommunikativer Nähe und Distanz
- Untersuchung eines spanischen Beispiel-Corpus
- Bedeutung der gesprochenen Sprache im Vergleich zur geschriebenen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gesprächswörter im gesprochenen Spanisch ein und bezieht sich auf Heinrich von Kleists Aufsatz „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“. Sie definiert den Begriff „Gesprächswörter“ und erläutert den Ansatz von Koch/Oesterreicher, der kommunikative Nähe und Distanz als wichtige Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Einleitung umreißt den Aufbau der Arbeit und die Methodik der Untersuchung.
II. Überblick über die bisherigen Forschungsansätze: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Erforschung der gesprochenen Sprache, von der Antike bis zu modernen psycholinguistischen, soziolinguistischen und textlinguistischen Ansätzen. Es hebt die Bedeutung des Werks von Ludwig Söll „Gesprochenes und geschriebenes Französisch“ hervor und diskutiert die Entwicklung der Forschung, insbesondere im Hinblick auf die romanistischen Sprachen, mit besonderem Fokus auf die Unterschiede zwischen Französisch und Spanisch bezüglich der Forschung zu diesem Thema.
III. Die Kategorien der Gesprächswörter und äquivalenten Verfahren nach Koch/Oesterreicher: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Kategorien der Gesprächswörter und äquivalenten Verfahren nach Koch/Oesterreicher. Es definiert und ordnet diese in den textuell-pragmatischen Bereich ein und analysiert verschiedene Unterkategorien wie Gliederungssignale, turn-taking-Signale, Kontaktsignale, Überbrückungsphänomene, Korrektursignale, Interjektionen und Abtönungsphänomene. Das Kapitel beleuchtet die Gesamtproblematik dieser Phänomene im Kontext der gesprochenen Kommunikation.
IV. Der Ansatz von Söll/Hausmann und Gülich: Dieses Kapitel präsentiert den Ansatz von Söll/Hausmann und Gülich zum Thema gesprochene Sprache und vergleicht ihn mit dem Ansatz von Koch/Oesterreicher. Es wird die Bedeutung von Gülichs Arbeit zur Makrosyntax der Gliederungssignale im gesprochenen Französisch für die Forschung zu Gesprächswörtern hervorgehoben.
V. Untersuchung der Theorie an einem spanischen Beispiel-Corpus: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise bei der Untersuchung eines spanischen Beispiel-Corpus. Es analysiert die Gesprächswörter im ausgewählten Korpus und wertet die Ergebnisse im Lichte der vorherigen Kapitel aus. Die Untersuchung deckt sowohl dialogische als auch erzählende Passagen ab um die Vielfältigkeit der Gesprächswörter aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Gesprächswörter, gesprochenes Spanisch, Koch/Oesterreicher, Söll/Hausmann, Gülich, kommunikative Nähe, kommunikative Distanz, Sprechsprache, Schriftlichkeit, Korpusanalyse, Pragmatik, Textlinguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Gesprächswörtern im gesprochenen Spanisch
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Gesprächswörter und äquivalente Verfahren im gesprochenen Spanisch. Sie basiert auf der Klassifizierung von Koch/Oesterreicher und analysiert ein spanisches Beispiel-Corpus, um die theoretischen Ergebnisse zu überprüfen. Ein Fokus liegt auf den sprechsprachlichen Bedingungen, die zur Entstehung dieser Wörter führen.
Welche Forschungsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Forschungsansätze zur gesprochenen Sprache, von historischen Ansätzen bis zu modernen psycholinguistischen, soziolinguistischen und textlinguistischen Methoden. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich der Ansätze von Koch/Oesterreicher und Söll/Hausmann/Gülich.
Wie werden Gesprächswörter nach Koch/Oesterreicher klassifiziert?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Kategorien von Gesprächswörtern nach Koch/Oesterreicher. Diese umfassen Gliederungssignale, turn-taking-Signale, Kontaktsignale, Überbrückungsphänomene, Korrektursignale, Interjektionen und Abtönungsphänomene. Die Einordnung dieser Kategorien in den textuell-pragmatischen Bereich wird erläutert.
Welche Rolle spielt der Ansatz von Söll/Hausmann und Gülich?
Der Ansatz von Söll/Hausmann und Gülich wird vorgestellt und mit dem Ansatz von Koch/Oesterreicher verglichen. Die Bedeutung von Gülichs Arbeit zur Makrosyntax der Gliederungssignale im gesprochenen Französisch wird im Kontext der Forschung zu Gesprächswörtern hervorgehoben.
Wie wird die Theorie anhand eines Beispiel-Corpus untersucht?
Die Arbeit beschreibt die methodische Vorgehensweise bei der Untersuchung eines spanischen Beispiel-Corpus. Die Analyse der Gesprächswörter im Korpus wird detailliert erläutert, wobei sowohl dialogische als auch erzählende Passagen berücksichtigt werden. Die Ergebnisse werden im Lichte der vorherigen Kapitel ausgewertet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesprächswörter, gesprochenes Spanisch, Koch/Oesterreicher, Söll/Hausmann, Gülich, kommunikative Nähe, kommunikative Distanz, Sprechsprache, Schriftlichkeit, Korpusanalyse, Pragmatik, Textlinguistik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Überblick über die bisherigen Forschungsansätze, Die Kategorien der Gesprächswörter nach Koch/Oesterreicher, Der Ansatz von Söll/Hausmann und Gülich, Untersuchung der Theorie an einem spanischen Beispiel-Corpus, Fazit, Anhang und Bibliographie.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die spezifisch sprechsprachlichen Bedingungen aufzuzeigen, die zur Entstehung von Gesprächswörtern im gesprochenen Spanisch führen. Sie will die verschiedenen Forschungsansätze vergleichen und die theoretischen Ergebnisse anhand eines spanischen Beispiel-Corpus überprüfen.
- Arbeit zitieren
- Nadine Hoffmann (Autor:in), 2002, Gesprächswörter im gesprochenen Spanisch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8237