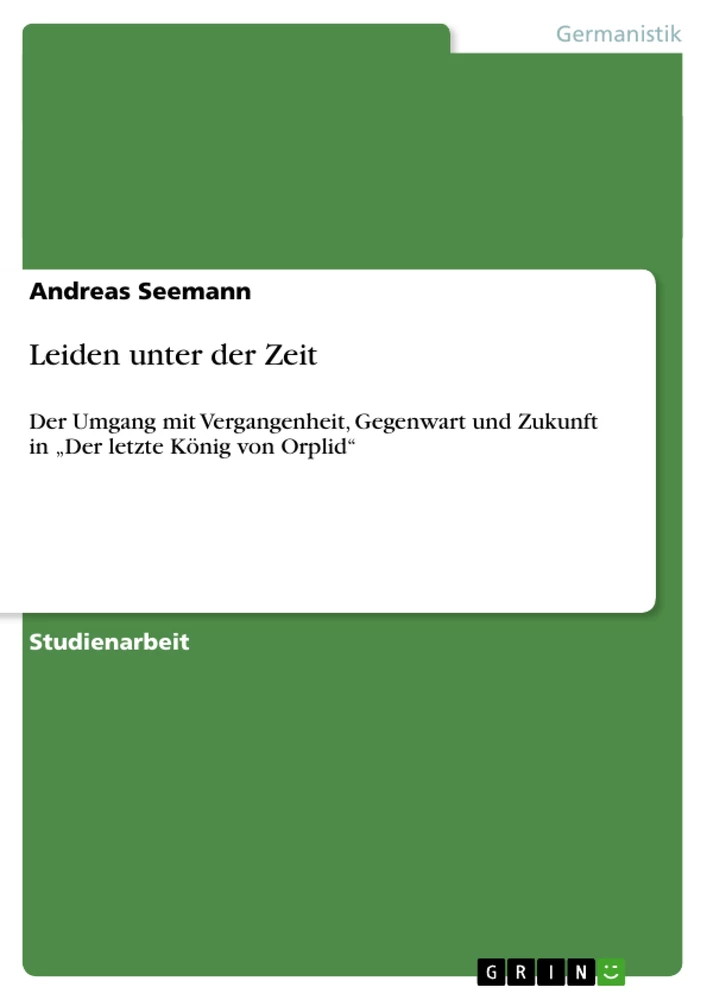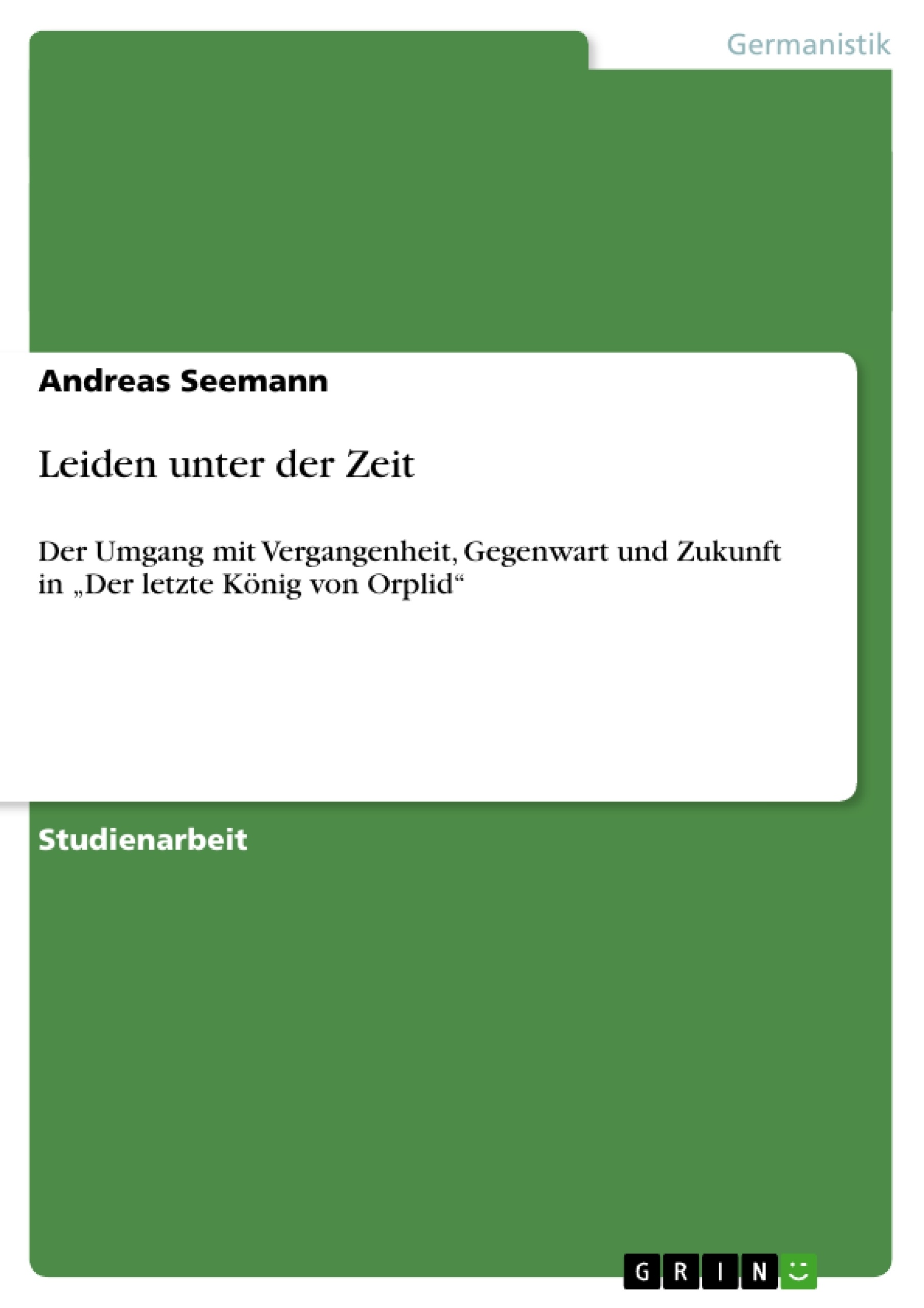Die Erkenntnis, daß das Verfließen von Zeit auf vielfältige und bedeutsame Art und Weise im Werk Eduard Mörikes thematisiert wird, ist nicht erst in den letzten Jahrzehnten entstanden. Die Betrachtung des „Maler Nolten“ hinsichtlich dieser Problematik führt zu besonders fruchtbaren und weitreichenden Ergebnissen, was angesichts der Komplexität und des Umfangs dieses Romans nicht erstaunlich ist. Die Formgestaltung und die Verankerung und Begründung des Geschehens der Gegenwart in der tiefsten Vergangenheit lassen schon auf den ersten Blick eine Untersuchung des Umgangs der Protagonisten im „Maler Nolten“ mit ihrem persönlichen Zeitempfinden als naheliegend erscheinen. Ob und wie der Autor dieses Verhalten seiner Protagonisten bewertet, ist eine zweite, schwierigere Frage. Die hierzu bereits vorliegenden Arbeiten werden eingangs zusammengefasst, außerdem werden die diesbezügliche Resultate des Seminars wiedergegeben. Dann soll aber „Der letzte König von Orplid“ im Mittelpunkt stehen.
In diesem Intermezzo wird der Umgang einer Person mit dem Phänomen Zeit auf die Probe gestellt. Das Verschwinden der Vergangenheit und das unbestimmte Hinauszögern der Zukunft läßt ein Vakuum der Sinnlosigkeit und der Zweifel entstehen, in dem sich der König positiv bewährt, weil er aktiv die Vollendung seiner Existenz, seine Apotheose betreibt und so aus seiner Gefangenschaft in der Zeit ausbrechen kann. Hierin unterscheidet er sich von Nolten, dessen Passivität schon vielfach angemahnt wurde. So kommt die Arbeit zu der Behauptung, die Figur des Königs von Orplid sei ein positiv bewertetes Gegenbeispiel zum glücklosen Nolten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkungen. Umgang mit Zeit im Werk Mörikes.
- Themenstellung und These
- Umgang mit Zeit im lyrischen Werk Mörikes
- Bisherige Forschungsergebnisse: Zeit im „Maler Nolten“
- Zeiterleben und Zeitverhalten im „Letzten König von Orplid“.
- Betonung der Fiktionalität des „Letzten Königs von Orplid“
- Leiden unter der Zeit
- Der Umgang mit der Vergangenheit
- Der Umgang mit der Gegenwart
- Schicksal und Vorherbestimmung
- Implosion der Zeitachse
- Der Umgang mit der Zukunft
- Orplid als Alternativentwurf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit Zeit in Eduard Mörikes Werk, insbesondere im „Letzten König von Orplid“, im Vergleich zu seinem Roman „Maler Nolten“. Ziel ist es, die Darstellung des Zeiterlebens und -verhaltens der Protagonisten zu analysieren und die Bewertung dieser durch den Autor zu ergründen. Der „Letzte König von Orplid“ wird als Gegenbeispiel zu Nolten betrachtet, wobei die positive Bewertung des Königs im Kontext der Erzählperspektive analysiert wird.
- Die Darstellung des Zeitflusses in Mörikes Werk
- Vergleich des Umgangs mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bei verschiedenen Protagonisten
- Die Rolle der Erinnerung und des Blicks in die Zukunft im Zeiterleben
- Orplid als Gegenentwurf zur Realität
- Bewertung des Protagonistenverhaltens durch den Autor
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Bemerkungen. Umgang mit Zeit im Werk Mörikes: Dieses einleitende Kapitel legt die Grundlage der Arbeit dar. Es stellt fest, dass die Thematik des Zeitverlaufs in Mörikes Werk bereits ausführlich untersucht wurde, wobei besonders der Roman „Maler Nolten“ im Fokus stand. Die Arbeit verweist auf bereits bestehende Forschungsliteratur und Ergebnisse des Seminars und kündigt die zentrale Untersuchung des „Letzten Königs von Orplid“ an. Der König von Orplid wird als positives Gegenbeispiel zu Noltens Passivität im Umgang mit der Zeit eingeführt, wobei die Erzählperspektive des Autors und seine Distanzierung durch die Einbettung der Geschichte in den Kontext der Erzählung betont werden. Die unterschiedlichen Schicksale der Figuren am Ende der jeweiligen Erzählungen unterstreichen die These einer gegensätzlichen Bewertung der Protagonisten.
2. Zeiterleben und Zeitverhalten im „Letzten König von Orplid“: Dieses Kapitel analysiert das Zeiterleben und -verhalten im „Letzten König von Orplid“. Es betont zunächst die Fiktionalität der Geschichte und untersucht dann das „Leiden unter der Zeit“, indem es den Umgang des Königs mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der Implosion der Zeitachse, der Vorherbestimmung und dem aktiven Umgang des Königs mit seiner Situation, der im Gegensatz zu Noltens Passivität steht. Die Darstellung des Königs als positiv bewertetes Gegenbeispiel zu Nolten wird vertieft und im Kontext von Mörikes Gesamtwerk diskutiert.
3. Orplid als Alternativentwurf: Dieses Kapitel (wenn vorhanden, da der Text unvollständig ist) würde voraussichtlich die Bedeutung von Orplid als Gegenwelt zur Realität analysieren. Es würde beleuchten, wie diese imaginäre Welt die Konzepte von Zeit und Erfahrung verändert und möglicherweise alternative Möglichkeiten zum Umgang mit dem Zeitfluss präsentiert. Der Vergleich mit dem Realitätsbezug der vorherigen Kapitel würde vermutlich Aufschluss über die Intention des Autors geben.
Schlüsselwörter
Eduard Mörike, Zeit, Zeiterleben, „Der letzte König von Orplid“, „Maler Nolten“, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Fiktionalität, Passivität, Alternativentwurf, positive und negative Bewertung, Mythos, Erinnerung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Zeitgestaltung in Eduard Mörikes Werk - Fokus auf "Der letzte König von Orplid"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Umgang mit Zeit in Eduard Mörikes Werk, insbesondere im Vergleich zwischen "Der letzte König von Orplid" und "Maler Nolten". Der Fokus liegt auf dem Zeiterleben und -verhalten der Protagonisten und deren Bewertung durch den Autor.
Welche Werke von Mörike werden untersucht?
Die Hauptaugenmerk liegt auf "Der letzte König von Orplid". "Maler Nolten" dient als Vergleichswerk, um die unterschiedlichen Darstellungen des Umgangs mit Zeit und die jeweilige Bewertung der Protagonisten herauszuarbeiten.
Wie wird die Zeit in "Der letzte König von Orplid" dargestellt?
Die Arbeit untersucht das "Leiden unter der Zeit" des Königs, seinen Umgang mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Implosion der Zeitachse und der Vorherbestimmung. Der König wird als aktiv im Gegensatz zu Noltens Passivität dargestellt.
Welche Rolle spielt die Fiktionalität in der Analyse?
Die Fiktionalität von "Der letzte König von Orplid" wird betont. Die Analyse berücksichtigt die Erzählperspektive und die Distanzierung des Autors, um die positive Bewertung des Königs im Kontext der Erzählung zu verstehen.
Wie wird "Orplid" in der Arbeit betrachtet?
Orplid wird als Alternativentwurf zur Realität analysiert. Die Arbeit untersucht, wie diese imaginäre Welt die Konzepte von Zeit und Erfahrung verändert und alternative Möglichkeiten des Umgangs mit dem Zeitfluss präsentiert. Der Vergleich mit der Realität soll Aufschluss über die Intention des Autors geben.
Wie werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert den Umgang der Protagonisten mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Vergleich zwischen den beiden Werken soll die unterschiedlichen Strategien im Umgang mit der Zeit aufzeigen und die Bewertung des Autors verdeutlichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Eduard Mörike, Zeit, Zeiterleben, "Der letzte König von Orplid", "Maler Nolten", Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Fiktionalität, Passivität, Alternativentwurf, positive und negative Bewertung, Mythos, Erinnerung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung des Zeiterlebens und -verhaltens der Protagonisten zu analysieren und die Bewertung dieser durch den Autor zu ergründen. "Der letzte König von Orplid" wird als Gegenbeispiel zu "Maler Nolten" betrachtet.
Gibt es einen Vergleich mit anderen Forschungsarbeiten?
Die Arbeit verweist auf bestehende Forschungsliteratur und Ergebnisse des Seminars und integriert diese in die eigene Analyse.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einer Analyse von "Der letzte König von Orplid", einer Betrachtung von Orplid als Alternativentwurf (falls vorhanden) und einem Fazit (implizit durch die Zusammenfassung). Die Einleitung erläutert die Thematik und den methodischen Ansatz. Die Analyse von "Der letzte König von Orplid" untersucht das Zeiterleben und -verhalten des Protagonisten. Die Betrachtung von Orplid als Alternativentwurf analysiert die Bedeutung von Orplid als Gegenwelt zur Realität.
- Quote paper
- Andreas Seemann (Author), 1998, Leiden unter der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82382