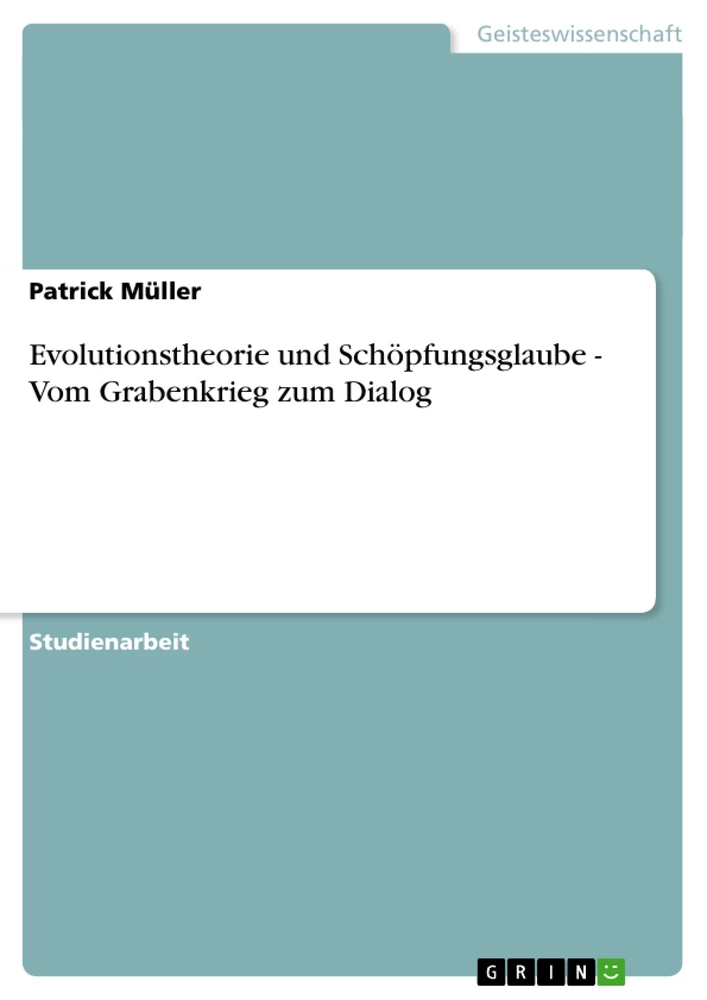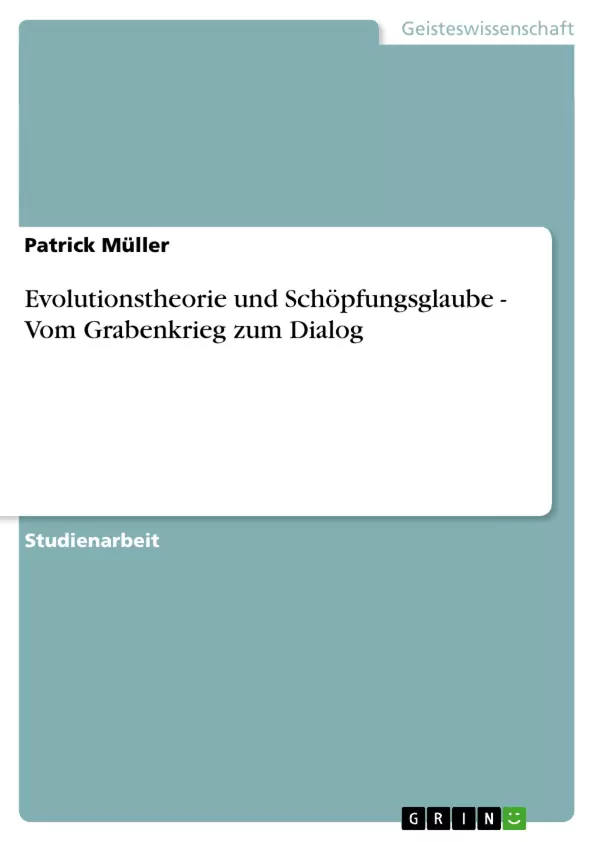Nach Jahrhunderten von Vorurteilen, Ignoranz und falschem Stolz geprägten Grabenkämpfen und offenen Schlagabtauschen scheinen Theologie und Naturwissenschaft bereit für einen gemeinsamen Dialog zu sein. Diese Entwicklung zeugt von großer Offenheit und dem Verschwinden rein dogmatischen und ideologischen Denkens in beiden Bereichen. Doch wo lässt sich ein solcher Dialog sinnvoll beginnen? Die Antwort darauf ist so einfach wie die Frage selbst: am Beginn, am Anfang des Ganzen, was wir Welt, Kosmos, All oder Schöpfung nennen, am Anfang des Seins selbst. Und genau hier sehen sich Theologie und moderne Naturwissenschaft wieder in die Augen. Die einen, weil sie trotz immenser Erkenntnisse und Fortschritte angesichts der Unendlichkeit des Universums und der Endlichkeit der menschlichen Natur ins Zweifeln geraten sind, auf alle anstehenden Fragen nach der Struktur des Kosmos und des Lebens eine aus empirischer Perspektive befriedigende Antwort finden zu können. Und die anderen, weil sie erkennen mussten, dass Sturheit und Dogmatismus den Blick für das Wirkliche verfälschen und dass sie sich dem Geist der Moderne nicht länger verschließen können, ohne den Anspruch auf geistige Heimat vieler Menschen zu verlieren. Nachdem der Mensch erkannt hat, dass der Planet auf dem er lebt nicht im Mittelpunkt des Universums steht, und dass die Sonne nur ein Stern unter Abermilliarden Sternen Kosmos ist, wurde dem anthropozentrischen Weltbild mit der Entwicklung der modernen Evolutionstheorie wohl ein endgültiger Gnadenstoß versetzt.
Wie nun ein Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie aussehen kann und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, soll im dritten Teil der Arbeit am Beispiel von Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube noch genau erörtert werden. Zuvor soll jedoch ausgeführt werden, was man sich eigentlich unter Evolution oder Schöpfung im Einzelnen vorzustellen hat.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Die Evolutionstheorie
- 1. Ursprünge
- 1.1 Kosmogonien der griechischen Philosophen
- 1.2 Das Mittelalter
- 2. Der Darwinismus
- 2.1 Die Vorläufer Darwins
- 2.2 Das Werk Darwins
- 3. Der Neodarwinismus
- 1. Ursprünge
- II. Der biblische Schöpfungsmythos
- 1. Die priesterschriftliche Schicht
- 2. Der jahwistische Bericht
- III. Evolution als Prinzip der göttlichen Schöpfung - alttestamentliche Schöpfungstexte im Kontext wissenschaftlicher Weltschau
- 1. Wissenschaftstheoretische Grundlagen: Fragestellungen und Methoden der Theologie und Philosophie im Vergleich zu denen der Naturwissenschaft
- 2. Naturwissenschaftlicher Zugang zum biblischen Schöpfungsmythos
- 3. Theologisch-philosophischer Zugang zur Evolutionstheorie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Dialog zwischen Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube. Ziel ist es, die historischen und philosophischen Perspektiven beider Positionen zu beleuchten und einen konstruktiven Austausch anzuregen. Der Fokus liegt auf der Überbrückung des scheinbaren Gegensatzes zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und religiöser Überzeugung.
- Historische Entwicklung des Verständnisses von Schöpfung und Evolution
- Vergleichende Analyse von alttestamentlichen Schöpfungsberichten und evolutionären Theorien
- Wissenschaftstheoretische Grundlagen und methodische Ansätze in Theologie und Naturwissenschaften
- Der Wandel des anthropozentrischen Weltbilds im Lichte der modernen Wissenschaft
- Möglichkeiten eines fruchtbaren Dialogs zwischen Naturwissenschaft und Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt den Wandel von Grabenkämpfen zu einem Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft, der am Anfang des Seins angesiedelt wird. Es wird die Notwendigkeit eines solchen Dialogs hervorgehoben, sowohl aus naturwissenschaftlicher (angesichts der Unendlichkeit des Universums) als auch aus theologischer Perspektive (Überwindung von Sturheit und Dogmatismus) begründet. Die Arbeit kündigt den Dialog am Beispiel von Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube an.
I. Die Evolutionstheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursprüngen des Gedankens eines Werdeprozesses in der Natur. Es beginnt mit den Kosmogonien der antiken griechischen Philosophen, die bereits Ansätze einer Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen aufweisen, im Gegensatz zum biblischen Schöpfungsakt. Die Kapitel erläutert die Ansätze von Anaximander, Thales und Empedokles, die eine gemeinsame Stammlinie aller Lebensformen und eine Art natürliche Selektion vorschlugen. Der Einfluss von Parmenides, Aristoteles und Platon auf die Abkehr von evolutionären Denkmodellen wird ebenfalls behandelt, ebenso wie die Bedeutung der Atomlehre von Leukipp und Demokrit für die Entmythisierung der Welt. Das Kapitel zeigt, wie der Gedanke der Evolution in der Geschichte immer wieder auftauchte und wieder verschwand, bevor er in der Neuzeit seinen Siegeszug antrat.
II. Der biblische Schöpfungsmythos: Dieses Kapitel analysiert den biblischen Schöpfungsmythos, insbesondere die priesterschriftliche und die jahwistische Schicht. Es untersucht die unterschiedlichen Darstellungen der Schöpfung und ihre jeweilige Bedeutung innerhalb des alttestamentlichen Kontextes. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Texte und ihrer Interpretation im Laufe der Geschichte, insbesondere im Hinblick auf die wörtliche Auslegung im Mittelalter und die damit verbundene Dominanz der Scholastik.
III. Evolution als Prinzip der göttlichen Schöpfung - alttestamentliche Schöpfungstexte im Kontext wissenschaftlicher Weltschau: Dieses Kapitel widmet sich der zentralen Fragestellung, wie Evolution und Schöpfungsbericht miteinander in Einklang gebracht werden können. Es vergleicht die wissenschaftstheoretischen Grundlagen und Methoden der Theologie und Philosophie mit denen der Naturwissenschaften und beleuchtet den naturwissenschaftlichen und theologisch-philosophischen Zugang zu den jeweiligen Themenbereichen. Das Kapitel erörtert, wie alttestamentliche Schöpfungstexte im Kontext einer modernen wissenschaftlichen Weltsicht interpretiert werden können, und welche Möglichkeiten für einen fruchtbaren Dialog zwischen beiden Perspektiven bestehen.
Schlüsselwörter
Evolutionstheorie, Schöpfungsglaube, Naturwissenschaft, Theologie, Dialog, Kosmogonie, Antike Philosophie, Biblischer Schöpfungsmythos, Wissenschaftstheorie, Anthropozentrismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Evolution und Schöpfungsglaube - Ein Dialog
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Dialog zwischen Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube. Sie beleuchtet historische und philosophische Perspektiven beider Positionen und zielt auf einen konstruktiven Austausch ab, um den scheinbaren Gegensatz zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und religiöser Überzeugung zu überwinden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Verständnisses von Schöpfung und Evolution, vergleicht alttestamentliche Schöpfungsberichte mit evolutionären Theorien, untersucht wissenschaftstheoretische Grundlagen und Methoden in Theologie und Naturwissenschaften, betrachtet den Wandel des anthropozentrischen Weltbilds und erörtert Möglichkeiten eines fruchtbaren Dialogs zwischen Naturwissenschaft und Theologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, drei Hauptkapitel und einen Schluss. Kapitel I behandelt die Evolutionstheorie von ihren Ursprüngen bei den griechischen Philosophen über Darwin bis zum Neodarwinismus. Kapitel II analysiert den biblischen Schöpfungsmythos (priesterschriftliche und jahwistische Schicht). Kapitel III widmet sich der zentralen Fragestellung, wie Evolution und Schöpfungsbericht miteinander in Einklang gebracht werden können, indem es den naturwissenschaftlichen und theologisch-philosophischen Zugang zu den jeweiligen Themenbereichen vergleicht.
Wie werden die alttestamentlichen Schöpfungsberichte behandelt?
Die Arbeit analysiert die priesterschriftliche und die jahwistische Schicht des biblischen Schöpfungsmythos, untersucht deren unterschiedliche Darstellungen und ihre Bedeutung im alttestamentlichen Kontext. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Texte und ihrer Interpretation im Laufe der Geschichte, insbesondere im Hinblick auf wörtliche Auslegungen und die Scholastik.
Welchen Beitrag leistet die Arbeit zum Thema?
Die Arbeit trägt dazu bei, die Debatte zwischen Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube zu versachlichen, indem sie einen Dialog anregt und die jeweiligen Perspektiven und Methoden systematisch vergleicht. Sie fördert ein differenziertes Verständnis beider Positionen und zeigt Möglichkeiten für eine konstruktive Auseinandersetzung auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Evolutionstheorie, Schöpfungsglaube, Naturwissenschaft, Theologie, Dialog, Kosmogonie, Antike Philosophie, Biblischer Schöpfungsmythos, Wissenschaftstheorie, Anthropozentrismus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den historischen und philosophischen Kontext von Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube zu beleuchten und einen konstruktiven Dialog zwischen beiden Perspektiven anzuregen. Sie möchte die scheinbar gegensätzlichen Positionen miteinander in Beziehung setzen und Möglichkeiten zur Versöhnung aufzeigen.
Wie wird der scheinbare Gegensatz zwischen Wissenschaft und Religion behandelt?
Die Arbeit versucht, den scheinbaren Gegensatz zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und religiöser Überzeugung zu überwinden, indem sie die unterschiedlichen methodischen Ansätze und Fragestellungen von Theologie und Naturwissenschaften vergleicht und Möglichkeiten für einen fruchtbaren Dialog aufzeigt. Der Fokus liegt auf der Suche nach einer gemeinsamen Basis und der Anerkennung der jeweiligen Perspektiven.
- Quote paper
- Patrick Müller (Author), 2001, Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube - Vom Grabenkrieg zum Dialog, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8253