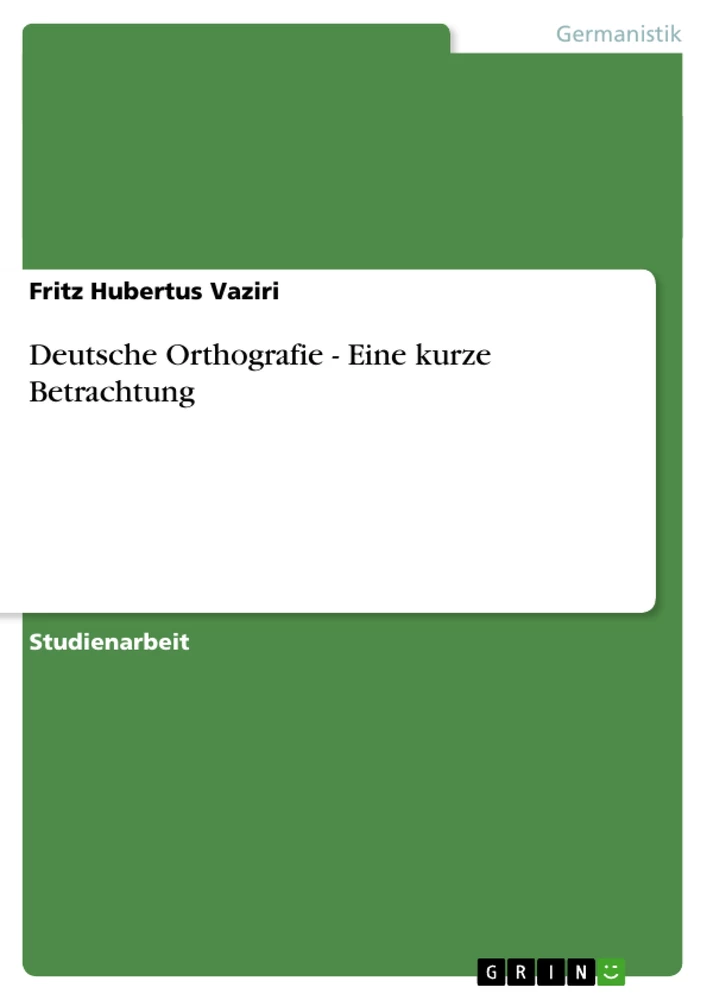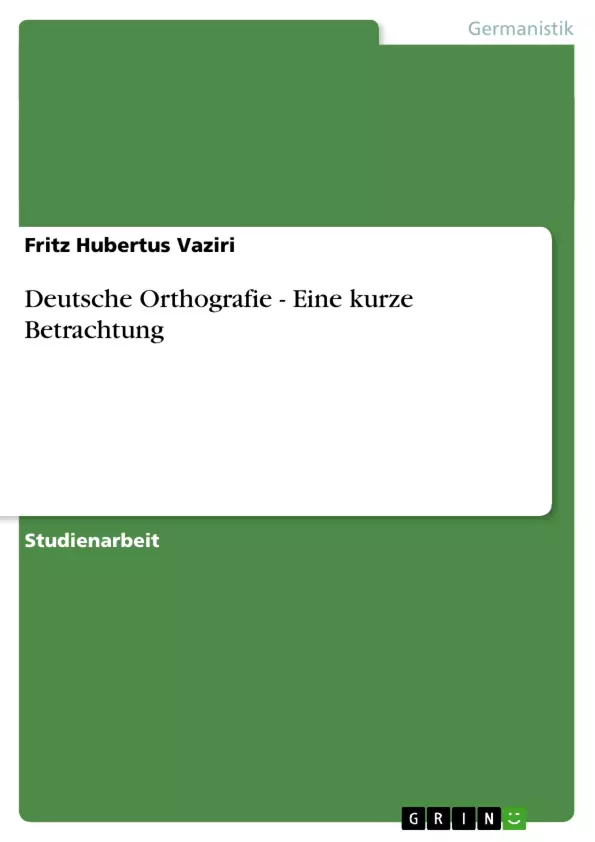Die gerade zurückliegende Rechtschreibreform hat für viel Diskussionsstoff gesorgt und die Orthografie zu einem Thema zentralen Interesses werden lassen, unter Fachleuten wie Laien gleichermaßen. Kritiker sprechen von einer „Schlechtschreibreform“, die gegen grammatische Prinzipien verstoße.
„Wozu überhaupt eine Rechtschreibreform?“, fragen PFEIFFER/LUDWIG, vermuten gar die Entmachtung des Duden-Verlags als eigentliches Motiv und zitieren dessen ehemaligen Leiter Günther Drosdowski:
„Die Reformer missbrauchten die Reform schamlos, um sich Ansehen im Fach und in der Öffentlichkeit zu verschaffen, Eitelkeiten zu befriedigen und mit orthographischen Publikationen Geld zu verdienen. Selten habe ich erlebt, dass Menschen sich so ungeniert ausziehen und ihre fachlichen und charakterlichen Defizite zur Schau stellen.“
Die Reform eine Farce? Ein intrigantes Machwerk als Ergebnis von Dilettantismus und Habgier?
BLÜML scheint das anders zu sehen. In seinen Augen war die Reform notwendig geworden, da Änderungen der Sprache seit der zweiten orthografischen Konferenz von 1901 eine Anpassung der Rechtschreibung erforderlich gemacht hätten, da das „sinnvolle Gleichgewicht zwischen dem Aufwand auf der Seite der Schreibenden und der notwendigen Klarheit auf der Seite der Lesenden empfindlich gestört“ gewesen sei.
Die vorliegende Arbeit soll keinen weiteren Beitrag zu Sinn oder Unsinn eines Reformwerkes wie des hier erwähnten leisten. Vielmehr will sie Impulse aus den Debatten der zurückliegenden Jahre aufgreifen und zum Anlass nehmen, das Objekt der leidenschaftlichen Auseinandersetzungen, die große Teile der Gesellschaft ergriffen und selbst das Bundesverfassungsgericht beschäftigten, in Ansätzen etwas genauer zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Deutsche Rechtschreibung
- 3. Orthografische Prinzipien
- 3.1. Das Lautprinzip
- 3.2. Morphologische Schreibung
- 3.3. Usus Scribendi
- 4. Historische Schriftzeugen
- 4.1. Luthers Bibelübersetzung von 1534
- 4.2. Das Faustbuch von 1587
- 4.3. Goethes Werther von 1774 und 1787
- 5. Die heutige Schreibung - ein Vergleich
- 6. Abschließendes
- 7. Anhang
- 8. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsche Orthografie, insbesondere im Kontext der Rechtschreibreform von 1996. Ziel ist es, verschiedene Prinzipien der deutschen Schreibung zu beleuchten und deren Zusammenspiel zu erklären. Die Arbeit analysiert historische Schriftzeugnisse, um orthografische Entwicklungen nachzuvollziehen und den Bezug zu aktuellen Reformdebatten herzustellen.
- Prinzipien der deutschen Rechtschreibung (Lautprinzip, morphologische Schreibung, Usus Scribendi)
- Historische Entwicklung der deutschen Orthografie anhand ausgewählter Texte
- Kontroversen um die Rechtschreibreform von 1996
- Der Einfluss von Tradition und linguistischen Argumenten auf die Rechtschreibung
- Das Verhältnis von deskriptiver und präskriptiver Orthografie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der deutschen Orthografie und der kontroversen Diskussionen um die Rechtschreibreform ein. Sie verweist auf gegensätzliche Positionen, von Kritik an der Reform bis zur Notwendigkeit der Anpassung an sprachliche Veränderungen. Die Arbeit selbst positioniert sich nicht in dieser Debatte, sondern will verschiedene Prinzipien der deutschen Schreibung vorstellen und anhand historischer Beispiele beleuchten.
2. Deutsche Rechtschreibung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der deutschen Rechtschreibung, beginnend mit der Einführung des lateinischen Alphabets. Es werden wichtige historische Ereignisse und Personen wie Konrad Duden und die orthografischen Konferenzen des 19. und 20. Jahrhunderts erwähnt. Der Kapitel hebt den emotionalen Aspekt der Rechtschreibung hervor, die als "Kulturgut" betrachtet wird und an traditionelle Schreibweisen klammert, selbst wenn linguistische Argumente für Änderungen sprechen. Der Konflikt zwischen Tradition und Reform wird als zentrales Thema etabliert.
3. Orthografische Prinzipien: Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen Prinzipien, die die deutsche Schreibung bestimmen: das Lautprinzip, die morphologische Schreibung und der Usus Scribendi. Es analysiert, wie diese Prinzipien miteinander interagieren und die Komplexität der deutschen Orthografie verdeutlichen. Die unterschiedlichen Prinzipien und ihre Interaktion sind ein wichtiger Bestandteil zur Erklärung der orthografischen Besonderheiten.
4. Historische Schriftzeugen: Das Kapitel untersucht ausgewählte Texte aus dem 16. und 18. Jahrhundert (Luthers Bibelübersetzung, das Faustbuch, Goethes Werther) auf ihre orthografischen Besonderheiten. Es wird gezeigt, wie die Schreibung sich im Laufe der Zeit verändert hat und wie diese Veränderungen mit den Prinzipien aus Kapitel 3 zusammenhängen. Die Analyse dieser Texte dient als Beispiel für die historische Entwicklung der deutschen Orthografie und deren Vielfalt.
5. Die heutige Schreibung - ein Vergleich: (Kapitel fehlt im Ausgangstext, daher keine Zusammenfassung möglich)
6. Abschließendes: (Kapitel fehlt im Ausgangstext, daher keine Zusammenfassung möglich)
Schlüsselwörter
Deutsche Orthografie, Rechtschreibreform, Lautprinzip, morphologische Schreibung, Usus Scribendi, historische Schriftzeugnisse, Luther, Goethe, Faust, Kontroversen, Tradition, Linguistik, Graphematik, präskriptive Norm, deskriptive Norm.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deutsche Orthografie - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die deutsche Orthografie, insbesondere im Kontext der Rechtschreibreform von 1996. Sie beleuchtet verschiedene Prinzipien der deutschen Schreibung (Lautprinzip, morphologische Schreibung, Usus Scribendi) und deren Zusammenspiel. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse historischer Schriftzeugnisse, um orthografische Entwicklungen nachzuvollziehen und den Bezug zu aktuellen Reformdebatten herzustellen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Deutsche Rechtschreibung, Orthografische Prinzipien, Historische Schriftzeugen, Die heutige Schreibung - ein Vergleich, Abschließendes, Anhang und Literaturverzeichnis. Die Kapitel 5 und 6 fehlen jedoch im vorliegenden Auszug.
Welche Prinzipien der deutschen Rechtschreibung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Lautprinzip, die morphologische Schreibung und den Usus Scribendi. Es wird analysiert, wie diese Prinzipien interagieren und die Komplexität der deutschen Orthografie erklären.
Welche historischen Schriftzeugnisse werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Luthers Bibelübersetzung von 1534, das Faustbuch von 1587 und Goethes Werther von 1774 und 1787, um die historische Entwicklung der deutschen Orthografie zu veranschaulichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Prinzipien der deutschen Rechtschreibung, die historische Entwicklung der Orthografie anhand ausgewählter Texte, Kontroversen um die Rechtschreibreform von 1996, den Einfluss von Tradition und linguistischen Argumenten auf die Rechtschreibung sowie das Verhältnis von deskriptiver und präskriptiver Orthografie.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, der Text enthält Kapitelzusammenfassungen für die Kapitel 1-4. Die Kapitel 5 und 6 fehlen im vorliegenden Auszug, daher sind keine Zusammenfassungen verfügbar.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Orthografie, Rechtschreibreform, Lautprinzip, morphologische Schreibung, Usus Scribendi, historische Schriftzeugnisse, Luther, Goethe, Faust, Kontroversen, Tradition, Linguistik, Graphematik, präskriptive Norm, deskriptive Norm.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, verschiedene Prinzipien der deutschen Schreibung zu beleuchten, deren Zusammenspiel zu erklären und die orthografische Entwicklung anhand historischer Schriftzeugnisse nachzuvollziehen. Sie stellt den Bezug zu aktuellen Reformdebatten her, positioniert sich aber nicht explizit in diesen.
- Quote paper
- Fritz Hubertus Vaziri (Author), 2007, Deutsche Orthografie - Eine kurze Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82551