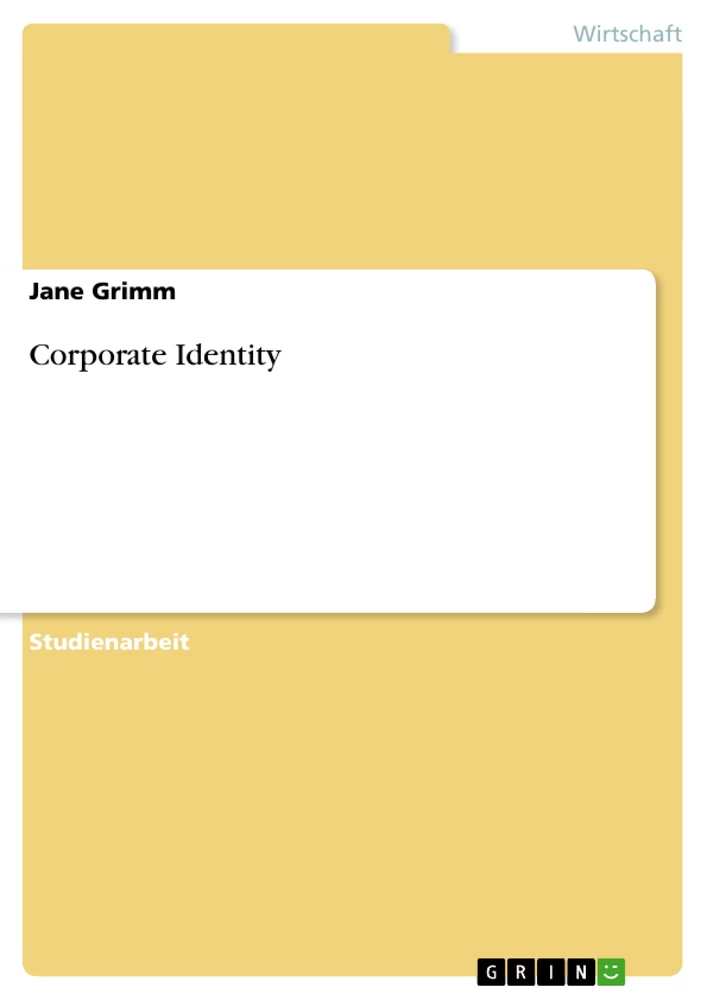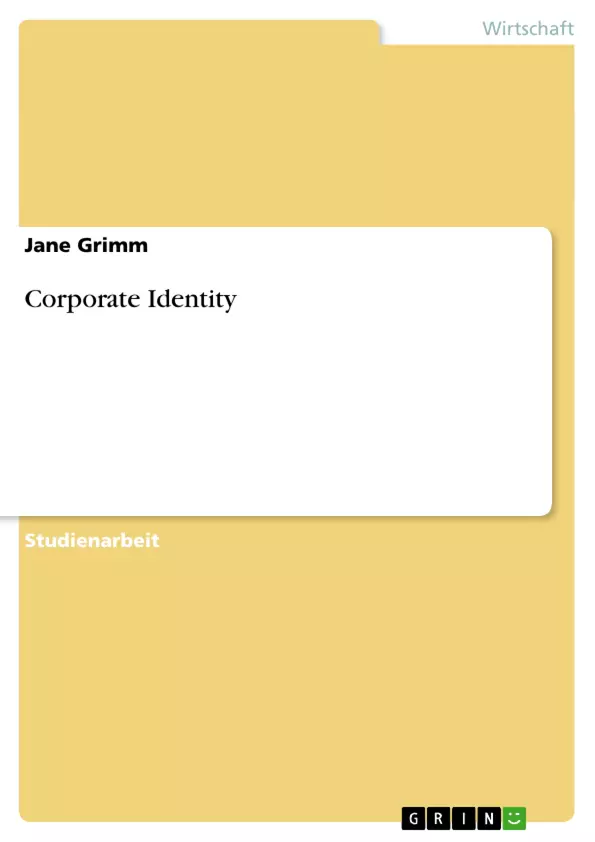In einer mit Nachrichten überladenen Gesellschaft müssen Unternehmen sich Aufmerksamkeit erkämpfen um den Wettbewerb stand zu halten. Dabei hilft es, eine "visuelle Identität" zu schaffen, die von der Öffentlichkeit sofort wiedererkannt wird. Diese visuelle Identität wird vom Namen und Logo des Unternehmens, seinem Geschäftspapier, seinen Prospekten, Symbolen, Formularen, Gebäuden, seiner Kleiderordnung, Transportmitteln, aber auch seinem Verhalten und Kommunikation nach außen und innen getragen. Aber nur derjenige kann ein überzeugendes und einstimmiges Erscheinungsbild vermitteln, der weiß, was er ist, was er kann und was von ihm erwartet wird. Jedoch wissen dies nicht alle Verantwortlichen gleichermaßen: Denn warum sonst greifen Konsumenten immer wahlloser nach Produkten? Und warum sonst vermissen die Wähler ´Profil` bei politischen Parteien? Und warum sonst können sich letztlich viele Mitarbeiter nicht mehr mit ihrem Unternehmen identifizieren? Über die klassischen Werbemaßnahmen hinaus muss ein einheitliches Bild geschaffen werden, mit dem sich das Unternehmen nach innen und außen darstellt, Orientierung bietet und sich einen Wettbewerbsvorsprung vor den Konkurrenten sichert.
"Das Corporate-Identity-Konzept ist dabei von zentraler Bedeutung. Es versucht, eine Identität des Unternehmens unter Berücksichtigung seines Leistungsprogramms und seiner Mitarbeiter zu bestimmen und Leitlinien für Unternehmenskultur und -kommunikation zu erstellen" (Birkigt/Stadler 1986 zitiert bei Bruhn, S. 234).
[...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Hintergrund dieser Arbeit
1.2 Problemstellung und Zielsetzung
2. Begrifflichkeiten
2.1 Definition der CI
2.2 Zielgruppen einer CI
2.3 Definition und Systematisierung der Bausteine der CI
2.4 Corporate Identity und Corporate Image
3. Funktionen der CI
3.1 Notwendigkeit
3.2 Interne und Externe Ziele der CI
3.2.1 Interne Ziele
3.2.2 Externe Ziele
3.3 CI als Leitlinie für das Zielsystem
3.4 Wirkungen einer CI
4. Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Hintergrund dieser Arbeit
In einer mit Nachrichten überladenen Gesellschaft müssen Unternehmen sich Aufmerksamkeit erkämpfen um den Wettbewerb stand zu halten. Dabei hilft es, eine „visuelle Identität“ zu schaffen, die von der Öffentlichkeit sofort wiedererkannt wird. Diese visuelle Identität wird vom Namen und Logo des Unternehmens, seinem Geschäftspapier, seinen Prospekten, Symbolen, Formularen, Gebäuden, seiner Kleiderordnung, Transportmitteln, aber auch seinem Verhalten und Kommunikation nach außen und innen getragen. Aber nur derjenige kann ein überzeugendes und einstimmiges Erscheinungsbild vermitteln, der weiß, was er ist, was er kann und was von ihm erwartet wird. Jedoch wissen dies nicht alle Verantwortlichen gleichermaßen: Denn warum sonst greifen Konsumenten immer wahlloser nach Produkten? Und warum sonst vermissen die Wähler ´Profil` bei politischen Parteien? Und warum sonst können sich letztlich viele Mitarbeiter nicht mehr mit ihrem Unternehmen identifizieren? Über die klassischen Werbemaßnahmen hinaus muss ein einheitliches Bild geschaffen werden, mit dem sich das Unternehmen nach innen und außen darstellt, Orientierung bietet und sich einen Wettbewerbsvorsprung vor den Konkurrenten sichert.
„Das Corporate-Identity-Konzept ist dabei von zentraler Bedeutung. Es versucht, eine Identität des Unternehmens unter Berücksichtigung seines Leistungsprogramms und seiner Mitarbeiter zu bestimmen und Leitlinien für Unternehmenskultur und –kommunikation zu erstellen“ (Birkigt/Stadler 1986 zitiert bei Bruhn, S. 234).
1.2 Problemstellung und Zielsetzung
Der Spanische Hof arbeitet gemäß DIN EN ISO 9001:2000. Nach 1 ½ Jahren Nutzung des Qualitätsmanagements wird der Bereich des Corporate Behavior vollständig abgedeckt, Corporate Communication nur teilweise und das Corporate Design wurde bislang ausgelassen. Auf dem Wege zum Total Quality Management erarbeitet die Autorin einen Corporate Design-Katalog, der Bestandteil des Qualitätsmanagementhandbuchs wird (vgl. Anlage 1).
Zur Entwicklung des Kataloges benötigte die Autorin eine Abgrenzung und Erarbeitung der Thematik, die nachfolgend dargestellt wird. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Notwendigkeit und den daraus resultierenden Zielen einer CI. Nach der Definition der Begrifflichkeiten werden dem Leser vor allem Erklärungen aufgezeigt, warum die CI gerade in der heutigen Zeit eine so bedeutende Rolle in der strategischen Unternehmensführung und der damit zusammenhängenden Unternehmensphilosophie spielt.
Zielsetzung der Arbeit ist es, den Stellenwert der CI in Zusammenhang mit dem Erfolg des Unternehmens zu bringen. Des Weiteren wird kurz auf die Einführung und Umsetzung des Konzeptes im Spanischen Hof verwiesen, sowie der Katalog beigefügt.
2. Begrifflichkeiten
2.1 Definition der CI
„Unter dem Begriff Corporate Identity ist ein ganzheitliches Strategiekonzept zu verstehen, das alle nach innen und außen gerichteten Kommunikationsprozesse steuert und sämtliche Kommunikationsziele, -strategien und -aktionen eines Unternehmens unter einem einheitlichen Dach integriert“ (Theis, S. 540).
Corporate Identity ist dabei ein Ziel, eine Soll-Aussage, eine anzustrebende Eigenart, Einmaligkeit, Persönlichkeit eines Unternehmens. Die CI soll ein Unternehmen unverwechselbar machen und dadurch den relevanten Bezugsgruppen der Umwelt erlauben, das Unternehmen in seiner Eigenart und Einmaligkeit zu erkennen. Des Weiteren soll sie eine Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen ermöglichen.
Das CI-Konzept kann als konsequente Weiterentwicklung des Public Relations-Gedanken aufgefasst werden. Es genügt nicht, positive Leistungen mittels Firmenwerbung und PR-Maßnahmen herauszustellen, sondern es muss das gesamte Erscheinungsbild und Verhalten eines Unternehmens auf ein definiertes Soll-Image ausgerichtet werden (vgl. Nieschlag, S. 497). Insbesondere soll das Selbstbild des Unternehmens aus der Sicht des Unternehmens
(Corporate Personality) und der Öffentlichkeit (Corprate Image) übereinstimmen, um positive Wirkungen zu erzielen. Eine Einheit von Charakter, Auftritt, Worten und Taten ist der Corporate Goodwill.
Laut Stadler sagt und stellt die CI dar, wie und als was sich ein Unternehmen versteht, legt das Feld für die Positionierung des Unternehmens fest und grenzt es ab, ist Basis und Steuerungselement jeder Art von Zielsetzung des Unternehmens innerhalb oder im Überschreiten seines Positionierungsfeldes (zitiert bei Geml, S. 68).
2.2 Zielgruppen einer CI
Die Corporate Identity Strategie ist nicht allein auf den Absatzmarkt gerichtet, wie es eine Vielzahl der Kommunikationsinstrumente beabsichtigen. Die wesentlichen Zielgruppen der CI sind u.a. der Absatzmarkt (Konsumenten, Absatzmittler, Konkurrenz), der Beschaffungsmarkt (Lieferanten), der Kapitalmarkt (Aktionäre, Banken, Investoren), das gesellschaftliche Umfeld (Bürger, Parteien, Medien) und die Mitarbeiter eines Unternehmens (vgl. Berndt, S. 275 f.).
2.3 Definition und Systematisierung der Bausteine der CI
Um eine Unternehmensidentität aufzubauen, ist eine Formulierung und Etablierung der Unternehmensphilosophie notwendig. Sie stellt die Basis dar.
Der Spanische Hof formuliert sie so: Anlage 2
Corporate Culture repräsentiert die Gesamtheit aller Werte- und Normvorstellungen sowie Denk- und Verhaltensmuster, die Entscheidungen, Handlungen und Aktivitäten der Organisationsmitglieder prägen. Die Etablierung einer Unternehmenskultur ist somit die Voraussetzung, um eine CI aufbauen zu können.
In der Praxis vollzieht sich die Darstellung der CI in den operativen Feldern: Corporate Design, Corporate Communication, Corporate Behavior und Corporate Entertainment.
Corporate Communication hat die Aufgabe, sämtliche nach innen und außen gerichtete Kommunikationsinstrumente aufeinander abzustimmen und auf die angestrebte Unternehmensidentität auszurichten. „Corporate Communication hat zum Ziel, einen Dialog zwischen dem Unternehmen und dessen relevanten Zielgruppen zu führen. Nicht zuletzt in Krisenzeiten sollen durch eine offensive Kommunikationspolitik die eigene Position erläutert und gesellschaftspolitische Verantwortungsbewusstsein dokumentiert werden. Inhalte und Instrumente der CC ergeben sich aus dem gesellschaftlichen Wertesystem und dem eigenen Zielsystem, allgemeine Leitlinie ist der Wertekonsens zwischen Unternehmen und Bevölkerung“ (Dichtl/Issing, S. 401).
Instrumente: - Werbung
- Verkaufsförderung
- Pressearbeit
- Soziale Tätigkeiten
- Förderung von Wissenschaft und Kunst
- Kulturelle Tätigkeiten
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist Corporate Identity (CI)?
Ein ganzheitliches Strategiekonzept, das die Identität eines Unternehmens nach innen und außen durch einheitliches Design, Kommunikation und Verhalten prägt.
Was sind die Bausteine der Corporate Identity?
Die zentralen Säulen sind Corporate Design (Visuelles), Corporate Communication (Botschaften) und Corporate Behavior (Verhalten der Mitarbeiter).
Warum ist Corporate Design (CD) so wichtig?
Es schafft eine visuelle Identität (Logo, Farben, Kleidung), die Wiedererkennbarkeit garantiert und Professionalität vermittelt.
Welche internen Ziele verfolgt eine CI-Strategie?
Sie soll die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen stärken, Orientierung bieten und ein positives Betriebsklima fördern.
Was ist der Unterschied zwischen Corporate Identity und Corporate Image?
Die CI ist das Selbstbild (wie das Unternehmen sein will), während das Image das Fremdbild (wie die Öffentlichkeit das Unternehmen wahrnimmt) ist.
- Arbeit zitieren
- Jane Grimm (Autor:in), 2002, Corporate Identity, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8257