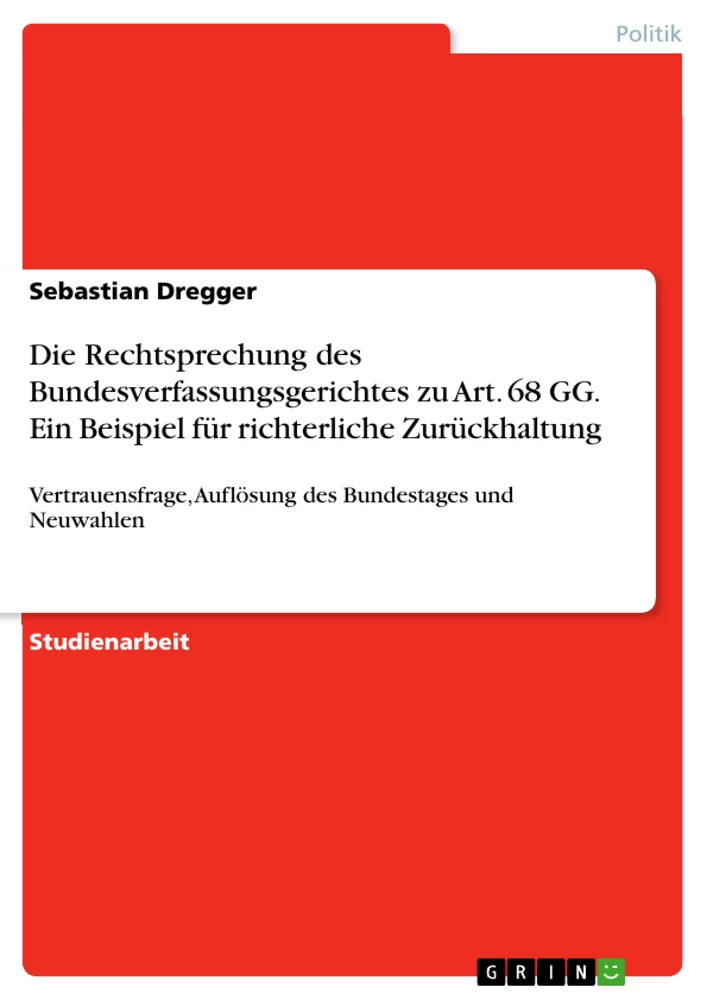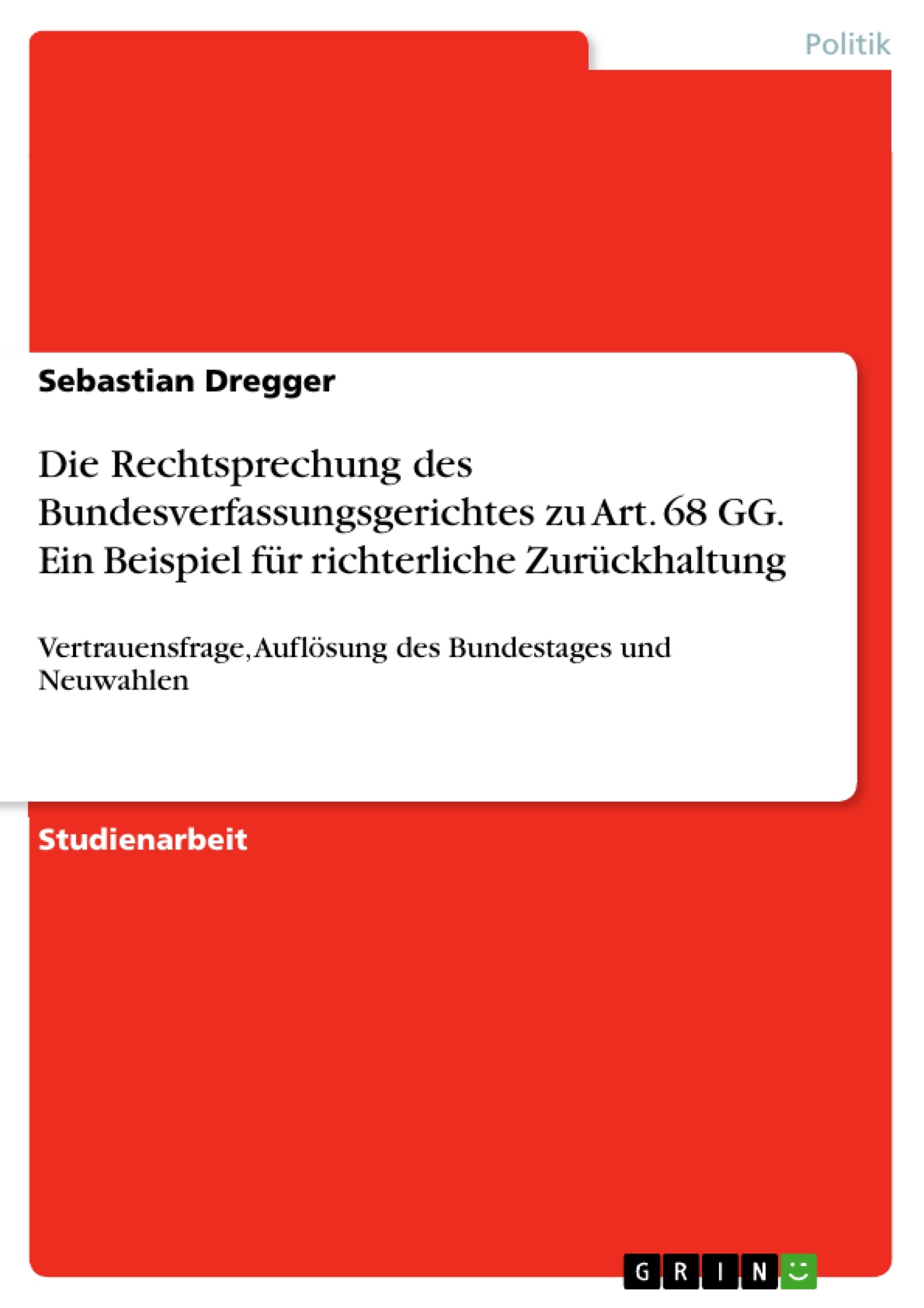Wie erklaert es sich, dass das Bundesverfassungsgericht bei den umstrittenen Vertrauensfragen 1982 und 2005 in seinen Urteilen ganz den Erwartungen des Bundeskanzlers, des Bundestages und des Bundespraesidenten folgte, obwohl der Fall der unechten fingierten Vertraunsfrage im Rahmen des Artikels 68 GG in der weit ueberwiegenden Verfassungslehre als verfassungswidrig abgelehnt wird? Schliesslich ging es dem Bundeskanzler und den ihm in dieser Angelegenheit verbuendeten politischen Kraeften offensichtlich nur darum, durch eine inszenierte Abstimmungsniederlage im Bundestag im Rahmen der Vertrauensfrage, einen Vorwand zu schaffen, um so den Bundestag vom Bundespraesidenten ausfloesen zu lassen und um so Neuwahlen herbeifuehren zu koennen. Um diesen bemerkenswerten Sachverhallt gerade vor dem Hintergrund einer aeusserst machtvollen Verfassungsgerichtsbarkeit, die fuer das politische System der Bundesrepublik kennzeichnend ist, aufzuklaeren, legt die Arbeit den Schwerpunkt auf zwei Faktoren, die die aussergewoehnliche richterliche Zurueckhaltung (judicial restraint) in diesem Fall erklaeren; naemlich einerseits der hohe verfassungsrechtliche Rang der Vertrauensfrage als Klagegegenstand. Dieser kennzeichnet sich dadurch, dass der Vertraunsfrage die direkte Willensbekundung dreier oberster Verfassungsorgane zugrunde liegt, ueber die sich das Bundesverfassungsgericht nicht einfach hinwegsetzen kann, wenn es nicht eine Staatskrise provozieren will. Um wieviel mehr Spielraum verfuegt das Gericht etwa, wenn es sich beim jeweiligen Klagegegenstand nur um einen Verwaltungsakt oder ein letztinstanzliches Gerichtsurteil handelt. Daneber gilt es als zweiten besonderen Faktor die Tatsache zu bedenken, dass die drei an der Vertrauensfrage direkt beteiligten Verfassungsorgane nicht untereiander zerstritten waren, sondern vielmehr 1982 wie auch 2005 einen einheitlichen festen Willen bei der Beurteilung des Artikels 68 kundtaten, was in Verfassungsstreitfragen die Ausnahme ist, wenn man etwa an die Kopftuchdebatte denkt, was aber zusaetzlich den Spielraum des Gerichtes erheblich einschraenkte. Ist man sich dieser Faktoren, zuzueglich der Prezedenzwirkung des Urteiles von 1983, bewusst, so kann man die billigenden Entscheidungen des BVerfG einerseits als pragmatisch betrachten; sie verdeutlichen aber auch angesicht der beschriebenen Faktoren die faktischen und realpolitischen Grenzen jeder Art der Verfassungsgerichtsbarkeit.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- A. Hinführung zum Thema
- B. Fragestellung und Vorgehensweise
- II. Hauptteil
- A. Die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in einem politischen System – zwischen Richterlichem Aktivismus (judicial activism) und Richterlicher Zurückhaltung (judicial restraint)
- B. Die Mitwirkung des Bundeskanzlers, des Bundestages und des Bundespräsidenten innerhalb der Systematik des Artikels 68 GG
- 1) Die Rolle des Bundeskanzlers innerhalb des Artikels 68 GG
- 2) Die Rolle des Parlamentes innerhalb des Artikels 68 GG
- 3) Die Rolle des Bundespräsidenten innerhalb des Artikels 68 GG
- C. Das Problem der fingierten unechten Vertrauensfrage
- 1) Die verfassungsrechtliche Problematik
- 2) Die Ansicht der Rechtswissenschaft zur Problematik fingierter unechter Vertrauensfragen
- a) Grammatische Auslegung
- b) Systematische Auslegung
- c) Historische Auslegung
- d) Teleologische Auslegung
- 1) Die Ansichten zur Vertrauensfrage am 17.12.1982
- a) Der Bundeskanzler
- b) Der Bundestag
- c) Der Bundespräsident
- 2) Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 16. Februar 1983
- a) Die Urteilsbegründung
- b) Kritik an der Urteilsbegründung
- 3) Die Ansichten zur Vertrauensfrage am 1.7.2005
- a) Der Bundeskanzler
- b) Der Bundestag
- c) Der Bundespräsident
- 4) Das Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 25.8.2005
- a) Die Urteilsbegründung
- b) Kritik an der Urteilsbegründung
- III. Fazit
- A. Der hohe verfassungsrechtliche Rang der Vertrauensfrage als Klagegegenstand
- B. Die einhellige Ansicht aller drei Verfassungsorgane zum Verfassungsstreit der unechten fingierten Vertrauensfrage
- C. Die Präzedenzwirkung des Urteils aus dem Jahre 1983
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 68 GG im Kontext der Vertrauensfrage, der Auflösung des Bundestages und der Neuwahlen. Sie analysiert, warum das Gericht richterliche Zurückhaltung (judicial restraint) an den Tag legte, anstatt die von der Staatsrechtswissenschaft kritisierte Praxis der fingierten unechten Vertrauensfrage als verfassungswidrig einzustufen. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der beteiligten Organe (Bundeskanzler, Bundestag, Bundespräsident) und die juristische Argumentation des Gerichts.
- Richterliche Zurückhaltung (judicial restraint) vs. Richterlicher Aktivismus (judicial activism)
- Verfassungsrechtliche Auslegung von Art. 68 GG
- Die Rolle der beteiligten Verfassungsorgane bei der Vertrauensfrage
- Analyse der Urteile des Bundesverfassungsgerichts von 1983 und 2005
- Der verfassungsrechtliche Rang der Vertrauensfrage
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie die überraschende Billigung der fingierten unechten Vertrauensfragen durch das Bundesverfassungsgericht in den Fällen Kohl (1982) und Schröder (2005) beschreibt. Die weitverbreitete Kritik in der Staatsrechtswissenschaft und Medien an dieser Praxis wird hervorgehoben. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die richterliche Zurückhaltung des Gerichts und die gewählte Vorgehensweise dar. Es wird der Zusammenhang zwischen dem verfassungsrechtlichen Rang des Klagegegenstandes und dem Ausmaß der richterlichen Zurückhaltung thematisiert.
II. Hauptteil: Dieser Abschnitt untersucht die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen richterlichem Aktivismus und Zurückhaltung. Er analysiert detailliert die Mitwirkung des Bundeskanzlers, des Bundestages und des Bundespräsidenten im Kontext von Art. 68 GG und erörtert das Problem der fingierten unechten Vertrauensfrage, einschließlich verschiedener Auslegungsmöglichkeiten (grammatisch, systematisch, historisch, teleologisch). Die Kapitel analysieren die Ereignisse und Perspektiven um die Vertrauensfragen von 1982 und 2005, einschließlich der Urteile des Bundesverfassungsgerichts und der darauf folgenden Kritikpunkte.
Schlüsselwörter
Art. 68 GG, Vertrauensfrage, Bundesverfassungsgericht, Richterliche Zurückhaltung (judicial restraint), Richterlicher Aktivismus (judicial activism), Bundeskanzler, Bundestag, Bundespräsident, Verfassungsrecht, Staatsrecht, Neuwahlen, Verfassungsgerichtsbarkeit, Rechtsauslegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 68 GG im Kontext der Vertrauensfrage
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 68 GG im Zusammenhang mit der Vertrauensfrage, der Auflösung des Bundestages und der damit verbundenen Neuwahlen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, warum das Gericht richterliche Zurückhaltung (judicial restraint) praktizierte, anstatt die kritisierte Praxis der fingierten unechten Vertrauensfrage als verfassungswidrig einzustufen.
Welche Rolle spielen die beteiligten Organe (Bundeskanzler, Bundestag, Bundespräsident)?
Die Arbeit untersucht detailliert die Mitwirkung des Bundeskanzlers, des Bundestages und des Bundespräsidenten im Kontext von Artikel 68 GG und deren Handlungen im Bezug auf die Vertrauensfragen von 1982 und 2005.
Was ist eine „fingierte unechte Vertrauensfrage“?
Die Arbeit beschreibt und analysiert das Problem der fingierten unechten Vertrauensfrage, also die strategische Nutzung der Vertrauensfrage, die nicht dem eigentlichen Zweck des Artikels 68 GG entspricht. Die verschiedenen juristischen Auslegungsmöglichkeiten (grammatisch, systematisch, historisch, teleologisch) werden erörtert.
Wie werden die Urteile des Bundesverfassungsgerichts von 1983 und 2005 behandelt?
Die Arbeit analysiert die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu den Vertrauensfragen von 1982 (Urteil vom 16. Februar 1983) und 2005 (Urteil vom 25. August 2005) detailliert, inklusive der Urteilsbegründungen und der darauf folgenden Kritik.
Welche Bedeutung hat der verfassungsrechtliche Rang der Vertrauensfrage?
Die Arbeit thematisiert den hohen verfassungsrechtlichen Rang der Vertrauensfrage als Klagegegenstand und den Zusammenhang zwischen diesem Rang und dem Ausmaß der richterlichen Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts.
Welche Methoden der Rechtsauslegung werden verwendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene Methoden der Rechtsauslegung, darunter die grammatische, systematische, historische und teleologische Auslegung, um die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu analysieren und zu bewerten.
Welchen Stellenwert haben Richterliche Zurückhaltung (judicial restraint) und Richterlicher Aktivismus (judicial activism)?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit im Spannungsfeld zwischen richterlicher Zurückhaltung und richterlichem Aktivismus und analysiert, warum das Gericht im Fall der fingierten unechten Vertrauensfrage Zurückhaltung praktizierte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Art. 68 GG, Vertrauensfrage, Bundesverfassungsgericht, Richterliche Zurückhaltung (judicial restraint), Richterlicher Aktivismus (judicial activism), Bundeskanzler, Bundestag, Bundespräsident, Verfassungsrecht, Staatsrecht, Neuwahlen, Verfassungsgerichtsbarkeit, Rechtsauslegung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Einleitung (Hinführung zum Thema, Fragestellung und Vorgehensweise), Hauptteil (Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit, Mitwirkung der Organe, Problem der fingierten unechten Vertrauensfrage, Analyse der Urteile von 1983 und 2005) und Fazit (hoher verfassungsrechtlicher Rang, einhellige Ansicht der Organe, Präzedenzwirkung des Urteils von 1983) gegliedert.
- Quote paper
- Sebastian Dregger (Author), 2007, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu Art. 68 GG. Ein Beispiel für richterliche Zurückhaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82580