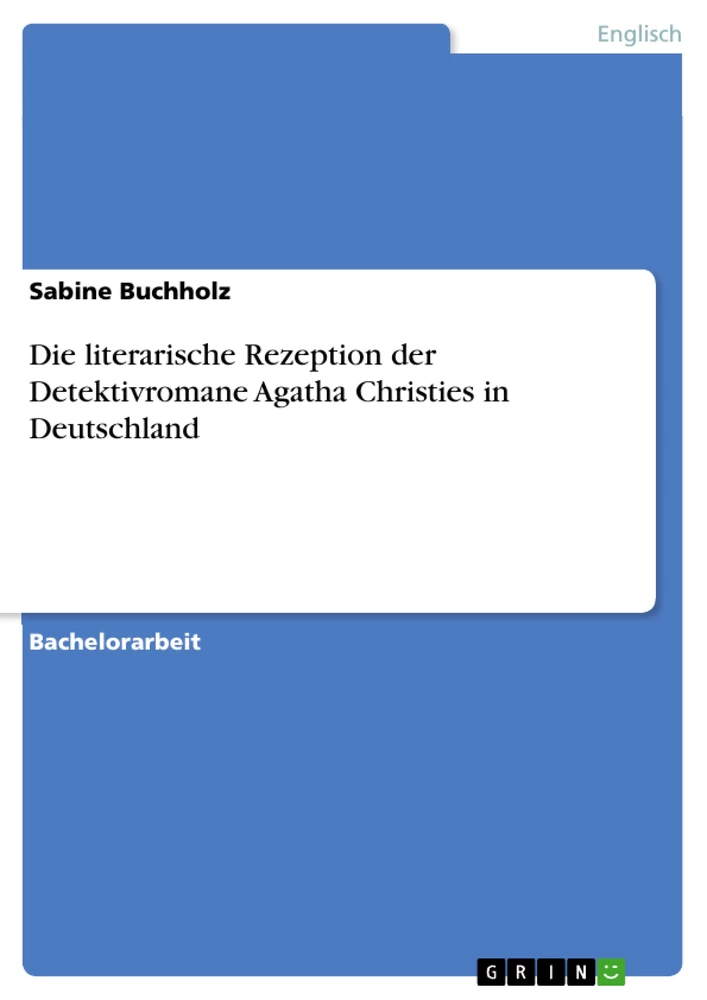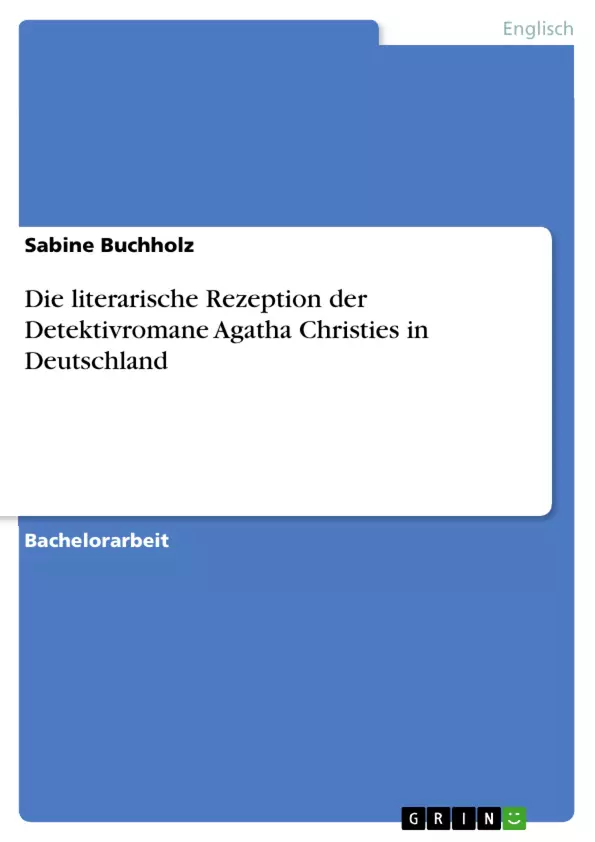Hinsichtlich des kriminalliterarischen Feldes fehlt der Name einer Autorin in keiner Gattungsstudie: Agatha Christie. Die literarische Rezeption ihrer rätselhaften Detektivromanen hat weltweit auf die Entwicklung der Kriminalliteratur-Szene eingewirkt, wurde daher bereits in zahlreichen Forschungsansätzen unter die Lupe genommen.
Im Zuge dieser Studie soll der Fokus nun auf den deutschsprachigen Raum und die bisherige Gesamtdauer der Rezeption – vom Zeitpunkt der Erstveröffentlichung in Übersetzung bis heute – verlagert werden: Wer liest bzw. las Christies Detektivgeschichten zu welcher Zeit aus welchen Gründen und mit welcher Wirkung? Welche Rezeptionsvorteile bietet die von Christie (mit-)entwickelte spezifische Werkstruktur?
Hieran knüpft sich außerdem die Fragestellung an, welche Auswirkungen die mediale Ausweitung des Christie'schen Werkes – vor allem in Richtung audio-visueller Medien – auf die Rezeptionssituation (gehabt) hat.
Und nicht nur die unmittelbaren Konsumenten haben Anteil an der werkgeschichtlichen literarischen Rezeption; ganz entscheidendend determiniert ein weiterer Faktor, inwiefern die literarischen Texte Verbreitung finden: die Distribution, vor allem durch zahlreiche Verlage. Wie hat sich der deutsche Vertrieb von und der Markt mit Christies Werken seit den ersten übersetzten Publikationen entwickelt? Welche Hinweise geben in diesem Kontext auch paratextuelle Anhaltspunkte (wie etwa divergente Einbandgestaltungen) auf Verkaufsstrategien der Verlage, auf ihre adressierte Leserschaften und damit auf die gesamte Rezeptionslandschaft?
Nicht zuletzt sollen die produktiven Rezipienten in Augenschein genommen werden: Hat Agatha Christies literarisches Schaffen Auswirkungen auf die (Fort-)Entwicklung einer deutschen Kriminalliteratur gehabt? Inwiefern greifen hiesige Autoren auf die Werke der englischen ‚Mentorin’ zurück, machen sich einerseits ihre Vorlagen zunutze und wandeln sie andererseits ab? Und welche evolutionären Einflüsse bergen zudem kritisch wertende Stimmen der Literaturwissenschaft auf die genrespezifische Rezeptions- und Produktionslandschaft?
All diese Bereiche beleuchtet die vorliegende Studie - wobei es sich freilich lediglich um theoretische Annäherungen mittels exemplarischer Analysen rezeptionsrelevanter Größen handeln kann, die nicht auf Vollständigkeit plädieren, sondern in erster Linie Anregungen liefern wollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitorische Einführungen
- 2.1. Rezeptionstheorien
- 2.2. Formen der Kriminalliteratur – ein gattungsästhetischer Abriss
- 2.3. Zur Theorie des Detektivromans
- 3. Christies Werk
- 3.1. Gattungsbezeichnungen
- 3.2. Christies formeller Rahmen
- 4. Zur Popularität der Christie-Rezeption: Belege und erste Ursachenanalyse
- 4.1. Paratextuelle Rezeptionssignale: Die Relevanz divergenter Verlagsausgaben
- 4.1.1. Einbandgestaltungen
- 4.1.2. Titel
- 4.2. Internationalität
- 4.3. Strukturorientierte Rezeptionsanalyse: Christie als intellektuelle Trainerin
- 5. Psychologisch determinierte Rezeptionsmotive: Christies „Gebrauchswert“
- 5.1. Leser und Bedürfnisse
- 5.2. Unterhaltungsliteratur
- 5.3. Spannung und Angstlust
- 5.4. Beruhigung
- 5.5. Exkurs 1: Spezifische Christie-Rezeption in der Nachkriegszeit
- 5.6. Exkurs 2: Besonderheiten der heutigen Christie-Rezeption
- 6. Zur medialen Ausweitung des Christieschen Werkes
- 6.1. Aktuelle Filmprojekte
- 6.2. Literaturverfilmungen: Möglichkeiten und Probleme
- 7. Die produktive Christie-Rezeption in Deutschland
- 7.1. Exemplarische Autorenanalyse: Sabine Deitmer – eine deutsche Autorin auf Christies Spuren?
- 7.2. Übertragung auf die aktuelle deutsche Krimi-Landschaft
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption von Agatha Christies Detektivromanen in Deutschland. Ziel ist es, die Gründe für die anhaltende Popularität von Christies Werken im deutschsprachigen Raum zu ergründen und deren Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Kriminalliteratur zu analysieren. Die Studie beleuchtet verschiedene Aspekte der Rezeption, von den Verkaufszahlen und Verlagsstrategien bis hin zu den psychologischen Motiven der Leser und dem Einfluss der Medienadaptionen.
- Die Popularität von Agatha Christie in Deutschland und die Faktoren, die diese erklären.
- Die Entwicklung der Rezeption von Agatha Christies Werken im Laufe der Zeit.
- Der Einfluss von Agatha Christie auf die deutsche Kriminalliteratur.
- Die Rolle von Verlagsstrategien und paratextuellen Elementen in der Rezeption.
- Psychologische und soziologische Aspekte der Leser-Autor-Beziehung im Kontext von Agatha Christie.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Kriminalliteratur als ein bedeutendes Genre vor und hebt Agatha Christies herausragende Stellung in diesem Bereich hervor. Sie führt in die Thematik der Studie ein, die sich mit der Rezeption von Christies Werken in Deutschland beschäftigt, und formuliert die zentralen Forschungsfragen: Wer liest Christies Romane, warum und mit welcher Wirkung? Welche Rolle spielen die Werkstruktur und die mediale Ausweitung?
2. Definitorische Einführungen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es bespricht relevante Rezeptionstheorien, unterschiedliche Formen der Kriminalliteratur und die Theorie des Detektivromans selbst, um ein solides Fundament für die nachfolgende Analyse zu schaffen. Die Bedeutung von empirischen Studien für die Weiterentwicklung theoretischer Ansätze wird betont.
3. Christies Werk: Hier wird Christies Werk selbst in den Blick genommen. Es werden Gattungsbezeichnungen und der spezifische formale Rahmen ihrer Romane untersucht, um das Verständnis für ihre Besonderheiten und ihren Erfolg zu vertiefen. Die Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse der Rezeption im Kontext dieser spezifischen Merkmale.
4. Zur Popularität der Christie-Rezeption: Belege und erste Ursachenanalyse: Dieses Kapitel analysiert die Popularität von Agatha Christie in Deutschland anhand konkreter Belege wie Verkaufszahlen, Verlagsausgaben und Übersetzungen. Es untersucht paratextuelle Elemente wie Einbandgestaltungen und Titel als Indikatoren für Verlagsstrategien und die adressierte Leserschaft. Die internationale Verbreitung und die Struktur von Christies Romanen als möglicher Erfolgsfaktor werden ebenfalls erörtert.
5. Psychologisch determinierte Rezeptionsmotive: Christies „Gebrauchswert“: Dieses Kapitel untersucht die psychologischen Motive, die Leser zum Lesen von Agatha Christie bewegen. Es beleuchtet die Aspekte von Unterhaltung, Spannung, Angstlust und Beruhigung, die im Werk der Autorin enthalten sind. Die Kapitel analysiert die Rezeption in unterschiedlichen historischen Kontexten, insbesondere in der Nachkriegszeit und der Gegenwart.
6. Zur medialen Ausweitung des Christieschen Werkes: Dieses Kapitel analysiert die mediale Ausweitung von Christies Werken, insbesondere durch Verfilmungen. Es untersucht aktuelle Filmprojekte und die Möglichkeiten und Probleme, die sich bei der Adaption ihrer Romane für das Kino ergeben. Es untersucht den Einfluss dieser Adaptionen auf die Rezeption der Romane.
7. Die produktive Christie-Rezeption in Deutschland: Das Kapitel analysiert den Einfluss von Agatha Christie auf die deutsche Kriminalliteratur. Es untersucht exemplarisch das Werk einer deutschen Autorin, die von Christie beeinflusst wurde, und betrachtet die Übertragung von Christies Stil und Themen auf die aktuelle deutsche Krimi-Landschaft.
Schlüsselwörter
Agatha Christie, Detektivroman, Kriminalliteratur, Rezeptionsforschung, Rezeptionstheorie, Lesermotive, Verlagsstrategie, Medienadaption, deutsche Kriminalliteratur, Popularität, Spannung, Unterhaltungsliteratur.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über die Rezeption von Agatha Christies Werken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Rezeption von Agatha Christies Detektivromanen im deutschsprachigen Raum. Sie analysiert die anhaltende Popularität ihrer Werke und deren Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Kriminalliteratur.
Welche Aspekte der Rezeption werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Rezeption, darunter Verkaufszahlen, Verlagsstrategien, paratextuelle Elemente (z.B. Einbandgestaltung, Titel), psychologische Lesermotive, mediale Adaptionen (Verfilmungen) und den Einfluss auf die aktuelle deutsche Kriminalliteratur.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Zentrale Fragen sind: Wer liest Christies Romane? Warum sind sie so populär? Welche Rolle spielen Werkstruktur und mediale Ausweitung? Welchen Einfluss hat Christie auf die deutsche Krimiszene?
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf relevante Rezeptionstheorien, analysiert verschiedene Formen der Kriminalliteratur und die Theorie des Detektivromans. Empirische Studien werden zur Unterstützung der theoretischen Ansätze herangezogen.
Wie wird die Popularität von Agatha Christie belegt?
Die Popularität wird anhand von Verkaufszahlen, Verlagsausgaben, Übersetzungen und der internationalen Verbreitung belegt. Paratextuelle Elemente wie Einbandgestaltungen und Titel werden als Indikatoren für Verlagsstrategien und die adressierte Leserschaft analysiert.
Welche psychologischen Motive der Leser werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die psychologischen Motive, die Leser zum Lesen von Agatha Christie bewegen, wie z.B. Unterhaltung, Spannung, Angstlust und das Bedürfnis nach Beruhigung. Die Rezeption in verschiedenen historischen Kontexten (Nachkriegszeit, Gegenwart) wird berücksichtigt.
Welche Rolle spielen mediale Adaptionen?
Die Arbeit untersucht die mediale Ausweitung von Christies Werken, insbesondere durch Verfilmungen. Sie analysiert aktuelle Filmprojekte und die Herausforderungen bei der Adaption ihrer Romane für das Kino, sowie den Einfluss dieser Adaptionen auf die Rezeption der Romane.
Welchen Einfluss hat Agatha Christie auf die deutsche Kriminalliteratur?
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Agatha Christie auf die deutsche Kriminalliteratur. Sie untersucht exemplarisch das Werk einer deutschen Autorin, die von Christie beeinflusst wurde, und betrachtet die Übertragung von Christies Stil und Themen auf die aktuelle deutsche Krimi-Landschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Agatha Christie, Detektivroman, Kriminalliteratur, Rezeptionsforschung, Rezeptionstheorie, Lesermotive, Verlagsstrategie, Medienadaption, deutsche Kriminalliteratur, Popularität, Spannung, Unterhaltungsliteratur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, definitorischen Einführungen (Rezeptionstheorien, Gattungen), Christies Werk, Popularität und Ursachenanalyse, psychologischen Rezeptionsmotiven, medialer Ausweitung, produktiver Rezeption in Deutschland und einem Fazit.
- Quote paper
- Sabine Buchholz (Author), 2005, Die literarische Rezeption der Detektivromane Agatha Christies in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82592