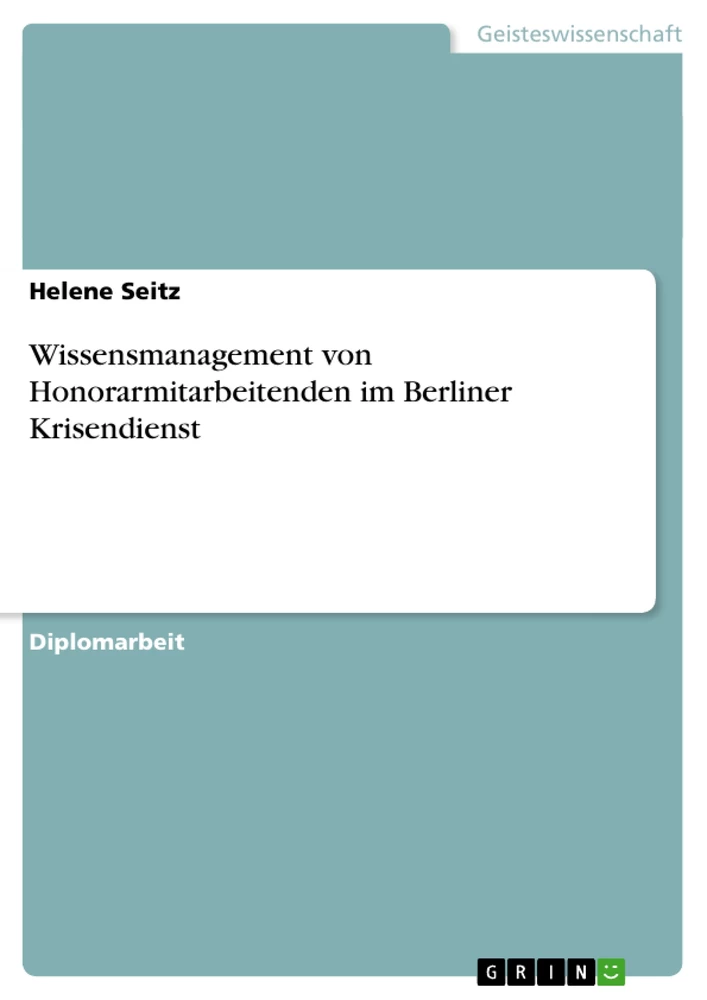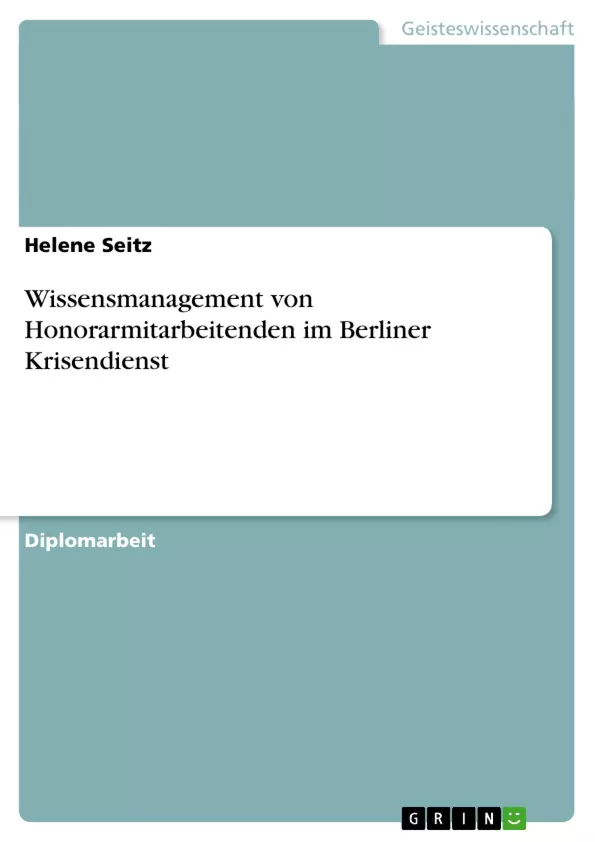Die Untersuchung beschäftigt sich mit der Frage, wie das Wissensmanagement von Honorarmitarbeitenden des Berliner Krisendienstes (BKD) aussieht. Gemeinnützige Organisationen wurden in der Forschung bislang kaum auf ihren Umgang mit Wissen hin beforscht, obwohl hier eine lange Tradition der Weiterentwicklung von Wissen, z. B. der Supervision, besteht. Die Honorarmitarbeiterinnen nehmen im BKD eine Sonderstellung ein, denn sie bestreiten einen Großteil der Klientinnenkontakte vor Ort; jede einzelne von ihnen hat jedoch nur ca. zwei Mal im Monat Dienst. Der BKD steht vor der besonderen Herausforderung, die ca. 40 Honorarmitarbeiterinnen pro Standort in den Wissensfluss innerhalb der Organisation mit einzubeziehen. Daher wurden vier Honorarmitarbeiterinnen mittels Experteninterviews zu ihrer Sicht auf das Wissen und dem Umgang mit ihm befragt. Die Interviews wurden transkribiert und in Anlehnung an die Grounded Theory von Strauss und Corbin (1996) mithilfe des theoretischen Kodierens ausgewertet. So entstanden die zwei übergeordneten Kategorien „Arbeitsrelevantes Wissen“ und „Strategien im Umgang mit arbeitsrelevantem Wissen“. Vier Positionen, die Honorarmitarbeiterinnen während ihres Dienstes im BKD einnehmen, erlauben die Einteilung des arbeitsrelevanten Wissens in vier unterschiedliche Kategorien. Dies sind die Positionen der Honorarmitarbeiterin, der Helferin, der Honorarkollegin sowie der Vertreterin des BKD. In allen diesen Rollen wird von einem bestimmten Gegenüber unterschiedliches Wissen verlangt. Strategien, die im Umgang mit arbeitsrelevantem Wissen angewandt werden, sind die Nutzung von Wissen, Wissenskommunikation, die Speicherung von Wissen und der Umgang mit fehlendem Wissen. Aus der Analyse der Texte geht hervor, dass theoretischem Wissen im Arbeitsalltag wenig Bedeutung beigemessen wird. Die Mitarbeiterinnen vertrauen auf ihr implizites Wissen. Sie betrauen insbesondere solche Kolleginnen mit fachlichen Fragen oder Informationen, zu denen sie ein Vertrauensverhältnis haben und die sie als zugehörig zu der eigenen Gruppe von Mitarbeiterinnen im Bereich psychosozialer Beratung wahrnehmen. Bei allen Maßnahmen des Qualitätsmanagements ist auf die begrenzten zeitlichen Ressourcen vor allem der Honorarmitarbeiterinnen zu achten.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Wissensmanagement im Kontext gemeinnütziger Organisationen
- Wissensmanagement im Kontext des Berliner Krisendienstes
- Individuelle Ebene des Wissens
- Methoden
- Datenerhebung
- Datenanalyse
- Ergebnisse
- Arbeitsrelevantes Wissen
- Strategien im Umgang mit arbeitsrelevantem Wissen
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht das Wissensmanagement von Honorarmitarbeitenden im Berliner Krisendienst (BKD) und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der besonderen Arbeitsweise dieser Mitarbeiterinnen ergeben. Dabei wird der Fokus auf die Identifizierung und Analyse von arbeitsrelevantem Wissen sowie der Strategien gelegt, die die Honorarmitarbeiterinnen im Umgang mit diesem Wissen anwenden.
- Analyse des Wissensbedarfs und der Wissensarten im Arbeitsalltag der Honorarmitarbeiterinnen
- Identifizierung von Strategien zur Wissensnutzung, -kommunikation und -speicherung
- Bewertung der Rolle von explizitem und implizitem Wissen im Arbeitskontext
- Bewertung der Bedeutung von sozialen Netzwerken und Gruppenzugehörigkeit für den Wissensfluss
- Entwicklung von Empfehlungen für ein effektives Wissensmanagement im BKD
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Wissensmanagement im Kontext des Berliner Krisendienstes ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung. Sie skizziert die Besonderheiten der Arbeitsweise von Honorarmitarbeiterinnen und die Herausforderungen, die sich daraus für das Wissensmanagement ergeben. Das Kapitel „Theoretischer Rahmen“ befasst sich mit theoretischen Ansätzen des Wissensmanagements und stellt bestehende Modelle sowie wichtige Konzepte vor. Die Kapitel „Methoden“ und „Ergebnisse“ beschreiben die Vorgehensweise bei der Datenerhebung und -analyse und präsentieren die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung. Dabei werden die Kategorien „Arbeitsrelevantes Wissen“ und „Strategien im Umgang mit arbeitsrelevantem Wissen“ im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Honorarmitarbeitende, psychosoziale Versorgung, Berliner Krisendienst, Arbeitsrelevantes Wissen, Strategien, explizites Wissen, implizites Wissen, soziale Netzwerke, Gruppenzugehörigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert das Wissensmanagement beim Berliner Krisendienst?
Da Honorarmitarbeiter nur selten Dienst haben, basiert der Wissensfluss stark auf informellen Netzwerken, Vertrauen und der Nutzung von implizitem Wissen.
Welche Arten von Wissen sind für die Krisenarbeit wichtig?
Unterschieden wird zwischen theoretischem (explizitem) Wissen und Erfahrungswissen (implizitem Wissen), wobei letzteres im Arbeitsalltag oft als bedeutender wahrgenommen wird.
Vor welchen Herausforderungen stehen Honorarkräfte im BKD?
Die geringe Dienstfrequenz (ca. zweimal im Monat) erschwert die Einbindung in den ständigen Informationsfluss der Organisation.
Welche Strategien nutzen Mitarbeiter bei fehlendem Wissen?
Sie greifen auf Wissenskommunikation mit vertrauten Kollegen zurück oder nutzen vorhandene Dokumentationssysteme zur Speicherung von Informationen.
Welche Rolle spielt die Gruppenzugehörigkeit?
Mitarbeiter tauschen Wissen bevorzugt mit Personen aus, zu denen sie ein Vertrauensverhältnis haben und die sie als Teil ihrer fachlichen Gruppe wahrnehmen.
- Quote paper
- Helene Seitz (Author), 2006, Wissensmanagement von Honorarmitarbeitenden im Berliner Krisendienst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82628