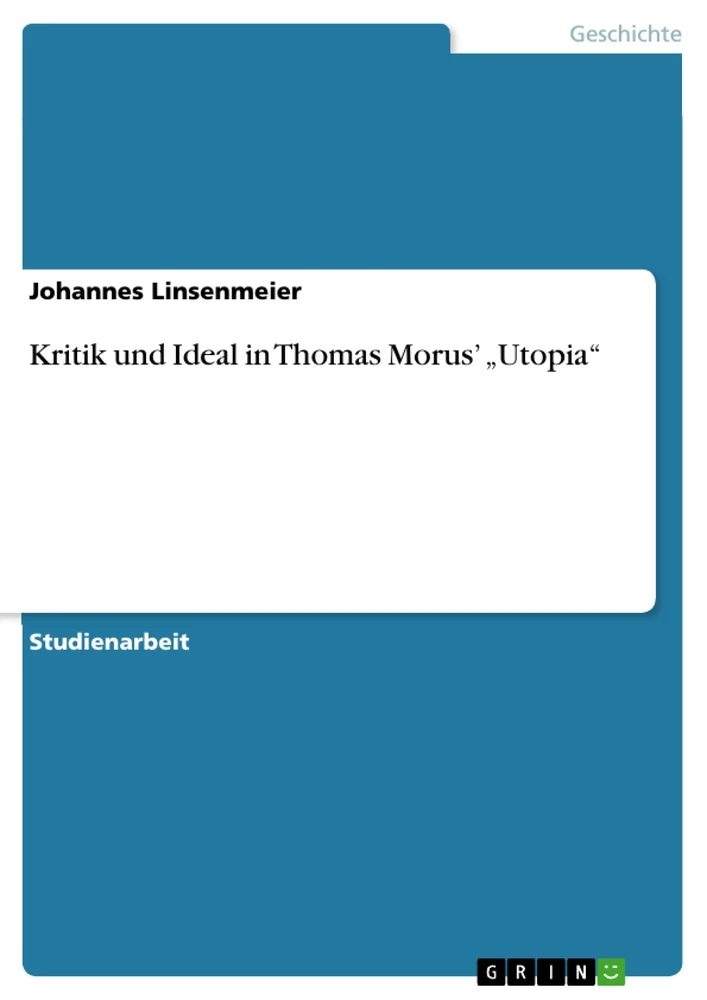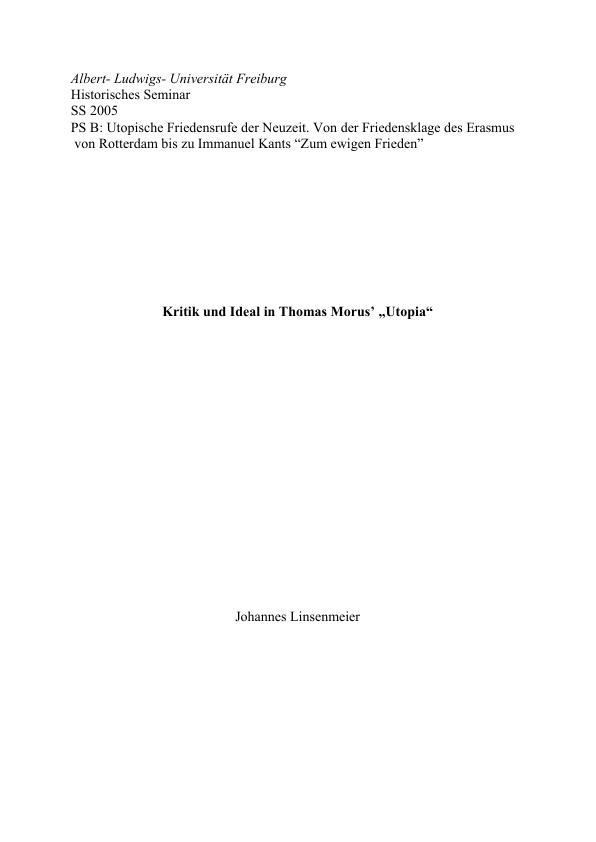Thomas Morus spielte mit seiner Schrift „Utopia“ ein große Rolle unter den Utopisten der frühen Neuzeit. Sein Werk stand am Anfang eines neuzeitlichen Bewusstseins. Durch seine Schrift prägte er auch den Begriff der Utopie, “ein konstruierter Idealzustand irdischer Verhältnisse und menschlicher Beziehungen.” [Schweikle, Günther und Irmgard (Hrsg.): Metzler-Literatur-Lexikon: Begriffe und Definitionen, Stuttgart ²1990, S. 482.] Als Vorbild diente ihm dafür Platons „Politeia“, das erste utopische Werk der Geschichte, genauso wie die Aufzeichnungen des Florentiner Seefahrers Amerigo Vespucci über seine Brasilienreise. Beide Einflüsse lassen sich in der „Utopia“ erkennen. [Vgl. Süssmuth, Hans: Studien zur Utopia des Thomas Morus. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des 16. Jahrhunderts, Münster 1967, S. 36-52.] Sie besteht aus zwei Büchern, in welchen sich Kritik am status quo des 16. Jahrhunderts und Ideal in Utopia gegenüberstehen. Auf diese Gegenüberstellung und das Verhältnis zur Realität der Verbesserungsvorschläge soll in dieser Arbeit anhand des Strafrechts, der Agrarpolitik, der Außenpolitik, der Finanz- und Rechtspolitik und des Privateigentums genauer eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Aufbau des ersten Buches der „Utopia“
- Das zweite Buch der „Utopia“ - optimus status rei publicae
- Gegenüberstellung von Kritik und Ideal
- Strafrecht
- Agrarpolitik
- Außenpolitik
- Finanzpolitik
- Privateigentum
- Die Auffassung des Morus
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Thomas Morus' „Utopia“ und untersucht das Verhältnis von Kritik am Status quo des 16. Jahrhunderts und dem in Utopia entworfenen Ideal. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung beider Aspekte anhand verschiedener gesellschaftlicher Bereiche.
- Kritik am englischen Strafrecht und ökonomischen Verhältnissen
- Das utopische Gesellschaftsmodell und seine Organisation
- Die Rolle von Privateigentum und Finanzpolitik in Utopia
- Der Vergleich der politischen Systeme und deren Auswirkungen
- Die literarische Gestaltung und die Intentionen des Autors
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung von Thomas Morus' „Utopia“ für die Utopie-Literatur der frühen Neuzeit. Sie benennt Platons „Politeia“ und Amerigo Vespuccis Reiseberichte als Vorbilder und erläutert das Ziel der Arbeit: die Gegenüberstellung von Kritik und Ideal in Morus' Werk anhand verschiedener gesellschaftlicher Bereiche wie Strafrecht, Agrarpolitik, Außenpolitik, Finanz- und Rechtspolitik sowie Privateigentum.
Der Aufbau des ersten Buches der „Utopia“: Dieses Kapitel analysiert den Aufbau des ersten Buches, welches im Gegensatz zu anderen Utopien nicht direkt mit der Beschreibung des Idealstaates beginnt. Stattdessen wird die Geschichte durch den fiktiven Erzähler Raphael Hythlodaeus vermittelt, der von seinen Reisen und seiner Kritik an den englischen Verhältnissen berichtet. Die Diskussion zwischen Hythlodaeus, Morus und Gilles dient der Einführung von Utopias Ideal und der Erzeugung von Interesse beim Leser. Der Name Hythlodaeus und die Erzählstruktur werden im Kontext von Morus’ Intentionen diskutiert, wobei die verschiedenen Interpretationsansätze beleuchtet werden.
Das zweite Buch der „Utopia“- optimus status rei publicae: Im Zentrum dieses Kapitels steht die Beschreibung Utopias im zweiten Buch. Es wird die Struktur des zweiten Buches, dessen Länge im Vergleich zum ersten Buch, und der sachliche, objektive Stil hervorgehoben. Die sechs Hauptabschnitte (Land, Stadt und Staat; Gesellschaft; Ethik, Erziehung und Wissenschaft; Zivilgesetzgebung; Militärwesen; Religion) werden benannt und bilden die Grundlage für die folgende Analyse der Gegenüberstellung von Kritik und Ideal.
Gegenüberstellung von Kritik und Ideal: Dieses Kapitel behandelt die Gegenüberstellung der englischen Realität und des utopischen Ideals in verschiedenen Bereichen. Es wird explizit das englische Strafrecht kritisiert, welches als zu grausam und unwirksam dargestellt wird. Die fehlende Berücksichtigung der sozialen Ursachen für Kriminalität (z.B. Arbeitslosigkeit, Armut) wird als Hauptkritikpunkt genannt. Raphael Hythlodaeus plädiert für eine ganzheitlichere Betrachtung der Ursachen und eine sozialgerechtere Lösung des Problems. Die folgenden Unterkapitel (Agrarpolitik, Außenpolitik, Finanzpolitik, Privateigentum) würden im vollständigen Text weitere Bereiche der Gegenüberstellung beleuchten.
Schlüsselwörter
Thomas Morus, Utopia, Utopie, Kritik, Ideal, Strafrecht, Agrarpolitik, Außenpolitik, Finanzpolitik, Privateigentum, Frühe Neuzeit, 16. Jahrhundert, England, Gesellschaftskritik, Idealstaat, literarische Utopie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Thomas Morus' "Utopia"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Thomas Morus' "Utopia" und untersucht das Verhältnis von Kritik am Status quo des 16. Jahrhunderts und dem in Utopia entworfenen Ideal. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung beider Aspekte anhand verschiedener gesellschaftlicher Bereiche wie Strafrecht, Agrarpolitik, Außenpolitik, Finanz- und Rechtspolitik sowie Privateigentum.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kritik am englischen Strafrecht und den ökonomischen Verhältnissen, das utopische Gesellschaftsmodell und seine Organisation, die Rolle von Privateigentum und Finanzpolitik in Utopia, den Vergleich der politischen Systeme und deren Auswirkungen sowie die literarische Gestaltung und die Intentionen des Autors.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, dem Aufbau des ersten Buches von "Utopia", dem zweiten Buch (optimus status rei publicae), einer Gegenüberstellung von Kritik und Ideal in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen (Strafrecht, Agrarpolitik, Außenpolitik, Finanzpolitik, Privateigentum), der Auffassung des Morus und einem Schluss. Zusätzlich werden Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel bereitgestellt.
Was ist der Inhalt des ersten Buches von "Utopia"?
Das erste Buch beschreibt nicht direkt den Idealstaat, sondern vermittelt die Geschichte durch den fiktiven Erzähler Raphael Hythlodaeus, der von seinen Reisen und seiner Kritik an den englischen Verhältnissen berichtet. Die Diskussion zwischen Hythlodaeus, Morus und Gilles dient der Einführung von Utopias Ideal und der Erzeugung von Interesse beim Leser. Der Name Hythlodaeus und die Erzählstruktur werden im Kontext von Morus’ Intentionen diskutiert.
Was wird im zweiten Buch von "Utopia" beschrieben?
Das zweite Buch beschreibt den Idealstaat Utopia. Es wird die Struktur des zweiten Buches, dessen Länge im Vergleich zum ersten Buch, und der sachliche, objektive Stil hervorgehoben. Die sechs Hauptabschnitte (Land, Stadt und Staat; Gesellschaft; Ethik, Erziehung und Wissenschaft; Zivilgesetzgebung; Militärwesen; Religion) bilden die Grundlage für die Analyse der Gegenüberstellung von Kritik und Ideal.
Wie wird die Kritik am englischen System dargestellt?
Die Arbeit kritisiert explizit das englische Strafrecht als zu grausam und unwirksam. Die fehlende Berücksichtigung der sozialen Ursachen für Kriminalität (z.B. Arbeitslosigkeit, Armut) wird als Hauptkritikpunkt genannt. Raphael Hythlodaeus plädiert für eine ganzheitlichere Betrachtung der Ursachen und eine sozialgerechtere Lösung des Problems. Weitere Bereiche der Gegenüberstellung (Agrarpolitik, Außenpolitik, Finanzpolitik, Privateigentum) werden in der vollständigen Arbeit behandelt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Thomas Morus, Utopia, Utopie, Kritik, Ideal, Strafrecht, Agrarpolitik, Außenpolitik, Finanzpolitik, Privateigentum, Frühe Neuzeit, 16. Jahrhundert, England, Gesellschaftskritik, Idealstaat, literarische Utopie.
Welche Quellen werden in der Arbeit erwähnt?
Die Einleitung nennt Platons "Politeia" und Amerigo Vespuccis Reiseberichte als Vorbilder für Morus' "Utopia".
- Quote paper
- Johannes Linsenmeier (Author), 2005, Kritik und Ideal in Thomas Morus’ „Utopia“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82702