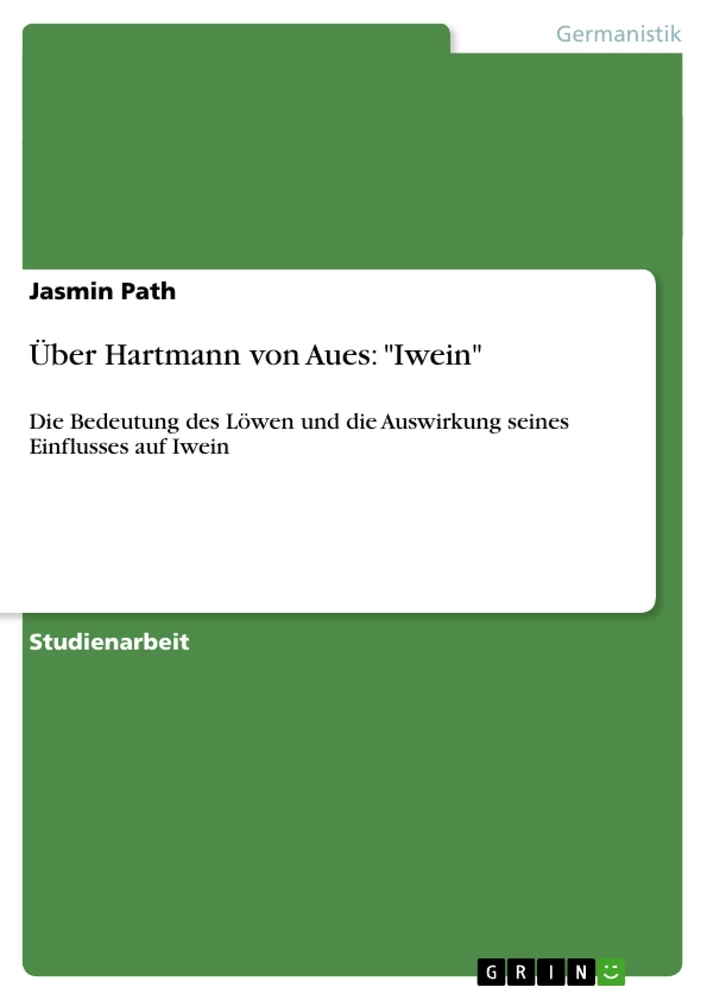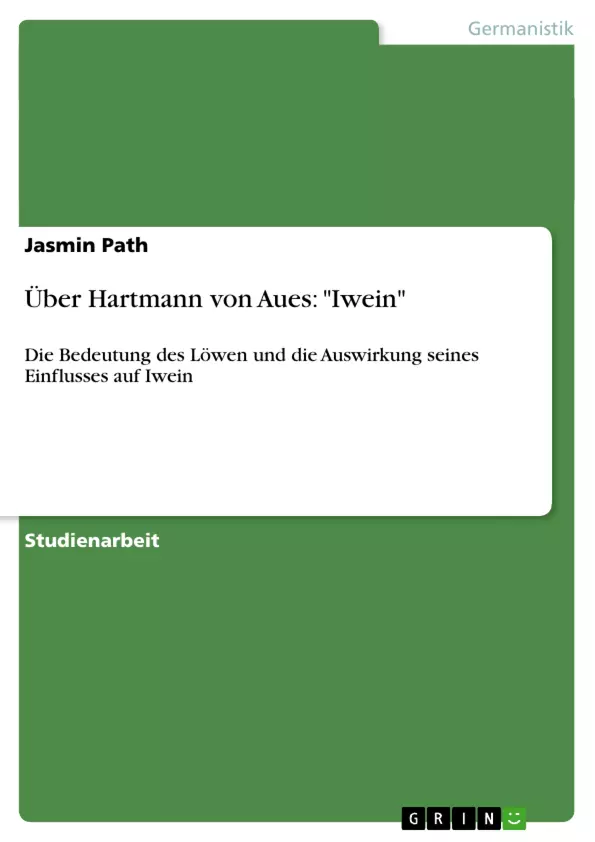Stark, eigenwillig, frei, gnädig, klug, mutig, wild, zugleich ruhig, tugendhaft, ehrenvoll,
streng, großherzig, demütig. – Eigenschaften, die dem Löwen zukommen, und seit frühesten Zeiten, lange noch vor der Blütezeit des Löwenvergleichs im Mittelalter oder gar Anspielungen und Verbildlichungen in biblischen Erzählungen, bestanden und bis heute ihre Bedeutung nicht verloren haben. „Der König der Tiere“1 war, ist und bleibt Symbol (überwiegend) guter Merkmale, wonach der Mensch streben sollte. Nicht sonderlich verwunderlich scheint es somit, dass die Metapher des Löwen weit verbreitet war – heute ebenfalls noch ist, wenn auch in geringerem Ausmaß – und deren Anwendung auf eine Person, vorwiegend Herrscher, Ritter und Helden,
jene mit Ruhm und Ehre schmückte. Auf eine nicht zu zählende Masse an Werken vom Löwen zum Löwenvergleich bis hin zur Verwandlung eines Menschen in einen Löwen und umgekehrt, lässt sich in unserer heutigen Zeit zurückblicken. Ein epochenübergreifendes Thema, das im Mittealter, speziell im Frühmittelalter, seinen Höhepunkt und seine größte Entfaltung2 erfuhr, was an dem darauf folgenden Wandel von Naturdeutung zur objektiven Naturkunde zu belegen sein mag3. Zu den bedeutendsten und somit auch „entscheidenden Werke[n]“4 dieser „von Löwen behafteten“ Zeit gehört Chrétiens de Troyes „Yvain ou le chevalier au Lion“ oder aber, um welche Erzählung es sich hier handeln wird, die Übersetzung Hartmanns von Aue „Iwein“. Jener Löwe, der lediglich im Titel des französischen Originals erwähnt wird, im
mittelhochdeutschen „Iwein“ dennoch keineswegs in Vergessenheit gerät, im Gegenteil sogar mehr Menschlichkeit und Symbolik erfährt als bei Chrétien, – derselbe, der den gesamten zweiten Handlungsstrang des Werks bestimmt – wird im Licht einiger Interpretationstheorien – wie z.B. der von Milnes, Harris, Cramer – betrachtet und darf als zentrales Thema dieser Ausarbeitung gesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Löwe
- Verständnis des Löwen im Mittelalter
- Symbolik des Löwen im „Iwein“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit der Symbolik des Löwen im mittelhochdeutschen Epos „Iwein“ von Hartmann von Aue. Ziel ist es, den Löwen als zentrales Thema des Werks zu analysieren und seine Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Kultur zu beleuchten.
- Die Bedeutung des Löwen als Symbolfigur im Mittelalter
- Die Rolle des Löwen im „Iwein“ und seine Verbindung zum Drachen
- Die christliche Interpretation des Löwen im „Iwein“
- Die Bedeutung der Fabel vom dankbaren Löwen im Kontext des „Iwein“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die vielschichtige Bedeutung des Löwen als Symbolfigur in verschiedenen Kulturen und Epochen. Sie stellt fest, dass der Löwe im Mittelalter als Sinnbild für positive Eigenschaften wie Stärke, Mut und Gerechtigkeit galt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Verständnis des Löwen im Mittelalter. Es werden die einflussreichen Medien des Physiologus und der Bibel als wichtige Quellen für die Symbolik des Löwen betrachtet. Der Physiologus, eine Sammlung von Tierbeschreibungen mit allegorischen Deutungen, verstand es, den Löwen mit Christus zu assoziieren. Das zweite Kapitel geht dann auf die Symbolik des Löwen im „Iwein“ ein. Der Kampf des Löwen mit einem Drachen wird als Symbol für den Kampf zwischen Gut und Böse interpretiert. Der Löwe verkörpert dabei die edlen Werte, während der Drache die personifizierte Bosheit darstellt.
Schlüsselwörter
Mittelalter, „Iwein“, Hartmann von Aue, Symbolik, Löwe, Drache, Physiologus, Bibel, Christentum, Allegorie, Moral, Ritter, Herrscher, Tugend, edelen tiere, virtutes.
Häufig gestellte Fragen
Welche Symbolik hat der Löwe im Epos "Iwein"?
Der Löwe verkörpert edle ritterliche Tugenden wie Mut, Treue und Gerechtigkeit. Er wird zum ständigen Begleiter Iweins und bestimmt den gesamten zweiten Handlungsstrang des Werks.
Was bedeutet der Kampf zwischen Löwe und Drache?
Dieser Kampf wird allegorisch als das Ringen zwischen Gut (Löwe) und Böse (Drache) interpretiert, wobei der Löwe oft auch als Christus-Symbol gedeutet wird.
Welchen Einfluss hatte der "Physiologus" auf das Löwenbild?
Der Physiologus war ein zentrales Werk des Mittelalters, das Tierbeschreibungen christlich deutete und den Löwen aufgrund seiner Stärke und Gnade mit Christus assoziierte.
Wie unterscheidet sich Hartmanns "Iwein" von Chrétiens Original?
Bei Hartmann von Aue erfährt der Löwe mehr Menschlichkeit und Symbolik als in der französischen Vorlage "Yvain ou le chevalier au Lion".
Warum war der Löwenvergleich im Mittelalter so populär?
Der Löwe galt als "König der Tiere" und war das ideale Symbol für Herrscher und Ritter, um deren Ruhm, Ehre und Tugendhaftigkeit zu unterstreichen.
- Citation du texte
- Jasmin Path (Auteur), 2006, Über Hartmann von Aues: "Iwein", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82780