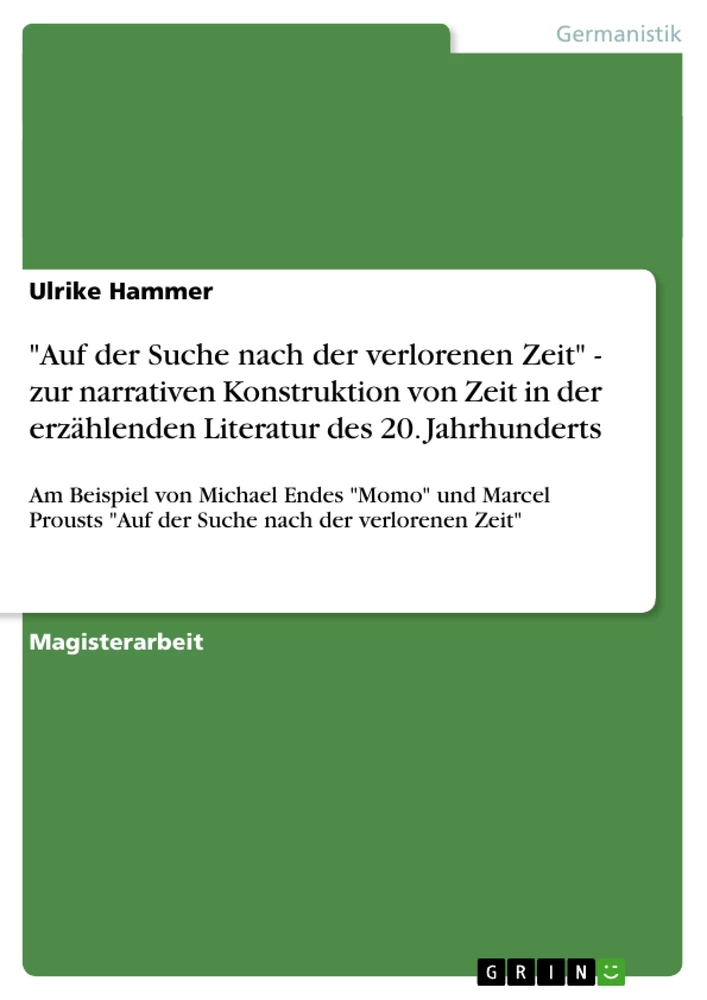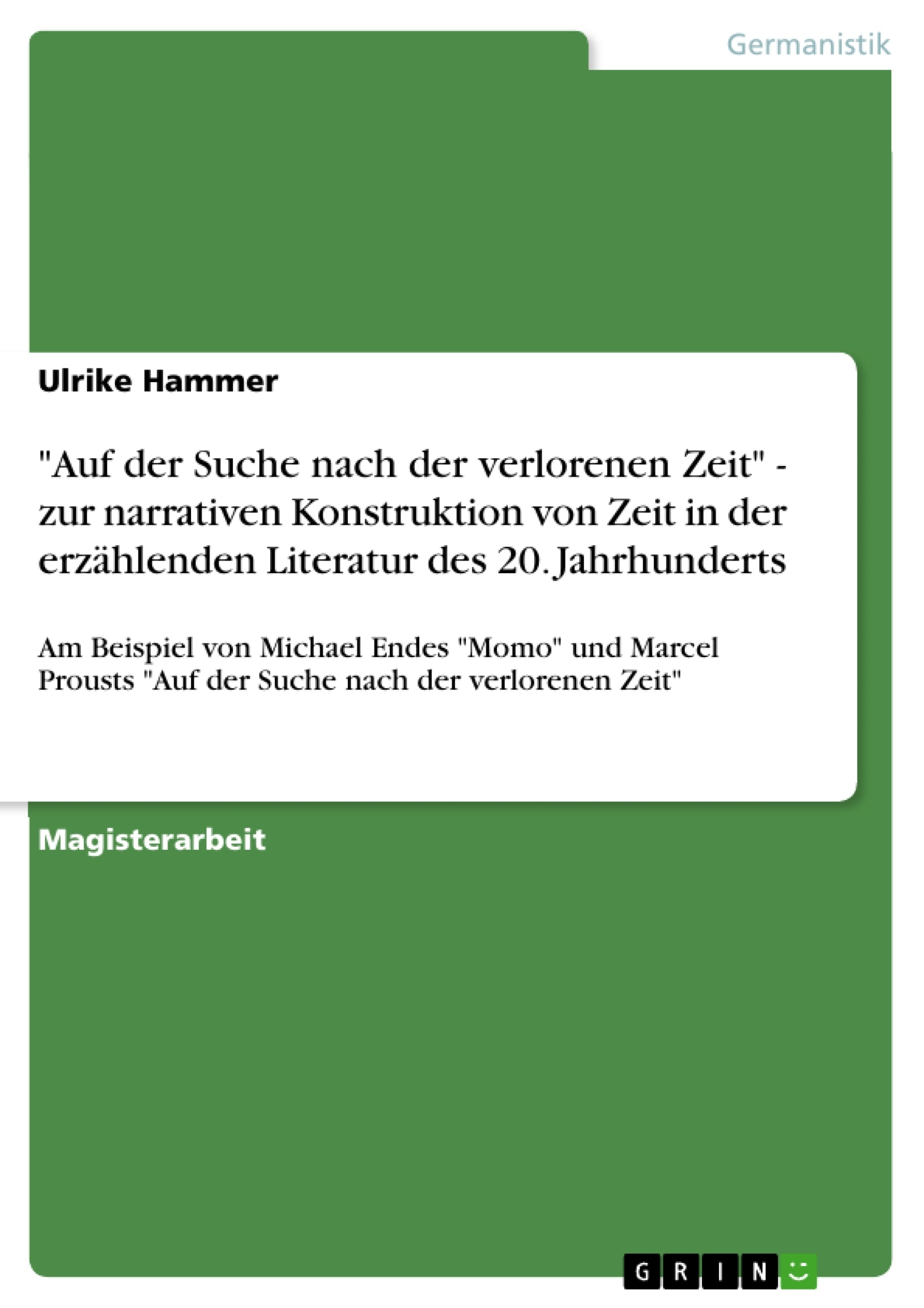In der vorliegenden Arbeit werden die beiden Romane Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust und Momo von Michael Ende, hinsichtlich der in ihnen enthaltenen narrativen Zeitstrukturen untersucht. Da Zeit nicht nur inhaltlich wichtig ist, sondern auch auf formaler Ebene eine große Rolle spielt, teilen sich die folgenden Analysen in jeweils zwei Teile auf. Im ersten Teil wird die Zeit der Erzählungen auf formaler Ebene untersucht. Im darauffolgenden Teil wird die Zeitmotivik der Erzählungen auf der inhaltlichen Ebene untersucht. Der Umgang mit dem Motiv ‚Zeit’ zeigt sich in vielfältiger Form. Innerhalb dieser Arbeit ist jedoch nur eine Berücksichtigung spezieller und wichtiger Aspekte möglich. Anhand der hier vorgestellten und analysierten Romane und der in ihnen enthaltenen Zeitstrukturen soll überprüft werden, ob und inwieweit der Verlust von Zeit auf unterschiedlichen Ebenen beschrieben und auf welche Weise er dargestellt wird.
Die Zeit zeigt sich für den Menschen als eine grundsätzliche Bedingung für Wirklichkeits- und Selbstwahrnehmung. Folgt man Immanuel Kant (1724-1804), so stellt sich Zeit als reine Form der sinnlichen Anschauung dar: „Die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbsten nicht aufheben, ob man zwar ganz wohl die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit ist also a priori gegeben. In ihr allein ist alle Wirklichkeit der Erscheinungen möglich.“
In Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit geht es um das ‚eigentliche’ Wesen der Dinge, der Gewohnheiten und der alltäglichen Ereignisse, die hinter ihnen verborgene Wahrheit der Welt, die dem Erzähler den Weg in seine Erinnerung eröffnet. Durch das Wiederbeleben der Vergangenheit wird der naturwissenschaftliche Zeitbegriff grundlegend in Frage gestellt und diesem eine ‚innere Zeitlichkeit’ entgegengesetzt.
In Michael Endes Momo wird eine besondere Darstellung der Zeit auf inhaltlicher Ebene gezeigt: „"Momo" offenbart auf naive, meditative, lyrische Weise Wahrheiten, die uns alle angehen: die Tragödie unseres neurotischen Seinsverlustes im Zusammenhang mit der entsetzlichen Tatsache, dass wir ‚keine Zeit mehr haben’.“
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
- 1. Hintergrund zu Leben und Werk
- 2. Inhalt
- 2.1 Stil und Entwicklung der Recherche
- 2.2 Handlung
- 3. Narrative Zeitstrukturen
- 3.1 Formale Ebene
- 3.1.1 Ordnung
- 3.1.2 Dauer
- 3.1.3 Frequenz
- 3.2 Inhaltliche Ebene
- 3.2.1 Die Erinnerung
- 3.2.2 Die wiedergefundene Zeit
- 3.1 Formale Ebene
- III. Michael Endes Momo - oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte
- 1. Hintergrund zu Leben und Werk
- 2. Inhalt
- 2.1 Endes poetisches Konzept
- 2.2 Handlung
- 2.3 Exkurs: Ist Momo ein Märchen?
- 3. Narrative Zeitstrukturen
- 3.1 Formale Ebene
- 3.1.1 Ordnung
- 3.1.2 Dauer
- 3.1.3 Frequenz
- 3.2 Inhaltliche Ebene
- 3.2.1 Herzenszeit
- 3.1 Formale Ebene
- IV. Zusammenfassende Beurteilung der analysierten Werke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die narrativen Zeitstrukturen in Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ und Michael Endes „Momo“. Ziel ist es, die formalen und inhaltlichen Aspekte der Zeitdarstellung in beiden Romanen zu analysieren und zu vergleichen. Dabei werden die von Gérard Genette definierten Kategorien Ordnung, Dauer und Frequenz herangezogen.
- Analyse der formalen Zeitstrukturen (Ordnung, Dauer, Frequenz) in beiden Romanen.
- Untersuchung der inhaltlichen Zeitmotivik, insbesondere des Themas „Verlust von Zeit“.
- Vergleich der unterschiedlichen Arten der Zeitdarstellung in Proust und Ende.
- Bedeutung der Erinnerung und ihrer Rolle in der Konstruktion von Zeit.
- Die Gegenüberstellung von objektiver und subjektiver Zeitwahrnehmung.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die auf die Analyse der narrativen Zeitstrukturen in Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ und Endes „Momo“ abzielt. Sie führt verschiedene Zeitkonzepte ein (Naturzeit, Lebenszeit etc.) und betont die Bedeutung von Zeit für Wirklichkeits- und Selbstwahrnehmung. Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor und skizziert den methodischen Ansatz, der auf der Unterscheidung zwischen formaler und inhaltlicher Ebene der Zeitdarstellung basiert, wobei die Genette'schen Kategorien Ordnung, Dauer und Frequenz eine zentrale Rolle spielen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie der Verlust von Zeit in beiden Romanen beschrieben und dargestellt wird.
II. Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: Dieses Kapitel analysiert Prousts Roman hinsichtlich seiner narrativen Zeitstrukturen. Es beginnt mit einem Überblick über Leben und Werk des Autors, bevor es auf den Inhalt, den Stil und die Handlung eingeht. Der Hauptteil des Kapitels befasst sich mit der Analyse der Zeitstrukturen auf formaler (Ordnung, Dauer, Frequenz) und inhaltlicher Ebene (Erinnerung, wiedergefundene Zeit). Die Analyse der formalen Ebene untersucht die spezifische Anordnung der Ereignisse, die Dauer ihrer Darstellung und die Häufigkeit ihrer Wiederholung. Die inhaltliche Ebene befasst sich mit der Bedeutung der Erinnerung und wie sie die subjektive Zeitwahrnehmung formt und die Konzeption von „verlorener Zeit“ prägt, wobei die „durée réelle“ im Vordergrund steht. Die Analyse zeigt, wie Proust die lineare Zeitauffassung aufbricht und eine subjektive, erlebte Zeit hervorhebt.
III. Michael Endes Momo - oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte: Dieses Kapitel wendet sich Michael Endes „Momo“ zu. Ähnlich wie im vorherigen Kapitel wird zunächst ein kurzer Überblick über Leben und Werk des Autors gegeben. Anschließend wird der Inhalt, das poetische Konzept und die Handlung des Romans zusammengefasst und die Frage nach dem Märchencharakter erörtert. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der narrativen Zeitstrukturen sowohl auf formaler (Ordnung, Dauer, Frequenz) als auch auf inhaltlicher Ebene (Herzenszeit). Die Analyse der formalen Ebene untersucht die narrative Ordnung, die Dauer der erzählten Ereignisse und ihre Frequenz. Der inhaltliche Teil konzentriert sich auf das zentrale Motiv der „Herzenszeit“ und wie sie im Kontrast zu der von den Zeitdieben gestohlenen Zeit steht. Der Roman wird als Allegorie interpretiert, die den Wert von Zeit und innerem Reichtum betont. Die Analyse beleuchtet, wie Ende durch märchenhafte Elemente die Bedeutung der Zeit für ein erfülltes Leben verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Narrative Zeitstrukturen, Marcel Proust, Michael Ende, Erinnerung, Zeitverlust, durée réelle, Herzenszeit, formale Ebene, inhaltliche Ebene, Gérard Genette, Ordnung, Dauer, Frequenz, literarische Zeitgestaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der narrativen Zeitstrukturen in Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" und Michael Endes "Momo"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die narrativen Zeitstrukturen in Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ und Michael Endes „Momo“. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der formalen und inhaltlichen Aspekte der Zeitdarstellung in beiden Romanen.
Welche Methode wird verwendet?
Die Analyse basiert auf den von Gérard Genette definierten Kategorien Ordnung, Dauer und Frequenz. Es wird zwischen der formalen Ebene (Ordnung der Ereignisse, Dauer ihrer Darstellung, Häufigkeit der Wiederholung) und der inhaltlichen Ebene (z.B. Erinnerung, Herzenszeit) unterschieden.
Welche Romane werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Marcel Prousts siebenteiligen Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ und Michael Endes Kinderroman „Momo - oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit untersucht, wie die Zeit formal und inhaltlich in den beiden Romanen dargestellt wird, wie der Verlust von Zeit beschrieben wird und wie sich die subjektive und objektive Zeitwahrnehmung in den Werken widerspiegelt. Es wird auch der Einfluss der Erinnerung auf die Zeitwahrnehmung analysiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, zwei Kapitel zur Analyse der jeweiligen Romane (Proust und Ende) und eine zusammenfassende Beurteilung. Jedes Kapitel umfasst eine Betrachtung des Hintergrunds zu Leben und Werk der Autoren, eine Inhaltsangabe sowie eine detaillierte Analyse der narrativen Zeitstrukturen auf formaler und inhaltlicher Ebene.
Was wird im Kapitel zu Proust analysiert?
Das Kapitel zu Proust analysiert die Zeitstrukturen auf formaler (Ordnung, Dauer, Frequenz) und inhaltlicher Ebene (Erinnerung, wiedergefundene Zeit). Es untersucht, wie Proust die lineare Zeitauffassung aufbricht und eine subjektive, erlebte Zeit hervorhebt, mit Fokus auf die "durée réelle".
Was wird im Kapitel zu Ende analysiert?
Das Kapitel zu Ende analysiert die Zeitstrukturen in "Momo" ebenfalls auf formaler und inhaltlicher Ebene (Herzenszeit). Es untersucht, wie Ende durch märchenhafte Elemente den Wert von Zeit und innerem Reichtum verdeutlicht und den Kontrast zwischen „Herzenszeit“ und der gestohlenen Zeit darstellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Narrative Zeitstrukturen, Marcel Proust, Michael Ende, Erinnerung, Zeitverlust, durée réelle, Herzenszeit, formale Ebene, inhaltliche Ebene, Gérard Genette, Ordnung, Dauer, Frequenz, literarische Zeitgestaltung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die zusammenfassende Beurteilung vergleicht die Ergebnisse der Analysen beider Romane und zieht Schlussfolgerungen über die unterschiedlichen Arten der Zeitdarstellung bei Proust und Ende. Sie fasst die Bedeutung der Erinnerung und der Gegenüberstellung von objektiver und subjektiver Zeitwahrnehmung zusammen.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Hammer (Autor:in), 2007, "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" - zur narrativen Konstruktion von Zeit in der erzählenden Literatur des 20. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82784