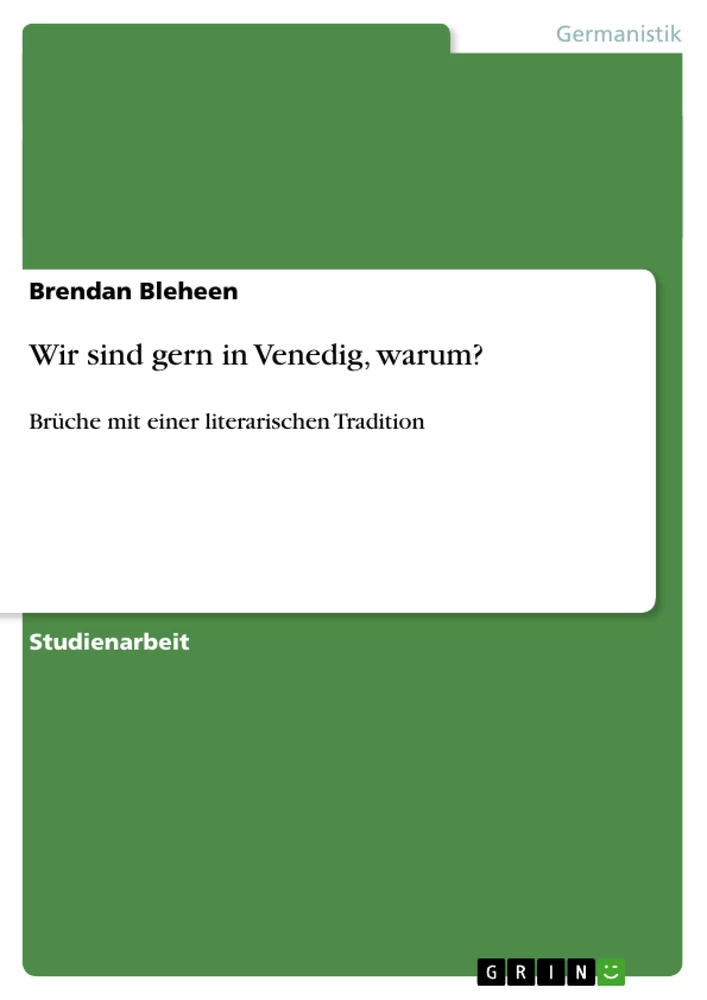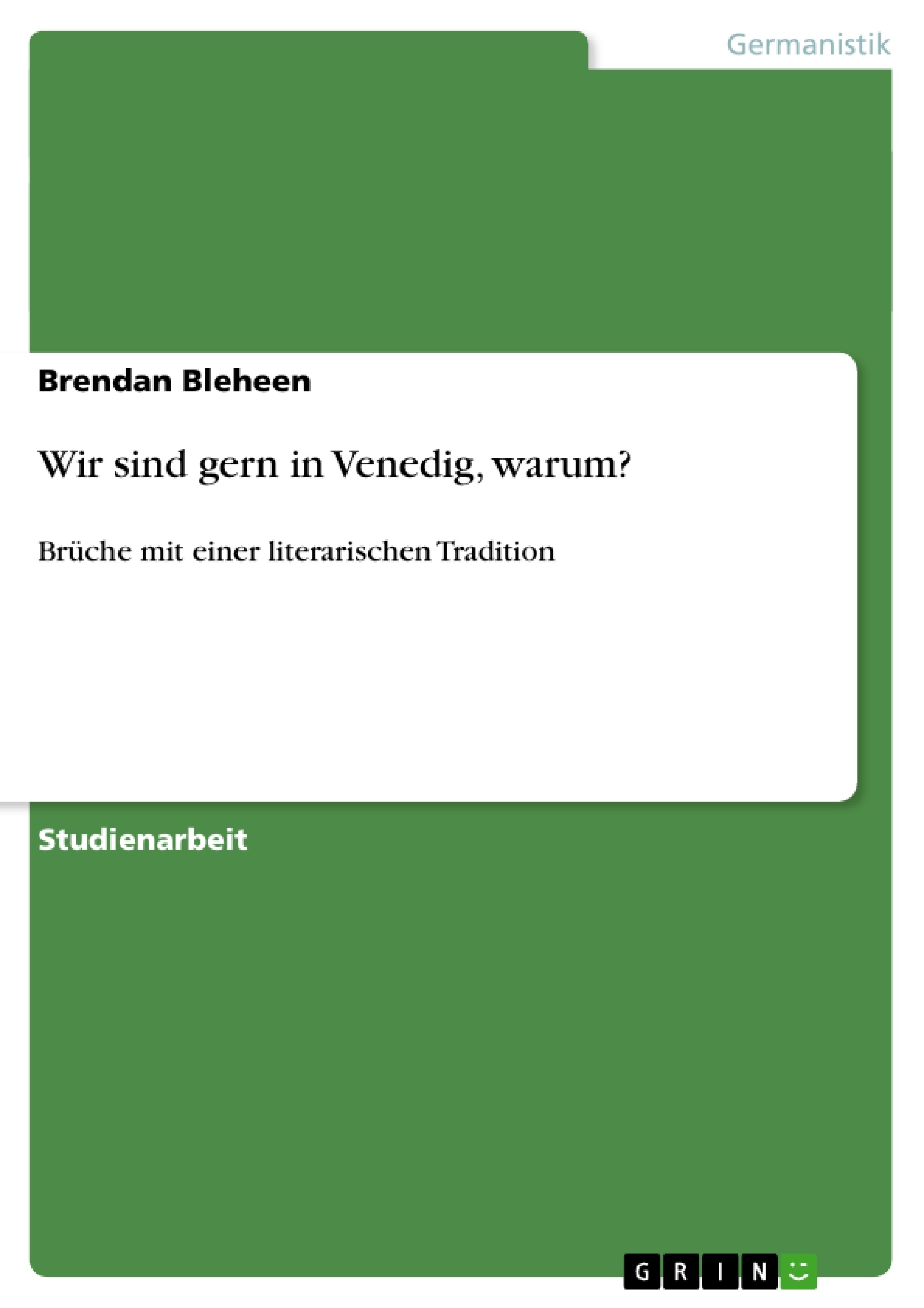Über kaum eine andere Stadt wurde so viel geschrieben wie über Venedig, vor allem im 18. und 19. Jahrhundert. Diese Beschreibungen prägen das Bild Venedigs in der Literatur und vor allem in der Werbung. Wie der französische Schriftsteller und Kulturtheoretiker Michel Butor feststellt, hinterließen die Venedig-„Reisenden (…) ihre Spuren in den Städten ihrer Pilgerfahrten“ (Butor, S. 43). Vor allem die englischen, deutschen und französischen Romantiker haben Venedig ihr eigen gemacht. So ist das Venedigbild heute noch stark von deren größtenteils idealisierenden Werken geprägt, obwohl der Zenit Venedigs selbst damals schon längst der Vergangenheit angehörte. Die Internationalität dieses Phänomens führt Sarter dazu, von einem Mythos im Sinne Barthes’ zu sprechen, der einer Wechselwirkung unterliegt:
„Die Berühmtheiten, die sich in Venedig aufgehalten haben, sind längst zum festen Bestandteil des Mythos geworden, wie sie andererseits an ihm mitgewirkt, ihn variiert und entwickelt haben. In ihnen scheint sich Venedig als Stadt der Kunst und der Künstler zu verkörpern; sie und ihre Werke laden die Stadt mit Bedeutungen auf, von denen wiederum zeitgenössische Künstler profitieren (…)“(Sarter, S. 15).
Für die Schriftsteller der Moderne und Postmoderne ist es also nahezu unmöglich, sich zu Venedig zu äußern, ohne zu ihren literarischen Vorgängern Position zu beziehen, wie von Pfister/Schaff festgestellt wird: “Writing Venice (…) means relating oneself to the rich intertextual background of Venetian fiction – shaping and interpreting culture” (Pfister/Schaff, S. 11). Selbst Shakespeare und andere Schriftsteller, die nie in Venedig waren, siedelten ihre Werke in der Lagunenstadt an. Die Stadt ist allen vertraut: „So sind auch Bilder Venedigs und ein Begriff der Stadt in der Vorstellung von Leuten, die dort noch nie waren, gleichzeitig präformieren und strukturieren sie das Reiseerlebnis von jenen, die die Stadt besuchen.“ (Sarter, S. 6). Angesichts dieser Fülle an Information fragt sich Sartre: “Nehme ich überhaupt wahr oder erinnere ich mich nur. Ich sehe, was ich weiß, oder besser gesagt, was schon ein anderer weiß“ (Sartre, S. 363). Die literarische Repräsentation Venedigs in der Moderne ist nicht unproblematisch. Schon Goethe beschrieb die Schwierigkeit, originelle Bilder für Venedig zu finden: „Von Venedig ist schon viel erzählt und gedruckt, dass ich mit Beschreibung nicht umständlich sein will“ (zit. nach Comi/Pontzen, S. 259).
Warum also heute noch über Venedig schreiben? Im zwanzigsten Jahrhundert dient die Stadt hauptsächlich als Kulisse für Unterhaltungs- bzw. Trivialromane. Dennoch hielten es Mann, Andersch und Koeppen noch für möglich, das Venedigbild zu verändern, in dem sie versuchen, der intertextuellen Landschaft neue Einsichten und Elemente hinzuzufügen. Genauso berechtigt wäre die Frage danach, warum man sich angesichts der beinahe unüberschaubaren Fülle an Sekundärliteratur zu Venedig-Texten heute noch mit diesem Themenbereich auseinandersetzt, vor allem nachdem er in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts fast zu einer Modeerscheinung geworden ist. Diese Arbeit, in der die Brüche mit und Fortschreibung dieser literarischen Tradition in den Werken dieser Autoren aufgezeigt werden sollen, will ebenfalls neue Einsichten zum Venedigbild in der Literatur bieten. Behandelt werden Manns Tod in Venedig, Anderschs Die Rote, sowie Koeppens Ich bin gern in Venedig warum.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Das Venedigbild in der Literatur
- Thomas Manns Tod in Venedig
- Aschenbach als Tourist
- Venedig und der südländische Lebensstil
- Tadzio und Venedig
- Alfred Anderschs Die Rote
- Franziskas antitouristische Haltung
- Das andere Venedig
- Rollentausch
- Wolfgang Koeppen: Ich bin gern in Venedig warum
- Gelesenes Venedig
- Das sich verändernde Venedig
- Reflexionen in der Spiegelstadt
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung Venedigs in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Sie untersucht, wie Thomas Mann, Alfred Andersch und Wolfgang Koeppen das Venedigbild in ihren Werken verändern und neu interpretieren. Die Arbeit analysiert, wie diese Autoren auf die bestehende literarische Tradition Venedigs reagieren und eigene Perspektiven auf die Lagunenstadt entwickeln.
- Die Transformation des Venedigbilds in der Moderne
- Der Einfluss der literarischen Tradition auf die Darstellung Venedigs
- Die Rolle des Tourismus und der antitouristischen Haltung in den Texten
- Die existenzielle Bedeutung Venedigs als Mikrokosmos der menschlichen Existenz
- Venedig als Ort der Begegnung mit dem Anderen, dem Fremden und dem Unheimlichen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt die Bedeutung Venedigs in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts dar und beleuchtet den Mythos der Stadt, der durch Werke von Romantikern und Reisenden geprägt wurde. Sie diskutiert die Herausforderung, Venedig in der Moderne neu zu interpretieren, da die Stadt bereits so oft beschrieben wurde.
- Das Venedigbild in der Literatur: Dieses Kapitel erörtert die wichtigsten Motive, die in der vormodernen Venedigliteratur dominieren. Es werden Aspekte wie die Insellage, das Labyrinth, die Kunst und Kultur sowie die Verbindung zum Wasser und zur Liebe beleuchtet.
- Thomas Manns Tod in Venedig: Die Analyse von Manns Novelle befasst sich mit Aschenbachs Reise nach Venedig und seinem Faszination für den jugendlichen Tadzio. Das Kapitel untersucht die Darstellung Venedigs als Ort der Verführung und des Verfalls.
- Alfred Anderschs Die Rote: Dieses Kapitel analysiert Franziskas Reise nach Venedig und ihre antitouristische Haltung gegenüber der Stadt. Es beleuchtet die Darstellung Venedigs als Ort der Enttäuschung und des Verlustes.
- Wolfgang Koeppens Ich bin gern in Venedig warum: Hier wird Koeppens Roman als ein Beispiel für ein modernes Venedigbild betrachtet. Das Kapitel fokussiert auf die Darstellung des sich verändernden Venedigs und die Reflexionen des Protagonisten über die Stadt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Venedigbild, Literatur, Moderne, Postmoderne, Thomas Mann, Alfred Andersch, Wolfgang Koeppen, Tod in Venedig, Die Rote, Ich bin gern in Venedig warum, Mythos, Touristen, Anti-Tourismus, Existentialismus, Mikrokosmos, Fremde, Unheimlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Venedig in der Literatur des 20. Jahrhunderts dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie Autoren wie Thomas Mann, Alfred Andersch und Wolfgang Koeppen das traditionelle, oft idealisierte Venedigbild dekonstruieren oder erweitern.
Was ist das zentrale Motiv in Thomas Manns „Tod in Venedig“?
Venedig wird hier als Ort der Verführung, des Verfalls und als Kulisse für Aschenbachs existenzielle Krise und Faszination für Tadzio dargestellt.
Welche Perspektive nimmt Alfred Andersch in „Die Rote“ ein?
Andersch thematisiert eine antitouristische Haltung und zeigt Venedig als Ort der Enttäuschung und des persönlichen Verlusts.
Warum ist es schwierig, heute noch „originell“ über Venedig zu schreiben?
Da Venedig durch die Romantik und den Massentourismus literarisch extrem vorbelastet ist, müssen sich moderne Autoren stets zum reichen intertextuellen Hintergrund positionieren.
Was bedeutet der „Mythos Venedig“ nach Roland Barthes?
Venedig wird als eine Stadt der Kunst und Künstler wahrgenommen, deren Bild durch die Werke berühmter Besucher ständig neu aufgeladen und variiert wird.
- Quote paper
- Brendan Bleheen (Author), 2004, Wir sind gern in Venedig, warum?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82799