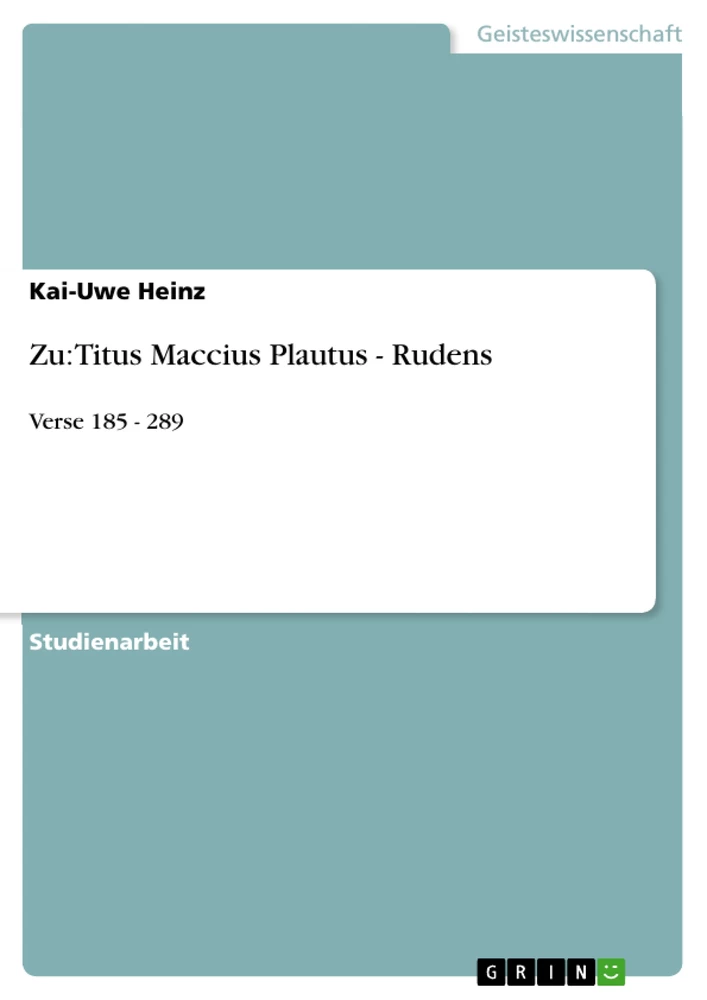„Homo linguae atque elegantiae in verbis latinae princeps“. Mit diesen Worten rühmt der Buntschriftsteller des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, A. Gellius, in seinen Noctes atticae den begnadeteten Komödienautor Titus Maccius Plautus. Doch dieses Lob blieb von vielen, vor allem der Nachwelt, ungeteilt. Viele verschmähten seine derbe Sprache, im Mittelalter stieß man sich an dem Obszönen, das vielen seiner Stücke anhaftete, und in der Moderne war man dem römischen Lustspielschreiber zunächst auch nicht wohler gesonnen. Plagiat und dazu noch schlechten warf man ihm von wissenschaftlicher Seite vor, die sich vor allem für die nur noch spärlich erhaltenen Vorlagen interessierte und den römischen Dichter nur noch als Überträger der griechischen Stücke sah, die seinen Komödien Modell standen. So konnte H. Diller über den Rudens-Ausleger G. Jachmann sagen: „Er begnügte sich bei der Besprechung dieser Partieen [sic] damit, das plautinische Unkraut aus dem kunstvoll angelegten Gärtlein des Diphilos auszujäten.“ Man ging soweit, Plautus eigenes künstlerisches Schaffen abzusprechen und seine Stücke nur noch als Flickwerk aus Teilen griechischer Originale zu sehen, bis 1922 E. Fraenkel die entscheidende Abhandlung „Plautinisches im Plautus“ verfaßte, die dem römischen Komödienschreiber mit Nachweis seiner Originalität und seines Verdienstes als eigenständiger Dichter wieder zu seinem Recht verhalf. Dadurch wurde die Diskussion um die Originalität des „bedeutendsten römischen Lustspielschreibers“ neu entfacht.
Im Rahmen dieser Hauptseminararbeit soll der Spagat Plautins Spagat zwischen griechischer und italischer Lustspieltradition aufgezeigt werden und neben einer Übersetzung und ausführlichen Interpretation auch auf sprachliche Phänomene der Textstelle eingegangen werden, die sprachwissenschaftlich diachron betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu Plautus' Leben und Werk
- Exkurs: Zum römischen Verständnis von Individualität und Stil
- Das Theater zur Zeit des Plautus
- Die griechische Komödie
- Die italische Lustspieltradition
- Die griechische Komödie in der Magna Graecia
- Die dorische Volksposse
- Der sizilische Mimus
- Die italische Phlyakenposse
- Die Fabula Atellana
- Rom und die italische Bühnentradition
- Der plautinische Spagat zwischen griechischer und italischer Lustspieltradition
- Die Textstelle
- Die Personen
- Die Textstelle und ihre Situierung
- Übersetzung
- Szene 1, Aufzug 3
- Szene 1, Aufzug 4
- Szene 1, Aufzug 5
- Interpretation
- Der Monolog Palaestras
- Eine untypische Wiedererkennungsszene
- Zuflucht bei der Priesterin
- Sprachliche Phänomene der Textstelle
- Graphie
- Phonologie
- Morphologie
- Syntax
- Lexik
- 192 „me impiavi“
- 266,,longule“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, Plautus' Komödie Rudens im Kontext der römischen Theatertradition zu analysieren, insbesondere die Textstelle in den Versen 185-289. Dabei wird die Rolle der griechischen Komödie, der italischen Lustspieltradition und Plautus' eigener künstlerischer Gestaltung beleuchtet.
- Die Einbindung griechischer Elemente in die römische Komödie
- Die Bedeutung der italischen Lustspieltradition für Plautus' Werk
- Plautus' sprachliche Eigenheiten in der Textstelle
- Die Analyse der Figuren und der Handlung in der ausgewählten Szene
- Die Interpretation der Wiedererkennungsszene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über Plautus' Leben und Werk sowie das römische Verständnis von Originalität und Stil. Das zweite Kapitel beleuchtet das Theater zur Zeit des Plautus, mit Fokus auf die griechische und italische Komödie. Das dritte Kapitel befasst sich mit der ausgewählten Textstelle und deren Personen. Das vierte Kapitel liefert die Übersetzung der Szene. Kapitel 5 bietet eine detaillierte Interpretation der Szene, während Kapitel 6 auf sprachliche Phänomene der Textstelle eingeht. Der Schluss fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Römische Komödie, Plautus, Rudens, griechische Komödie, italische Lustspieltradition, Originalität, Stil, Wiedererkennungsszene, sprachliche Analyse, Plautinische Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Titus Maccius Plautus?
Plautus war der bedeutendste römische Lustspielschreiber. Lange Zeit wurde er als bloßer Übersetzer griechischer Vorlagen unterschätzt, bis die Forschung seine eigenständige künstlerische Originalität bewies.
Worum geht es in der Komödie „Rudens“?
Die Arbeit analysiert insbesondere die Verse 185-289. Themen sind die Flucht der Protagonistin Palaestra, eine untypische Wiedererkennungsszene und die Zuflucht bei einer Priesterin.
Was ist der „plautinische Spagat“?
Damit ist die Verbindung zwischen der griechischen Komödientradition (als Vorlage) und der derben, bodenständigen italischen Lustspieltradition (z. B. Atellane, Phlyakenposse) gemeint.
Welche sprachlichen Besonderheiten weist der Text auf?
Die Arbeit untersucht diachrone sprachliche Phänomene in den Bereichen Graphie, Phonologie, Morphologie und Lexik, wie etwa das Wort „longule“ oder „me impiavi“.
Warum wurde Plautus im Mittelalter verschmäht?
Man stieß sich oft an der derben Sprache und den obszönen Elementen seiner Stücke, die nicht dem damaligen moralischen Ideal entsprachen.
- Quote paper
- Kai-Uwe Heinz (Author), 2001, Zu: Titus Maccius Plautus - Rudens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82969