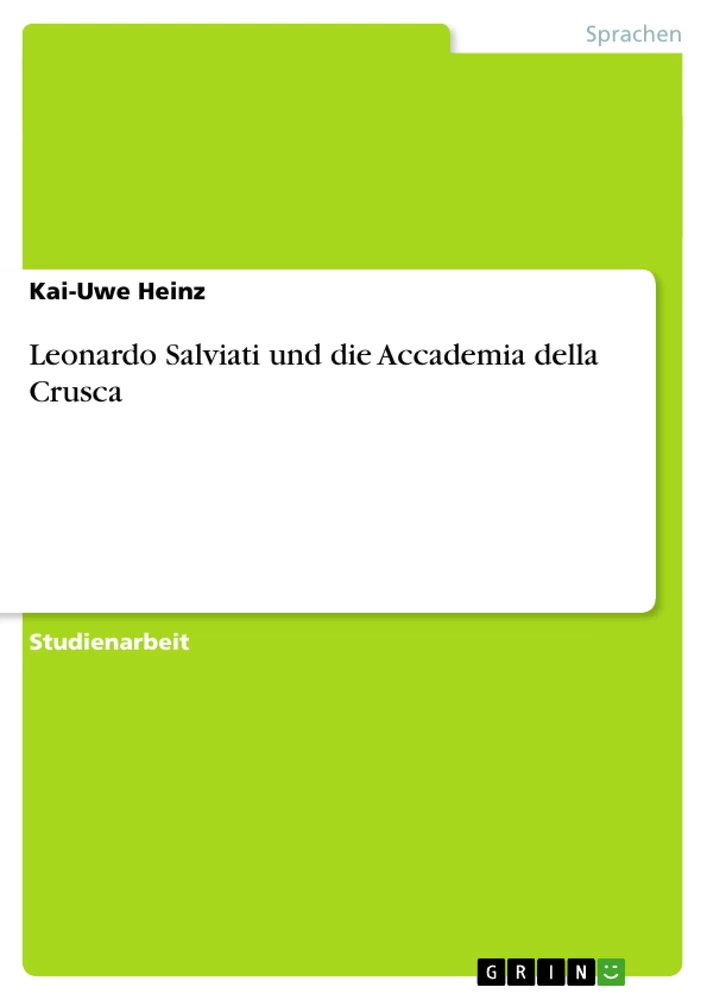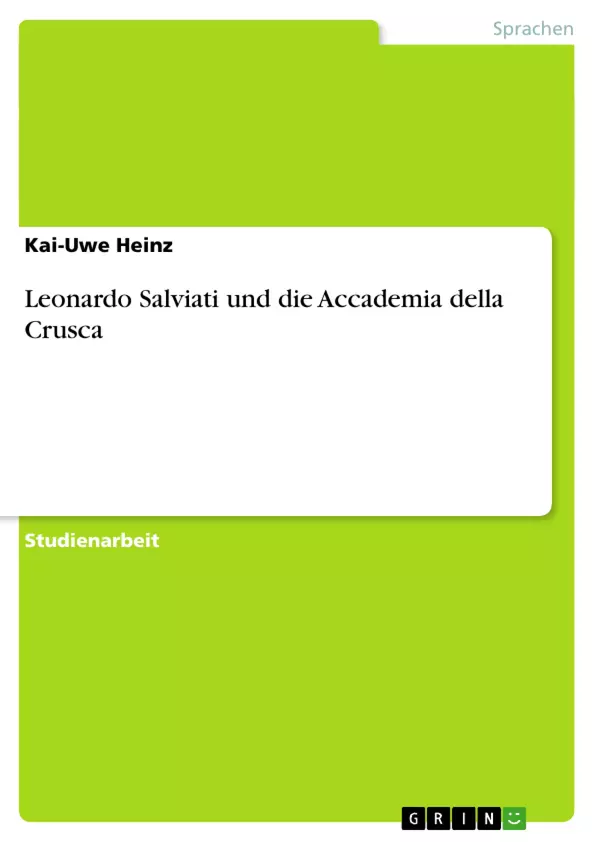Das ganze 16. Jahrhundert in Italien ist geprägt von literarischen Polemiken: die Auseinandersetzungen über Petrarca und den Petrarkismus, über Boccaccio, über Dante, die Streitschrift zwischen Caro und Castelvetro, die von Tasso aufgebrachten Diskussionen. Doch die bedeutendste Polemik ist die, der man den Namen Questione della Lingua gab: mitunter durch den Buchdruck (ab 1460) kam die Frage nach Normierung auf. Soll Latein abgelöst werden? Mit dem im 16. Jahrhundert einsetzenden Demokratisierungsprozeß, war einer breiteren Öffentlichkeit Kulturgut zugänglich gemacht worden, auch mittelständische Kultur wurde absorbiert, alte Werte wurden überdacht, und so gelangte das Latein zunehmend in eine Krise. Doch wenn nicht Latein, welches Idiom soll Volkssprache werden? Unter den Literaturzentren Sizilien und Toskana schien das Toskanische, weil von den tre corone, Dante, Petrarca, Boccaccio vertreten, das Primat zu haben. Entscheidenden Einfluß auf die Sprachendebatte übte Leonardo Salviati, ein Florentiner, aus.
Bedingt durch die Sprachenfrage kennzeichnete ein weiteres das 16. Jahrhundert in Italien: das Aufblühen der Akademien. Sie waren private Debattierklubs und reflektierten die intellektuellen Strömung der Zeit, zumal in der Questione della Lingua. Eine Akademie trat besonders hervor: die Accademia della Crusca, die bald ähnlich der Accadémie Francaise bald entscheidende sprachpflegerische Funktion haben sollte. Deren Gründer war eben jener Salviati. Unser Vorhaben soll es sein, beide, Salviati und die Accademia della Crusca, im Rahmen einer Hausarbeit näher zu beleuchten. Dabei soll zunächst auf Salviati, sein Leben, seine Position in der Questione eingegangen werden und dann im zweiten Teil auf die Akademie.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Vorbemerkungen
- 2.0 Leonardo Salviati
- 2.1 Biographie
- 2.2 Leben und Werk im historischen Kontext
- 2.3 Salviatis These und Position in der Kontroverse
- 3.0 Die Accademia della Crusca
- 3.1 Geschichte der Akademie
- 3.2 Wörterbuch der Akademie
- 3.2.1 Norm des Wörterbuchs
- 3.3 Verdienste der Crusca
- 4.0 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit Leonardo Salviati und der Accademia della Crusca, zwei zentralen Figuren der „Questione della Lingua“ im 16. Jahrhundert. Das Ziel ist es, Salviatis Leben und Werk sowie die Entstehung und Bedeutung der Crusca im Kontext der sprachlichen und kulturellen Debatten der damaligen Zeit zu beleuchten.
- Die „Questione della Lingua“ und die Suche nach einer Normierung der italienischen Sprache
- Salviatis Position in der „Questione“ und seine These vom „volgare arcaizzante“
- Die Rolle der Accademia della Crusca als Sprachpfleger und Sprachnormierer
- Die Bedeutung von Salviatis Werk für die Entwicklung der italienischen Sprache
- Der Einfluss des Konformismus auf Kultur, Politik und Sprache im 16. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die „Questione della Lingua“ als zentrale intellektuelle Auseinandersetzung des 16. Jahrhunderts in Italien vor und hebt die Bedeutung Leonardo Salviatis für die Entwicklung der italienischen Sprache hervor. Im zweiten Kapitel wird Salviatis Biografie beleuchtet, sein Leben und Werk in den historischen Kontext eingebettet und seine Position in der „Questione“ dargestellt. Salviatis These vom „volgare arcaizzante“ wird anhand seiner Schriften „Orazione in lode della fiorentina lingua“ und „Degli Avvertimenti della Lingua sopra’l Decamerone“ erklärt. Das dritte Kapitel widmet sich der Accademia della Crusca, ihrer Geschichte, ihrem Wörterbuch und ihren Verdienste für die Normierung der italienischen Sprache. Die Zusammenfassung des Schlussabschnitts wird aufgrund der Spoilergefahr nicht dargestellt.
Schlüsselwörter
„Questione della Lingua“, Leonardo Salviati, Accademia della Crusca, Sprachnormierung, volgare arcaizzante, florentino, toscano, Konformismus, italienische Sprache, Kulturgeschichte, Renaissance, Sprachpflege, Wörterbuch, Norm, historische Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „Questione della Lingua“ im 16. Jahrhundert?
Es war eine literarische und sprachliche Debatte über die Normierung der italienischen Volkssprache und die Frage, welches Idiom das Lateinische als Kultursprache ablösen sollte.
Welche Rolle spielte Leonardo Salviati in dieser Debatte?
Salviati war ein entscheidender Vordenker, der das Florentinische des 14. Jahrhunderts (die Sprache der „tre corone“) als Norm favorisierte.
Was ist die Accademia della Crusca?
Die von Salviati mitbegründete Akademie hatte die Funktion eines Sprachpflegers und veröffentlichte ein einflussreiches Wörterbuch zur Normierung der Sprache.
Was versteht man unter Salviatis These des „volgare arcaizzante“?
Es bezeichnet die Bevorzugung einer historisierenden, am 14. Jahrhundert orientierten Sprachform des Toskanischen als Ideal.
Warum geriet das Lateinische im 16. Jahrhundert in eine Krise?
Durch den Buchdruck und Demokratisierungsprozesse wurde Kulturgut einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich, die nach einer verständlichen Volkssprache verlangte.
- Arbeit zitieren
- Kai-Uwe Heinz (Autor:in), 1995, Leonardo Salviati und die Accademia della Crusca, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82975