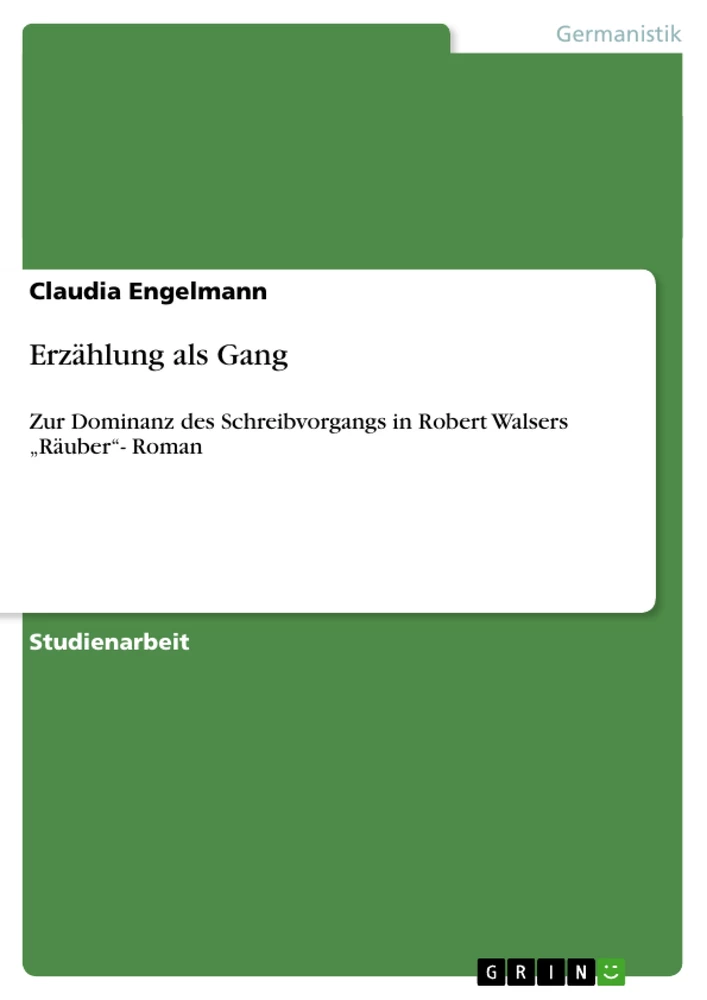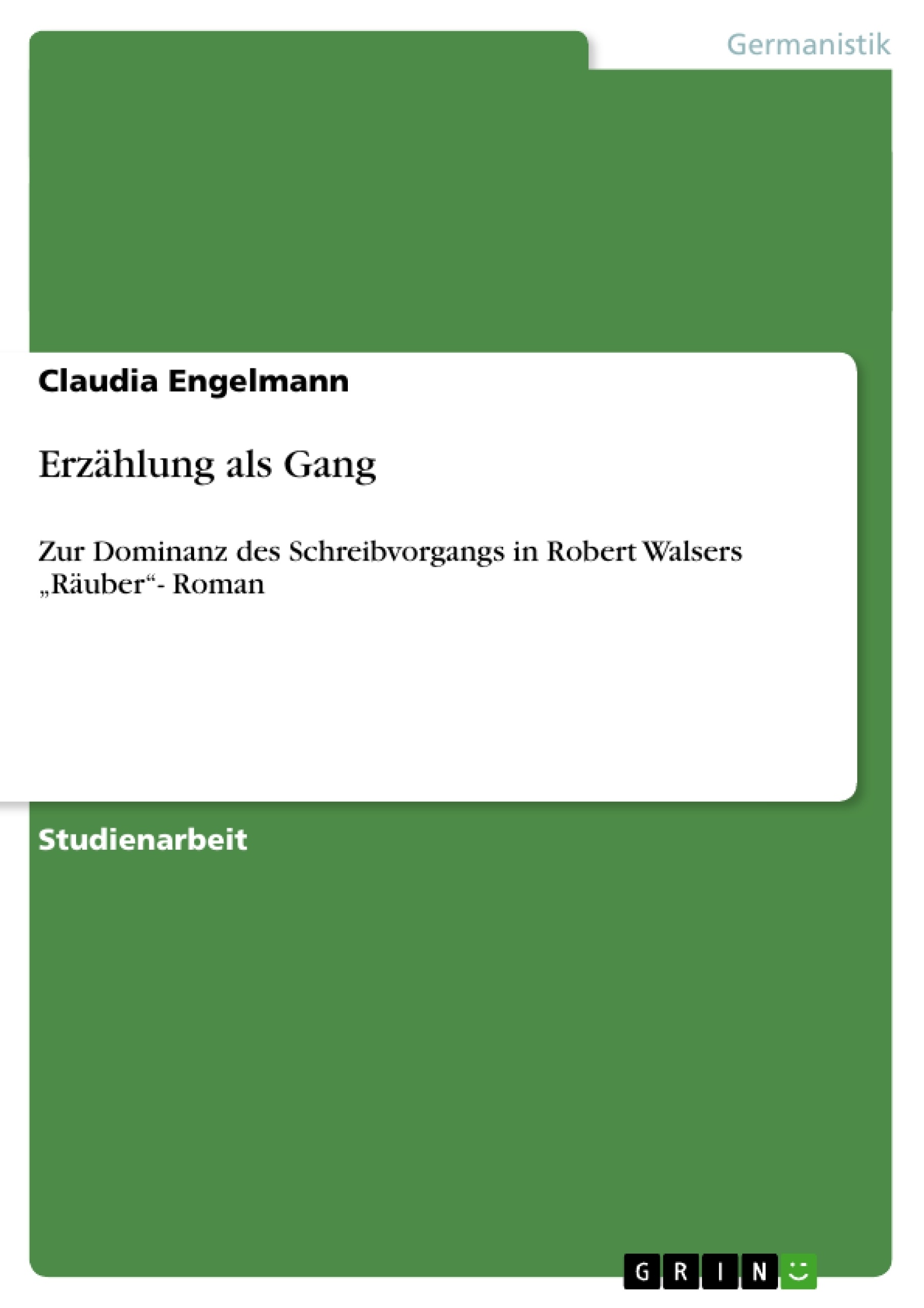„ … was denn mit diesem Stück literarischer Rücksichtslosigkeit anfangen… “ fragt sich Martin Jürgens im Nachwort zu Robert Walsers Roman „Der Räuber“. Diese Frage stellt sich wohl das Gros der Leser dieses Romans. Unter anderem auch ich. Als rücksichtslos könnte man die Art und Weise bezeichnen, mit der dieser Roman die Leseerwartungen enttäuscht. Es gibt weder einen klaren Plot noch eine nachvollziehbare Strukturierung des Romans. Stattdessen scheint dieser Text eine willkürliche Aneinanderreihung von Trivialitäten und Nebensächlichkeiten zu sein.
Die Erzählweise ist außergewöhnlich. Der Roman entsteht nicht durch Handlungen der Protagonisten, sondern durch den Schreib- und Erzählvorgang selbst.
Der Entwicklungsprozess dessen dominiert durchgehend den Text. Ziel dieser Arbeit ist es, die erzählerischen und sprachlichen Elemente näher zu betrachten, die der Dominanz des Schreibvorgangs zugrunde liegen.
Die Dominanz des Schreibprozesses tritt auf verschiedenen Ebenen in Erscheinung.
Deswegen werde ich zu Beginn der Arbeit kurz die erzählerischen Elemente, die den Roman kennzeichnen, darlegen und folgend untersuchen, welche sprachlichen Elemente Walser nutzt, um den Schreibvorgang voranzubringen. Ebenfalls gilt es zu klären, welche Rolle die Mikrogramme in diesem Kontext spielen.
Im 5. Kapitel untersucht die Arbeit die Kommunikabilität des Romanes. Aufgrund der vielen Divergenzen, die Robert Walsers Texte seit jeher bei den Lesern auslösen, versuche ich abschließend den Roman in das Gesamtwerk Walsers und die damalige Zeit einzuordnen. Die Kontroversen über diesen seinen Text vorwegnehmend, stellte Robert Walser fest: „Noch nie, so lange ich am Schreibtisch tätig bin, habe ich so kühn, so unerschrocken begonnen zu schriftstellern.“ (DR:29)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltsangabe
- Erzählperspektive und Erzählweise
- Die Register der literarischen Rede
- Das Verhältnis Ich-Erzähler und Räuber
- Die Dominanz des Schreibvorgangs
- Die scheinbare Selbstkritik
- Die sprachliche Umsetzung des Phänomens
- Die Gegenläufigkeit der Sprache
- Sagen und Zurücknehmen
- Aussparen am Beispiel der Beschreibung des Räubers
- Erzählung als Gang
- Die Rolle des Lesers
- Die Rolle der Mikrogramme
- Der Roman in seiner Zeit
- Die Auseinandersetzung mit der damaligen Art der Literatur
- Vergleich mit Werken der Zeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Dominanz des Schreibvorgangs in Robert Walsers Roman „Der Räuber“. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der erzählerischen und sprachlichen Elemente, die diese Dominanz hervorrufen. Ziel ist es, die Besonderheiten des Schreibprozesses in diesem Werk aufzuzeigen und deren Bedeutung für die Rezeption des Romans zu beleuchten.
- Die Rolle des Ich-Erzählers und seine Beziehung zum Räuber
- Die sprachliche Gestaltung des Schreibprozesses und die damit verbundene Konstruktion der Erzählung
- Die Bedeutung der Mikrogramme für die Gestaltung des Romans
- Die Rezeption des Romans in Bezug auf die damalige Zeit und die Literaturlandschaft
- Die Kontroversen und Herausforderungen, die der Roman für den Leser darstellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Romans „Der Räuber“ ein und erläutert die besondere Erzählweise, die sich durch die Dominanz des Schreibprozesses auszeichnet. Die Inhaltsangabe bietet einen kurzen Überblick über die Geschichte des Räubers und seiner Beziehung zu Edith, wobei die Unbestimmtheit des Inhalts und die Vielschichtigkeit des Romans hervorgehoben werden.
Das dritte Kapitel analysiert die Erzählperspektive und -weise, wobei die verschiedenen Register der literarischen Rede nach Tzvetan Todorovs strukturale Poetik vorgestellt werden. Die Beziehung zwischen Ich-Erzähler und Räuber wird als komplex und vielschichtig beschrieben, wobei die Grenzen zwischen den beiden Figuren verschwimmen.
Im vierten Kapitel wird die Dominanz des Schreibprozesses im Detail betrachtet. Es werden die sprachlichen Elemente, wie z.B. die Gegenläufigkeit der Sprache, das Sagen und Zurücknehmen, sowie das Aussparen von Informationen, analysiert. Die Arbeit zeigt auf, wie diese Elemente die narrative Struktur des Romans beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der Dominanz des Schreibvorgangs, der Erzählperspektive, der sprachlichen Gestaltung, der Mikrogramme, der Rezeption und der Einordnung des Romans in den Kontext der damaligen Zeit. Weitere wichtige Begriffe sind: Robert Walser, „Der Räuber“, Erzählstruktur, literarische Rede, Subjektivität, Referenzialität, Selbstkritik, Kontroversen, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zu Robert Walsers "Der Räuber"
Warum wird der Roman als „literarische Rücksichtslosigkeit“ bezeichnet?
Weil er klassische Leseerwartungen enttäuscht: Es gibt keinen klaren Plot, keine feste Struktur und der Text scheint eine willkürliche Aneinanderreihung von Nebensächlichkeiten zu sein.
Was ist das Besondere am Schreibprozess in diesem Werk?
Der Roman entsteht nicht primär durch die Handlung der Figuren, sondern durch den Akt des Schreibens und Erzählens selbst, der den gesamten Text dominiert.
Welche Rolle spielen die sogenannten Mikrogramme?
Die Mikrogramme sind die winzige Bleistiftschrift, in der Walser den Text verfasste; sie sind eng mit der Entstehung und der fragmentarischen Natur des Romans verknüpft.
Wie ist das Verhältnis zwischen Ich-Erzähler und der Figur des Räubers?
Das Verhältnis ist komplex und vielschichtig; oft verschwimmen die Grenzen zwischen dem erzählenden Subjekt und der beschriebenen Hauptfigur.
Was bedeutet „Erzählung als Gang“?
Dieser Begriff beschreibt die narrative Bewegung des Textes, die eher einem ziellosen Umherschweifen oder Spaziergang gleicht als einer zielgerichteten Handlung.
Wie setzt Walser sprachliche „Gegenläufigkeit“ ein?
Walser nutzt Techniken wie das Sagen und sofortige Zurücknehmen von Aussagen sowie das bewusste Aussparen von Informationen, um den Schreibprozess voranzutreiben.
- Quote paper
- M.A. Claudia Engelmann (Author), 2003, Erzählung als Gang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83017