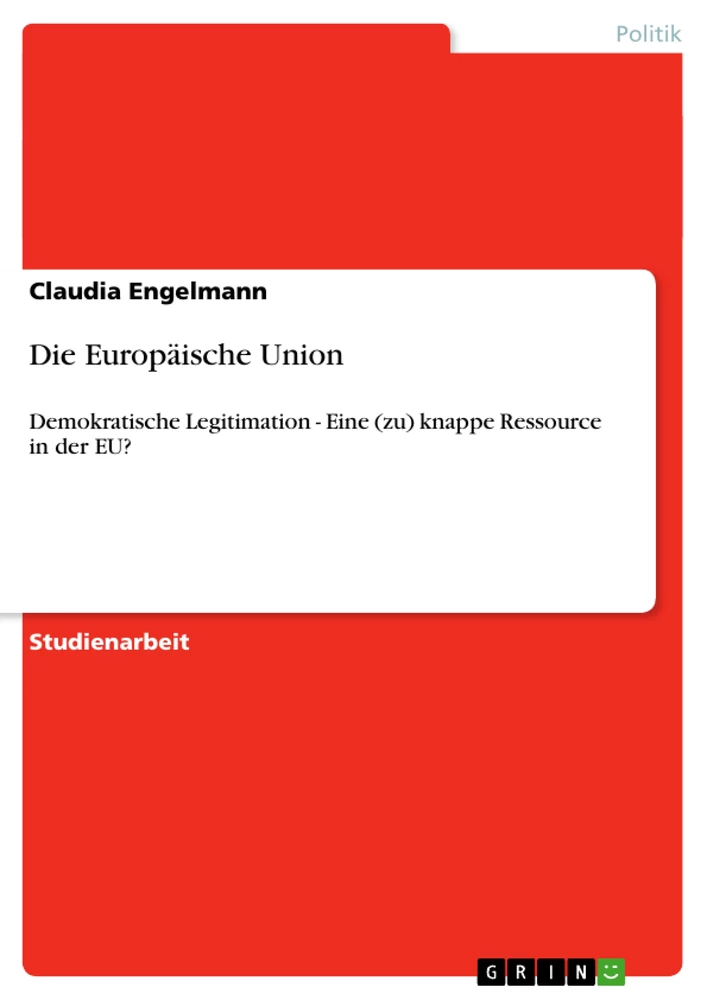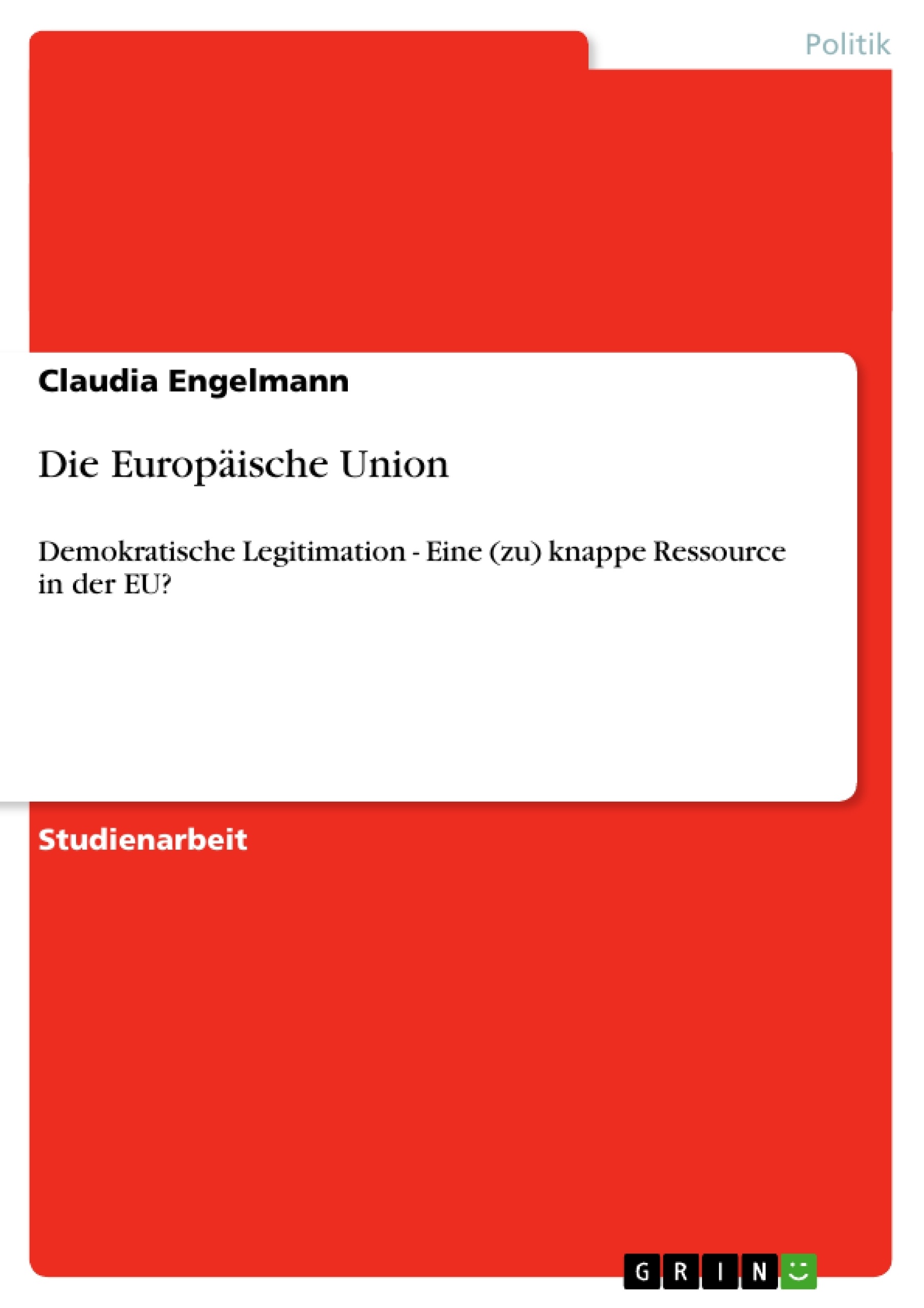Lange hat in der Europadiskussion die Frage nach der Legitimität der Europäischen Union keine Rolle gespielt. Man war sich einig, dass das Integrationsprojekt EU eine notwendige Konsequenz aus der leidvollen Konfliktgeschichte der europäischen Staaten ist. (vgl. Kielmannsegg 2003: 50)
Die Frage nach einem Legitimations- bzw. - Demokratiedefizit gewann erst mit der fortschreitenden Entwicklung und Integration in der EU an Bedeutung. Seit dem Maastricher (1992) und Amsterdamer Vertrag 1997 wurden die Kompetenzen der EU kontinuierlich ausgebaut. In dem Maße, in dem die EU den nationalen Parlamenten Kompetenzen entzieht, nimmt sie sich dieser an, ohne sich jedoch selbst zu legitimieren. (vgl. Weidenfeld/Wessels, 2000: 389)
Somit tauchte unter einigen Politik- und Sozialwissenschaftlern der Ruf nach einer verstärkten demokratischen Legitimation der Union auf.
Mit der Diskussion über den Verfassungskonvent beschäftigen sich momentan die führenden Köpfe der Mitgliedstaaten mit dem zukünftigen Status der Europäischen Union. Auch hier spielt die Frage und der Umgang mit dem Demokratiedefizit eine große Rolle.
Dass ein solches vorhanden ist, wird unter den Wissenschaftlern nicht bestritten. Vielmehr geht es um die Frage, ob eine Legitimation der EU- Organe überhaupt nötig ist. Und wenn ja, ob sie möglich ist. Und kann die Legitimation der Mitgliedstaaten überhaupt auf die Union übertragen werden?(vgl. Grunauer 2002: 39)
Mit diesen Fragen und einigen möglichen Antworten beschäftigt sich, vor dem aktuellen Hintergrund des Konvents und der EU- Osterweiterung, diese Arbeit.
Um die Frage zu klären, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß ein Legitimations- und Demokratiedefizit in der Europäischen Union vorhanden ist, stelle ich nach einer Einführung in das europäische Rechtssystem, zuerst die politikwissenschaftlichen Ansätze zur Thematik dar.
Es folgt eine nähere Betrachtung der Begriffe Demokratie und Legitimität.
Schließlich wird anhand der einzelnen Institutionen der EU deren demokratische Legitimität überprüft. Anschließend skizziere ich ein mögliches substantielles Defizit, wie auch die Rolle der EU in der Sozialpolitik.
Abschließend folgt ein themenbezogener Ausblick auf die aktuelle Entwicklung im europäischen Integrationsprozess im Kontext zur Demokratie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Europäische Rechtssystem
- Forschungsstand
- Realismus
- Intergouvernementalismus
- Funktionalismus
- Begriffsklärung
- Demokratie
- Legitimität
- Frage nach dem institutionellen Defizit der EU
- Das Europäische Parlament
- Die Europäische Kommission
- Der Ministerrat und der Rat der Europäischen Union
- Der Europäische Gerichtshof
- Das substantielle Defizit
- Die sozialpolitische Frage
- Ausblick
- Die EU- Osterweiterung
- Der Verfassungskonvent
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und in welchem Umfang ein Legitimations- und Demokratiedefizit in der Europäischen Union vorhanden ist. Sie untersucht die Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses im Kontext der demokratischen Legitimation und analysiert die verschiedenen Ansätze der Politikwissenschaft, um dieses komplexe Thema zu beleuchten.
- Die Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses und die Herausforderungen der demokratischen Legitimation
- Die verschiedenen politikwissenschaftlichen Ansätze zur Analyse des Verhältnisses von Integration und Demokratie
- Die institutionellen Strukturen der EU und deren demokratische Legitimation
- Das Problem des substantiellen Defizits und die Rolle der EU in der Sozialpolitik
- Die aktuelle Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses im Kontext zur Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Problematik des Legitimations- und Demokratiedefizits in der EU vor und skizziert die Relevanz des Themas im Kontext der fortschreitenden Integration. Sie führt den Leser in die Thematik ein und zeigt die Bedeutung der Frage nach der Legitimität der EU-Organe auf.
- Das Europäische Rechtssystem: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen des europäischen Rechtssystems, einschließlich der Gründungsverträge und deren Weiterentwicklung. Es beschreibt die drei Säulen des politischen Systems der EU und hebt die Flexibilität der EU-Verfassung hervor.
- Forschungsstand: Dieser Abschnitt stellt verschiedene Integrationstheorien vor, die sich mit dem Verhältnis von Integration und Demokratie beschäftigen, insbesondere den Realismus, den Intergouvernementalismus und den Funktionalismus. Diese Theorien bieten wichtige Perspektiven auf die Herausforderungen der demokratischen Legitimation im europäischen Integrationsprozess.
- Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Demokratie und Legitimität und setzt diese in Bezug zur EU. Es erklärt die unterschiedlichen Aspekte und Dimensionen dieser Konzepte und ihre Relevanz für das Thema der Legitimität der EU.
- Frage nach dem institutionellen Defizit der EU: Dieser Abschnitt analysiert die demokratische Legitimität der einzelnen Institutionen der EU, darunter das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, der Ministerrat und der Europäische Gerichtshof. Es untersucht die Funktionsweise dieser Institutionen und deren Rolle in der Entscheidungsfindung und Legitimitätsfindung.
- Das substantielle Defizit: Dieses Kapitel beleuchtet das Problem des substantiellen Defizits, das sich auf die Defizite in der politischen Substanz der EU bezieht. Es diskutiert die Herausforderungen der politischen Gestaltungskraft und die Frage, inwieweit die EU in der Lage ist, den Interessen ihrer Bürger gerecht zu werden.
- Die sozialpolitische Frage: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der EU in der Sozialpolitik und die Auswirkungen der Integration auf die sozialen Dimensionen der europäischen Gesellschaft. Es untersucht die Herausforderungen der sozialen Gerechtigkeit und die Frage, inwieweit die EU in der Lage ist, die sozialen Auswirkungen der Integration zu steuern.
- Ausblick: Dieser Abschnitt bietet einen themenbezogenen Ausblick auf die aktuelle Entwicklung im europäischen Integrationsprozess im Kontext zur Demokratie. Er beleuchtet die Herausforderungen der EU-Osterweiterung und des Verfassungskonvents und ihre Bedeutung für die demokratische Legitimation der EU.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt das Thema der demokratischen Legitimation der Europäischen Union. Zu den zentralen Schlüsselbegriffen gehören: europäische Integration, Demokratie, Legitimität, Institutionen, Defizite, Realismus, Intergouvernementalismus, Funktionalismus, EU-Osterweiterung, Verfassungskonvent.
Häufig gestellte Fragen
Hat die Europäische Union ein Demokratiedefizit?
Wissenschaftler diskutieren dies kontrovers. Da die EU Kompetenzen von nationalen Parlamenten übernimmt, ohne dass die EU-Organe die gleiche direkte demokratische Legitimation besitzen, wird oft von einem Defizit gesprochen.
Wie legitimiert sich das Europäische Parlament?
Durch die direkte Wahl der EU-Bürger besitzt es die stärkste demokratische Legitimation unter den EU-Institutionen, hatte jedoch lange Zeit weniger Macht als der Ministerrat.
Was ist der Unterschied zwischen Intergouvernementalismus und Funktionalismus?
Intergouvernementalismus sieht die Macht bei den Nationalstaaten, während Funktionalismus davon ausgeht, dass Integration durch sachliche Notwendigkeiten eine Eigendynamik entwickelt.
Was versteht man unter dem „substantiellen Defizit“ der EU?
Es bezieht sich auf das Fehlen einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit, einer einheitlichen Sprache und eines starken europäischen Identitätsgefühls, was demokratische Prozesse erschwert.
Welche Rolle spielt der Verfassungskonvent?
Der Konvent wurde ins Leben gerufen, um die EU transparenter und demokratischer zu gestalten und eine Verfassung zu erarbeiten, die das Demokratiedefizit abbauen sollte.
- Arbeit zitieren
- M.A. Claudia Engelmann (Autor:in), 2003, Die Europäische Union , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83018