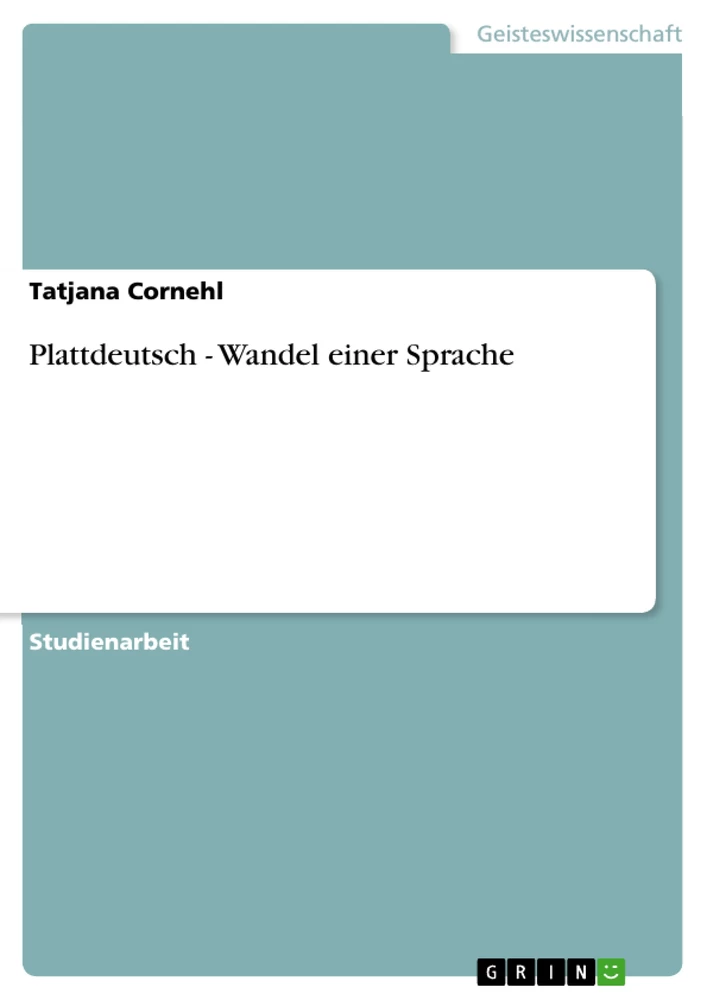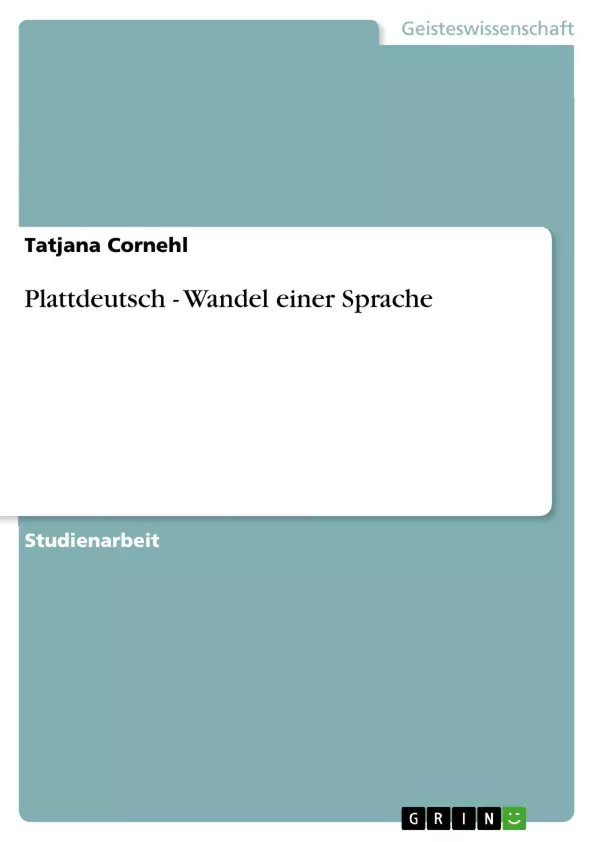Jeder Deutsche kennt verschiedene Dialekte bzw. Mundarten wie z.B. das Sächsische, das Berlinerische, das Bayrische oder auch das Kölsche Platt. Diese Dialekte hört man immer wieder, so z. B. im Fernsehen die „Erdinger- Weißbier“ - Werbung. Auch TV- Serien spielen mit diesen Mundarten. Die Sitcom „Alles Atze“ oder auch die „Familie Becker“ benutzen die Mundarten, um das „normale Leben“ witziger bzw. anders darzustellen.
Ich möchte mich mit einer Mundart beschäftigen, die erst in der letzten Zeit wieder Eingang in die Medienwelt gewinnen konnte, dem„norddeutschen“ Plattdeutschen.
Dazu werde ich versuchen, den Wandel dieser Sprache von einer angesehen gesprochenen und Schriftsprache im Mittelalter zu einer verschmähten Mundart, bis hin zu einer Kultursprache darzulegen.
Dabei werde ich mich allerdings auf das Plattdeutsche beschränken, welches man in Schleswig-Holstein spricht. Neben diesem gibt es eine Reihe von anderen plattdeutschen Sprachen, so z.B. das mecklenburgische Platt.
Der Wandel der plattdeutschen bzw. niederdeutschen Sprache hat sich in drei Stufen vollzogen:
Zum einen gibt es den radikalen Schreibsprachenwechsel im 16. bis 17. Jahrhundert, dem folgte ein weitgehender Wechsel der gesprochenen Sprache vor allem im 19. und 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert erfuhr das Plattdeutsche dann einen neuerlichen Aufstieg zur Kultursprache.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schreibsprachenwechsel
- Wandel von der Schreibsprache zur Mundart
- Rückgang des Plattdeutschen
- Plattdeutsch eine Pöbelsprache?
- Wiederbelebung des Niederdeutschen
- Streit zwischen K. Groth und F. Reuter
- Niederdeutsche Bühnenbewegung
- Nationalsozialismus
- Plattdeutsch als Propagandamittel
- Literatur
- Plattdeutsch heute: Kultursprache oder Mundart?
- Plattdeutsch eine tote Sprache?
- Meine Umfrage
- Theater
- Plattdeutsche Medien
- Bücher, Zeitschriften und Kalender
- Funk
- Musik
- Fernsehen
- Neues aus Büttenwarder
- Die Welt op Platt
- Internet
- Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Plattdeutschen in Schleswig-Holstein, von seiner einstigen Bedeutung als Schriftsprache bis zu seiner heutigen Position als Kultursprache und Mundart. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Sprachwandels über verschiedene historische Epochen und gesellschaftliche Entwicklungen.
- Der Schreibsprachenwechsel vom Plattdeutschen zum Hochdeutschen
- Der Rückgang des Plattdeutschen als Umgangssprache und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen
- Die Wiederbelebung des Plattdeutschen im 20. Jahrhundert als Kultursprache
- Die Rolle des Plattdeutschen in den Medien
- Die gesellschaftliche Wahrnehmung des Plattdeutschen in verschiedenen Epochen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des plattdeutschen Sprachwandels ein und beschreibt den Kontext innerhalb der deutschen Dialektlandschaft. Es wird die Absicht der Arbeit benannt, den Wandel des Plattdeutschen in Schleswig-Holstein von einer angesehenen Schriftsprache zu einer Mundart und schließlich zu einer Kultursprache zu dokumentieren. Der geographische Fokus auf Schleswig-Holstein wird erläutert, und die dreistufige Entwicklung des Wandels (Schreibsprachenwechsel, Wandel der gesprochenen Sprache, Aufstieg zur Kultursprache) wird skizziert.
Schreibsprachenwechsel: Dieses Kapitel beschreibt die historische Bedeutung des Plattdeutschen im mittelalterlichen hanseatischen Wirtschaftsraum, wo es als Schriftsprache für Recht und Gesetz diente und sogar in Buchform Verbreitung fand. Der Untergang der Hanse und der Einfluss der Reformation mit der Verbreitung der hochdeutschen „Luthersprache“ werden als entscheidende Faktoren für den Rückgang des Plattdeutschen als Schriftsprache dargestellt. Der Einfluss des Buchdrucks, der vornehmlich hochdeutsche Werke produzierte, und der Versuch, hochdeutsche Werke unzureichend ins Plattdeutsche zu übersetzen, werden als weitere Ursachen genannt. Die langsame, aber stetige Übernahme des Hochdeutschen durch die Kirche und den Adel wird detailliert beschrieben.
Wandel von der Schreibsprache zur Mundart: Dieses Kapitel beschreibt den fortschreitenden Rückgang des Plattdeutschen im 18. Jahrhundert, zunächst in den höheren Gesellschaftsschichten und später auch im Bürgertum. Die Entwicklung einer negativen Konnotation des Plattdeutschen als „Sprache des Landvolkes“ wird beleuchtet, im Gegensatz zum Hochdeutschen, das als gehobener angesehen wurde. Der Versuch einzelner Gelehrter wie Johann Lauremberg und Bernhard Raupach, gegen die Verachtung des Plattdeutschen anzukämpfen, wird als erfolglos dargestellt, da die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen zu stark waren.
Schlüsselwörter
Plattdeutsch, Niederdeutsch, Sprachwandel, Hochdeutsch, Reformation, Hanse, Kultursprache, Mundart, Medien, Schleswig-Holstein, Sprachgeschichte, gesellschaftliche Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Wandel des Plattdeutschen in Schleswig-Holstein
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Plattdeutschen in Schleswig-Holstein über verschiedene historische Epochen und gesellschaftliche Entwicklungen. Sie verfolgt den Weg des Plattdeutschen von einer Schriftsprache zu einer Mundart und schließlich zu einer Kultursprache.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Schreibsprachenwechsel vom Plattdeutschen zum Hochdeutschen, den Rückgang des Plattdeutschen als Umgangssprache, die Wiederbelebung als Kultursprache im 20. Jahrhundert, die Rolle des Plattdeutschen in den Medien und die gesellschaftliche Wahrnehmung des Plattdeutschen in verschiedenen Epochen.
Welche Phasen des Sprachwandels werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt drei Phasen: den Schreibsprachenwechsel (mit dem Niedergang des Plattdeutschen als Schriftsprache), den Wandel von der Schreibsprache zur Mundart (mit dem Verlust an gesellschaftlichem Prestige) und den Aufstieg zur Kultursprache im 20. Jahrhundert (mit der Wiederbelebung und Nutzung in Medien und Kultur).
Welche Rolle spielte die Hanse und die Reformation?
Die Hanse trug zur Bedeutung des Plattdeutschen als Schriftsprache im mittelalterlichen Wirtschaftsraum bei. Die Reformation mit der Verbreitung der hochdeutschen „Luthersprache“ markierte einen entscheidenden Wendepunkt im Rückgang des Plattdeutschen als Schriftsprache. Der Buchdruck, der hauptsächlich hochdeutsche Werke produzierte, verstärkte diesen Prozess.
Wie wurde Plattdeutsch im 18. Jahrhundert wahrgenommen?
Im 18. Jahrhundert verlor Plattdeutsch zunehmend an Ansehen, zunächst in den höheren Gesellschaftsschichten, später auch im Bürgertum. Es entwickelte sich eine negative Konnotation als „Sprache des Landvolkes“ im Gegensatz zum Hochdeutschen als gehobener Sprache.
Welche Rolle spielte das Plattdeutsche im Nationalsozialismus?
Die Arbeit beleuchtet die Nutzung des Plattdeutschen als Propagandamittel im Nationalsozialismus und dessen Einfluss auf die plattdeutsche Literatur.
Wie präsentiert sich das Plattdeutsche heute?
Die Arbeit untersucht die aktuelle Situation des Plattdeutschen: Ist es eine tote Sprache oder eine lebendige Kultursprache? Sie beleuchtet die Rolle des Plattdeutschen in modernen Medien (Bücher, Zeitschriften, Kalender, Funk, Musik, Fernsehen, Internet) und im Theater.
Welche konkreten Beispiele für plattdeutsche Medien werden genannt?
Beispiele für plattdeutsche Medien sind die Fernsehsendungen „Neues aus Büttenwarder“ und „Die Welt op Platt“, sowie Bücher, Zeitschriften, Kalender und Musik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Plattdeutsch, Niederdeutsch, Sprachwandel, Hochdeutsch, Reformation, Hanse, Kultursprache, Mundart, Medien, Schleswig-Holstein, Sprachgeschichte, gesellschaftliche Wahrnehmung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zum Schreibsprachenwechsel, zum Wandel von der Schreibsprache zur Mundart, zur niederdeutschen Bühnenbewegung, zum Nationalsozialismus und zum Plattdeutsch heute, sowie einen Abschluss. Sie beinhaltet auch ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Zusammenfassungen der Kapitel.
- Quote paper
- Tatjana Cornehl (Author), 2007, Plattdeutsch - Wandel einer Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83069