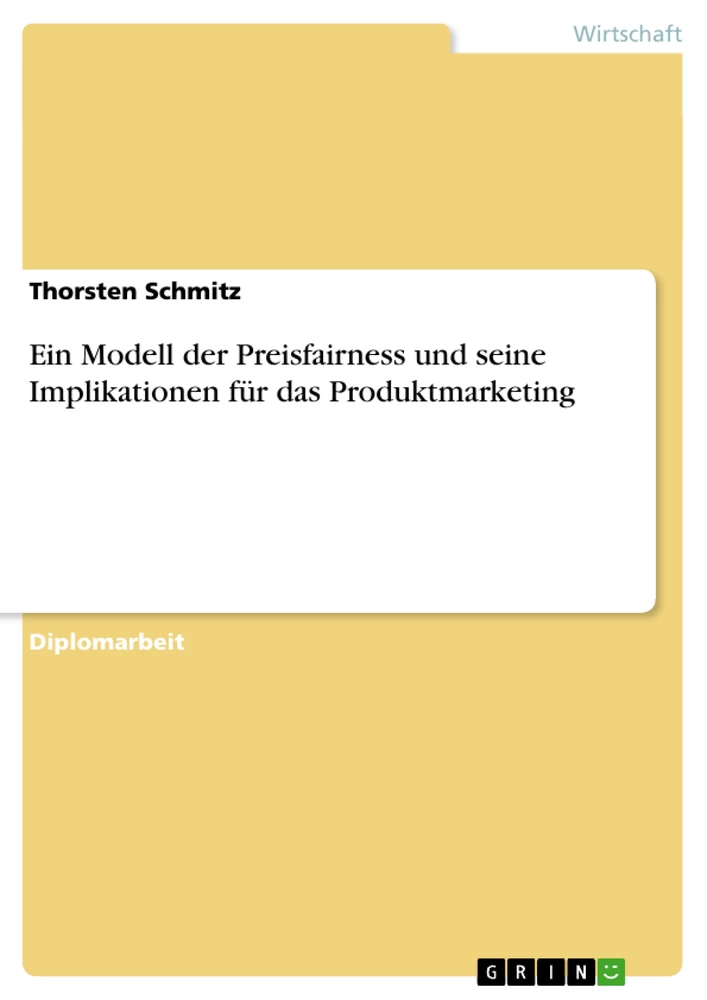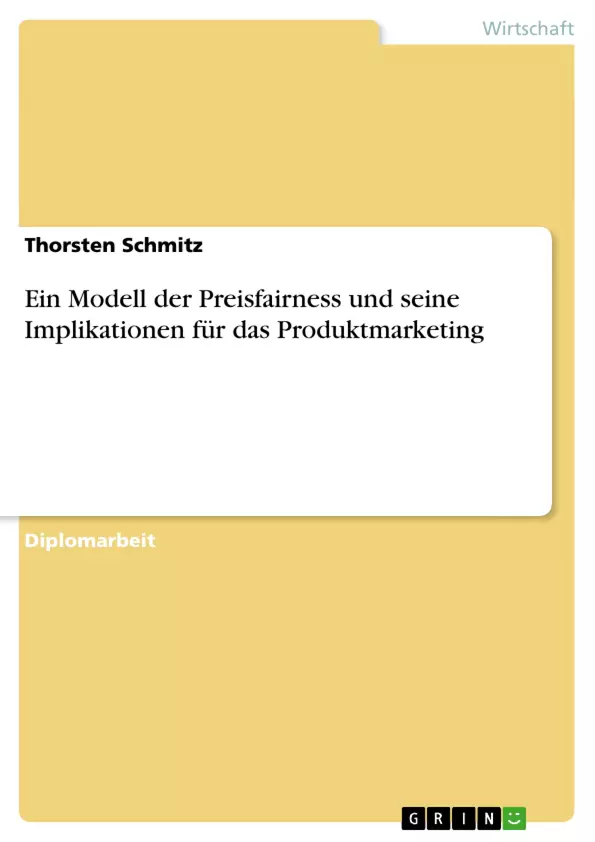Fairness spielt seit jeher in der Geschichte der menschlichen Zivilisation eine große Bedeutung. Eine spezielle Form der Fairness ist die Preisfairness, die im Rahmen dieser Arbeit eingehend analysiert werden soll. Daß sich Menschen intensiv mit der Fairness von Preisen beschäftigen, tritt bereits durch eine einfache Recherche bei Google zutage.
ROTEMBERG ermittelte die Anzahl der Treffer für die Suche nach den Begriffen fair price und equilibrium price. Für den ersten Suchbegriff fanden sich 751.000, für den zweiten jedoch lediglich 57.000 Treffer, was auf die ausgeprägte menschliche Eigenschaft zur Auseinandersetzung mit fairen Preise im Vergleich zu Gleichgewichts-/Marktpreisen hindeutet.
Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, von welcher Relevanz
preisfairnesstheoretische Aspekte im Rahmen von Transaktionsbeziehungen sind und auf welchen grundlegenden Regeln Wahrnehmungen von Preisfairness basieren. Durch Identifizierung bestimmter Regelmäßigkeiten
können Unternehmen verhindern, daß die mit Wahrnehmungen
von Preisunfairness verbundenen negativen Effekte
auftreten oder aber ihre Qualität und Intensität antizipieren, wenn sie
denn bewußt in Kauf genommen werden sollen. Aufbauend auf einigen fairnesstheoretischen Grundlagen wird in den folgenden Kapiteln untersucht, wie die Berücksichtigung von Preisfairness die Gewinnmaximierung von Unternehmen beschränkt und wie Konsumenten eine Evaluierung des Preises vornehmen. Danach werden einige preispsychologische Aspekte beschrieben, die geeignet sind, das Verhalten von Konsumenten zu determinieren. Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse rekapituliert und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Fairnessdimensionen
- Distributive Gerechtigkeit
- Prozedurale Gerechtigkeit
- Interaktionale Gerechtigkeit
- Fairnesstheorien
- Equity Theory
- Dual Entitlement Theory
- Zusammenfassung
- Fairnessdimensionen
- Gewinnmaximierung unter Beachtung von Preisfairness
- Fairness bei Preisverhandlungen
- Modelle mit rein eigennutzorientierten Akteuren
- Modelle mit gemeinwohlorientierten Akteuren
- Hybridmodelle
- Empirische Ergebnisse
- Referenztransaktionen
- Interpretation des Transaktionsergebnisses
- Asymmetrien bei der Bewertung
- Framing-Effekte
- Potentielle Gründe für Preisveränderungen
- Beibehaltung des Gewinnniveaus
- Aufteilung zusätzlicher Gewinne
- Ausnutzung von Marktmacht
- Durchsetzung von Preisfairness
- Ökonomische Konsequenzen
- Marktungleichgewicht
- Nachfrageüberhang bei Gütern mit dem höchsten Nutzen
- Preiseffekte von Kosten- und Nachfrageveränderungen
- Rabatte als präferierte Form der Preisreduktion
- Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
- Fairness bei Preisverhandlungen
- Wahrnehmung von Preisfairness
- Einflußfaktoren und deren Auswirkungen
- Angenommener relativer Gewinn
- Angenommenes Motiv
- Einfluß der Reputation
- Kaufabsichten
- Empirische Analysen
- Interdependenz zwischen angenommenem relativen Gewinn/angenommenem Motiv und wahrgenommener Preisunfairness
- Reputation als intervenierende Variable
- Einfluß der Quelle der Preisinformation und der Richtung der Preisveränderung
- Referenzmaßstäbe der Preisbewertung
- Intertemporaler Preisvergleich
- Wettbewerbspreise
- Kosten des Unternehmens
- Einflußfaktoren und deren Auswirkungen
- Preispolitische Aspekte
- Kundenzufriedenheit und Preispolitik
- Kundenzufriedenheit und Zahlungsbereitschaft
- Kundenzufriedenheit und Verhaltenswirkung
- Empirische Befunde
- Preispolitische Implikationen
- Preisschwellen
- Konträre Ansichten
- Verhaltenstheoretische Erklärungsansätze
- Empirische Evidenz
- Handlungsempfehlung
- Kundenzufriedenheit und Preispolitik
- Verhaltensreaktionen der Käufer
- Keine Aktion
- Selbstschutz
- Rache
- Irrationalität des Verhaltens
- Bestimmungsfaktoren für das Verlangen nach Rache
- Resumee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Preisfairness und untersucht, welche Relevanz fairnesstheoretische Aspekte im Rahmen von Transaktionsbeziehungen haben. Ziel ist es, die grundlegenden Regeln aufzudecken, auf denen Wahrnehmungen von Preisfairness basieren. Die Arbeit analysiert, wie die Berücksichtigung von Preisfairness die Gewinnmaximierung von Unternehmen beschränkt und wie Konsumenten eine Evaluierung des Preises vornehmen.
- Wahrnehmung von Preisfairness: Die Arbeit analysiert die Faktoren, die die Wahrnehmung von Preisfairness beeinflussen, und deren Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten.
- Fairnesstheorien: Die Arbeit stellt verschiedene Fairnesstheorien vor, wie die Equity Theory und die Dual Entitlement Theory, um das Konzept der Preisfairness zu erklären.
- Gewinnmaximierung: Die Arbeit untersucht, wie die Berücksichtigung von Preisfairness die Gewinnmaximierung von Unternehmen einschränkt und welche Strategien Unternehmen zur Optimierung des Gewinns unter Berücksichtigung von Fairnessaspekten verfolgen können.
- Preispolitische Aspekte: Die Arbeit befasst sich mit preispolitischen Aspekten wie Kundenzufriedenheit und Preisschwellen und analysiert deren Zusammenhang mit Preisfairness.
- Verhaltensreaktionen der Käufer: Die Arbeit untersucht, wie Käufer auf Preisunfairness reagieren, mit besonderem Fokus auf die Reaktionen Keine Aktion, Selbstschutz und Rache.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Preisfairness im Kontext der menschlichen Zivilisation und im Bereich des Online-Handels aufzeigt. Anschließend werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der Preisfairness diskutiert. Hierbei werden die Fairnessdimensionen (distributive, prozedurale und interaktionale Gerechtigkeit) sowie relevante Fairnesstheorien (Equity Theory und Dual Entitlement Theory) vorgestellt. In Kapitel 3 wird untersucht, wie die Berücksichtigung von Preisfairness die Gewinnmaximierung von Unternehmen einschränkt. Hierbei werden die Rolle von Fairness bei Preisverhandlungen, Referenztransaktionen, die Interpretation des Transaktionsergebnisses durch den Kunden, potentielle Gründe für Preisveränderungen, die Durchsetzung von Preisfairness und die ökonomischen Konsequenzen der Preisfairness beleuchtet. Kapitel 4 widmet sich der Wahrnehmung von Preisfairness durch Konsumenten und analysiert Einflussfaktoren wie den angenommenen relativen Gewinn, das angenommene Motiv für die Preisveränderung, den Einfluss der Reputation des Unternehmens, Kaufabsichten sowie verschiedene empirische Studien zum Thema. Kapitel 5 befasst sich mit preispolitischen Aspekten der Preisfairness. Dabei werden der Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit und Preispolitik sowie das Phänomen der Preisschwellen untersucht. Abschließend wird in Kapitel 6 beleuchtet, wie Käufer auf Preisunfairness reagieren, mit besonderem Fokus auf die Reaktionen Keine Aktion, Selbstschutz und Rache.
Schlüsselwörter
Preisfairness, Distributive Gerechtigkeit, Prozedurale Gerechtigkeit, Interaktionale Gerechtigkeit, Equity Theory, Dual Entitlement Theory, Gewinnmaximierung, Referenztransaktion, Framing-Effekte, Reputation, Kundenzufriedenheit, Preisschwellen, Verhaltensreaktionen, Rache.
- Quote paper
- Diplom-Kaufmann Thorsten Schmitz (Author), 2006, Ein Modell der Preisfairness und seine Implikationen für das Produktmarketing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83074