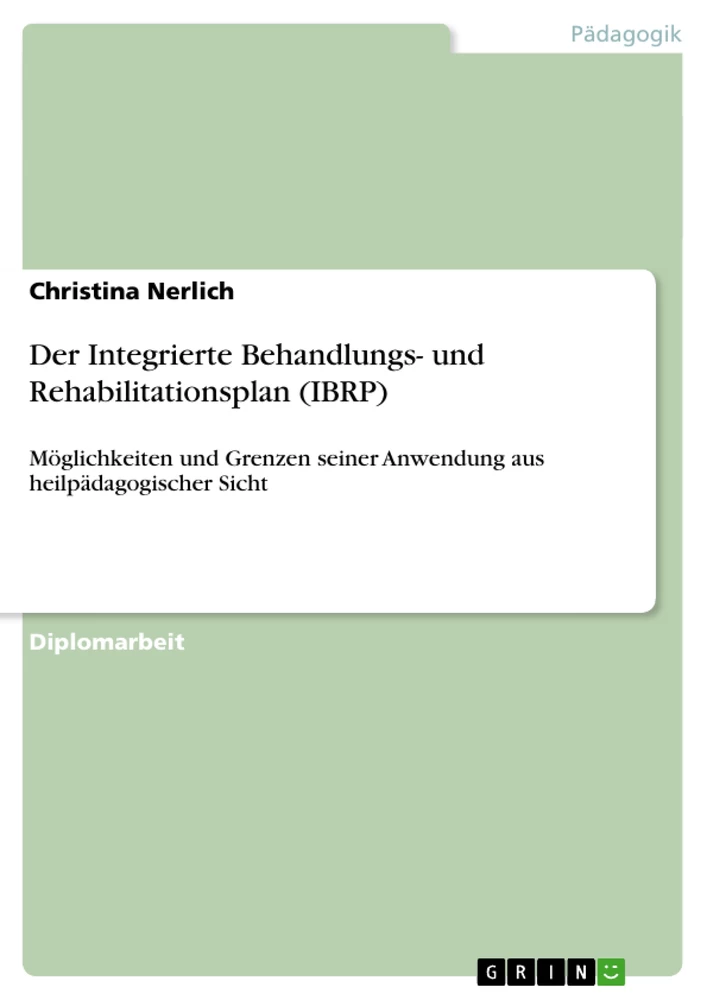Der Integrierte Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP) ist ein Instrument zur Erfassung des individuellen Hilfebedarfs psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen. Seine zentralen fachlichen Prämissen sind 1. die konsequente Orientierung an der Person (Personenzentrierung), ihrer persönlichen Voraussetzungen und Lebensumstände im jeweiligen Umfeld und darauf aufbauend 2. die Lebensfeldorientierung, welche soziale und umfeldbezogene Ressourcen bei der Hilfeplanung wesentlich integriert.
Die vorliegende Arbeit setzt sich in einem ersten Analyseschritt mit der Frage auseinander, welchen Bezug zu aktuellen Themen der Behinderten- und Heilpädagogik die fachlichen Grundlagen des IBRP aufweisen. Die soziologische Theorie der Inklusion nach N. Luhmann wird hierbei in einem Exkurs erörtert und für die weitere Arbeit verwendet.
Den Schwerpunkt der Arbeit bildet der Überblick über die derzeitige Realisierung der im ersten Teil vorgestellten fachlichen Grundlagen. Hier werden die zentralen vier Umsetzungsebenen der Kommission zur Personalbemessung analysiert:
- Die Ebene der Erstellung und Anwendung in Diensten und Einrichtungen,
- die Ebene der Organisation
- die Ebene der Finanzierung
Auf jeder Ebene wird 1. zunächst dargestellt, wie die Empfehlungen der Kommission aussehen, 2. geprüft, inwieweit die Empfehlungen bislang realisiert wurden und welche Kritik und Probleme dabei auftraten und 3. beurteilt, wie sich die fachlichen Grundlagen bislang realisiert haben.
Im Nachwort werden die Inhalte zusammengefasst im Hinblick auf die zukünftigen Möglichkeiten und Potentiale für die Praxis mit dem IBRP.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fachliche Grundlagen des IBRP und ihr Bezug zur Heilpädagogik
- Historischer und fachlicher Entstehungskontext
- Fachliche Grundlagen des IBRP
- Chronische psychische Krankheit und Behinderung
- Merkmale der Personenzentrierung
- Merkmale der Lebensfeldorientierung
- Heilpädagogischer Bezug
- Chronische psychische Krankheit und Behinderung
- Bezug zur Personenzentrierung
- Bezug zur Lebensfeldorientierung
- Aufbau und Verfahren des IBRP
- Ermittlung des Hilfebedarfs
- Das Komplexleistungsprogramm
- Ermittlung des Personalbedarfs
- Realisierung der fachlichen Grundlagen
- Implementationsprojekte und Datenlage
- Ebene der Erstellung und Anwendung in Diensten und Einrichtungen
- Stand der Umsetzung
- Realisierung der fachlichen Grundlagen
- Ebene der Organisation
- Empfehlungen der Kommission
- Stand der Umsetzung
- Realisierung der fachlichen Grundlagen
- Ebene der Finanzierung
- Empfehlungen der Kommission
- Stand der Umsetzung
- Realisierung der fachlichen Grundlagen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Integrierten Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP) aus heilpädagogischer Sicht. Ziel ist es, die fachlichen Grundlagen des IBRP zu analysieren und deren Realisierung im Versorgungssystem zu bewerten. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit die Leitidee der Personenzentriertheit umgesetzt wird und welche Grenzen der Umsetzung bestehen.
- Analyse der fachlichen Grundlagen des IBRP
- Bewertung der Umsetzung der Personenzentriertheit
- Untersuchung der Parallelen zwischen IBRP und Heilpädagogik
- Beurteilung der Einflüsse ökonomischer Faktoren auf die Umsetzung
- Identifizierung von Grenzen bei der Realisierung des IBRP
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Integrierten Behandlungs- und Rehabilitationsplans (IBRP) ein und beschreibt den Paradigmenwechsel hin zur personenzentrierten Versorgung in der Psychiatrie. Sie erläutert den Entstehungskontext des IBRP im Rahmen eines Forschungsprojektes des Bundesgesundheitsministeriums und hebt die Bedeutung der Personenzentriertheit als zentrale Anforderung an Hilfesysteme hervor. Die Arbeit untersucht die fachlichen Leitlinien des IBRP, deren Realisierung und die Grenzen der Umsetzung der Leitidee der Personenzentriertheit. Der Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung der fachlichen Grundlagen und der Erörterung finanzieller Aspekte im Kontext der Umsetzung.
Fachliche Grundlagen des IBRP und ihr Bezug zur Heilpädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet die fachlichen Grundlagen des IBRP, einschliesslich des historischen und fachlichen Entstehungskontextes. Es werden die Kernmerkmale des IBRP – Personenzentrierung und Lebensfeldorientierung – im Detail dargestellt und deren Bezug zur Heilpädagogik hergestellt. Der Vergleich mit dem Konzept der Inklusion aus der Behindertenpädagogik dient als Werkzeug zur Veranschaulichung der Parallelen und zur Vertiefung der heilpädagogischen Perspektive. Die Kapitel analysiert kritische Aspekte und erweitert die Perspektive durch die Betrachtung der Capabilities nach Amartya Sen, um die Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung ganzheitlich zu erfassen.
Aufbau und Verfahren des IBRP: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und das Verfahren des IBRP, beginnend mit der Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs. Es erläutert die Einbindung des IBRP in das Komplexleistungsprogramm Sozialpsychiatrische Behandlung, Rehabilitation und Eingliederung. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verfahren zur Personalbemessung und dem Gesamtzusammenhang der Realisierung, um den IBRP in ein größeres Kontext zu setzen. Es wird ein Überblick über die verschiedenen Etappen der Umsetzung und deren Bedeutung geschaffen.
Realisierung der fachlichen Grundlagen: Das zentrale Kapitel der Arbeit analysiert, wie die fachlichen Grundlagen des IBRP, erweitert um die Perspektive der Capabilities, in der Praxis umgesetzt werden. Es untersucht dies auf drei Ebenen: die Ebene der Beziehung zwischen Klient und Helfer, die organisatorische Ebene und die Ebene der Finanzierung. Der Fokus liegt auf der Auswertung von Implementationsprojekten und der Analyse der Datenlage. Dabei werden die Empfehlungen der Kommission im Vergleich zum tatsächlichen Stand der Umsetzung betrachtet, um die bestehenden Diskrepanzen zu beleuchten. Die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Realisierung werden analysiert.
Schlüsselwörter
Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP), Personenzentrierung, Lebensfeldorientierung, Heilpädagogik, Inklusion, psychische Krankheit, Rehabilitation, Personalbemessung, Komplexleistungsprogramm, Finanzierung, Umsetzung, Grenzen der Umsetzung, Capabilities.
Häufig gestellte Fragen zum Integrierten Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Integrierten Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP) aus heilpädagogischer Perspektive. Sie untersucht die fachlichen Grundlagen des IBRP, bewertet dessen Umsetzung im Versorgungssystem und beleuchtet die Frage, inwieweit die Personenzentrierung umgesetzt wird und welche Grenzen der Umsetzung bestehen. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den fachlichen Grundlagen des IBRP und deren Bezug zur Heilpädagogik, zum Aufbau und Verfahren des IBRP, zur Realisierung der fachlichen Grundlagen und eine Schlussbetrachtung. Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der fachlichen Grundlagen des IBRP, die Bewertung der Umsetzung der Personenzentrierung, die Untersuchung der Parallelen zwischen IBRP und Heilpädagogik, die Beurteilung ökonomischer Einflüsse auf die Umsetzung und die Identifizierung von Grenzen bei der Realisierung des IBRP.
Welche fachlichen Grundlagen des IBRP werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet die Kernmerkmale des IBRP, insbesondere die Personenzentrierung und die Lebensfeldorientierung. Der historische und fachliche Entstehungskontext wird ebenso betrachtet wie der Bezug zur Heilpädagogik und zum Konzept der Inklusion. Die Arbeit analysiert kritische Aspekte und bezieht die Capabilities nach Amartya Sen in die Betrachtung ein.
Wie ist der Aufbau und das Verfahren des IBRP beschrieben?
Das Kapitel zum Aufbau und Verfahren beschreibt die Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs, die Einbindung des IBRP in das Komplexleistungsprogramm Sozialpsychiatrische Behandlung, Rehabilitation und Eingliederung und das Verfahren zur Personalbemessung. Es gibt einen Überblick über die verschiedenen Etappen der Umsetzung.
Wie wird die Realisierung der fachlichen Grundlagen analysiert?
Die Realisierung der fachlichen Grundlagen wird auf drei Ebenen untersucht: die Ebene der Beziehung zwischen Klient und Helfer, die organisatorische Ebene und die Ebene der Finanzierung. Die Analyse basiert auf der Auswertung von Implementationsprojekten und der Datenlage, wobei die Empfehlungen der Kommission mit dem tatsächlichen Stand der Umsetzung verglichen werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP), Personenzentrierung, Lebensfeldorientierung, Heilpädagogik, Inklusion, psychische Krankheit, Rehabilitation, Personalbemessung, Komplexleistungsprogramm, Finanzierung, Umsetzung, Grenzen der Umsetzung, Capabilities.
Wie ist der Bezug zur Heilpädagogik hergestellt?
Der Bezug zur Heilpädagogik wird hergestellt durch den Vergleich der Kernmerkmale des IBRP (Personenzentrierung und Lebensfeldorientierung) mit heilpädagogischen Prinzipien und dem Konzept der Inklusion. Die Arbeit untersucht Parallelen und Unterschiede und erweitert die Perspektive durch die Betrachtung der Capabilities nach Amartya Sen.
Welche Rolle spielen ökonomische Faktoren?
Die Arbeit untersucht den Einfluss ökonomischer Faktoren auf die Umsetzung des IBRP, insbesondere auf der Ebene der Finanzierung. Es wird analysiert, inwieweit finanzielle Aspekte die Realisierung der personenzentrierten Versorgung beeinflussen.
Welche Grenzen der Umsetzung werden identifiziert?
Die Arbeit identifiziert die Grenzen der Umsetzung des IBRP auf verschiedenen Ebenen (Beziehungsebene, Organisationsebene, Finanzierungsebene) und beleuchtet Diskrepanzen zwischen den Empfehlungen der Kommission und dem tatsächlichen Stand der Umsetzung.
- Citar trabajo
- Christina Nerlich (Autor), 2005, Der Integrierte Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83111