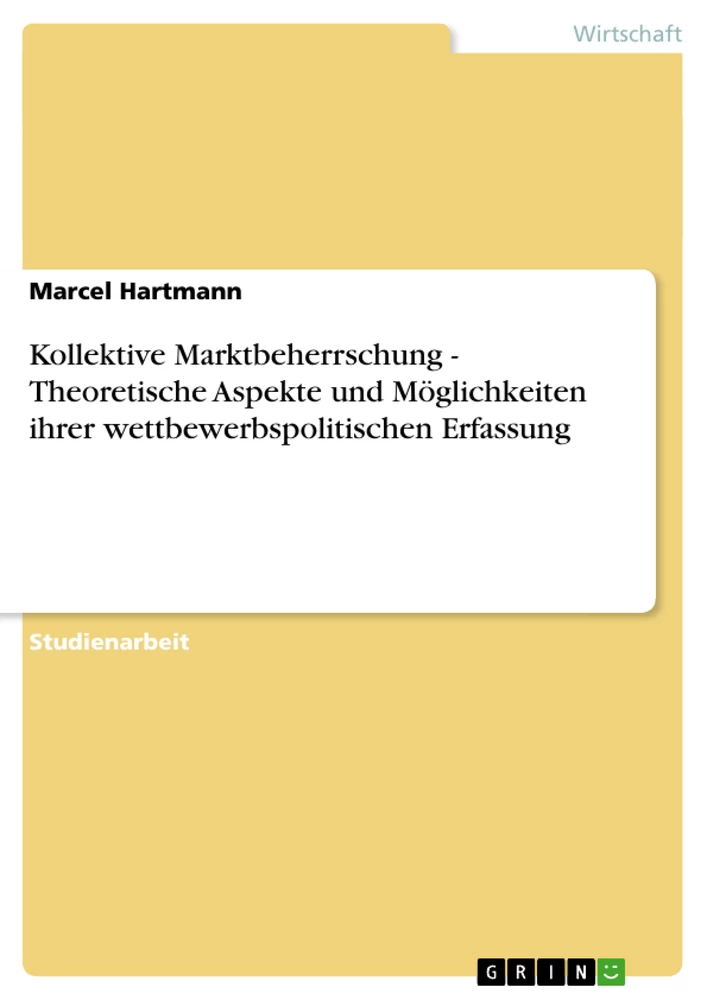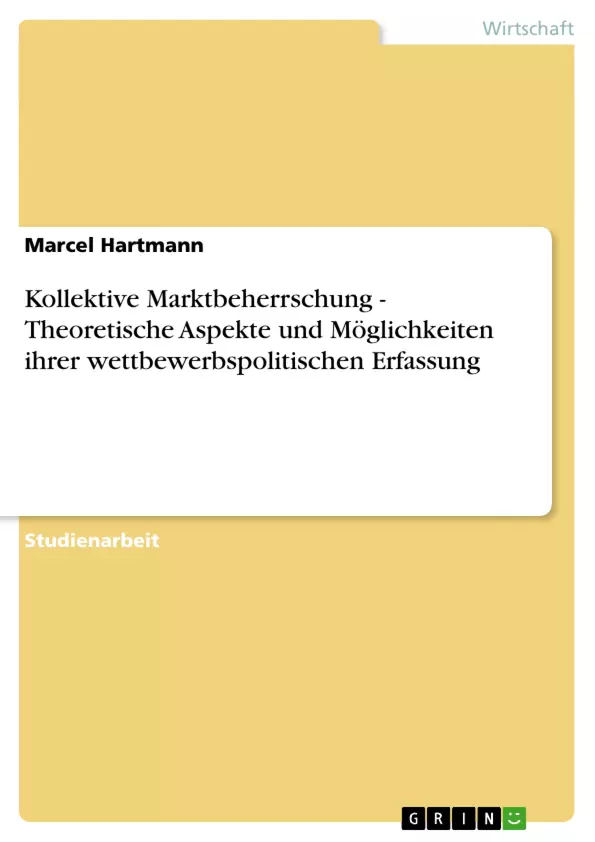Wettbewerb im Sinne eines dynamischen Prozesses ist ein Grundpfeiler der Marktwirtschaft. Deshalb ist es Voraussetzung seitens der Politik, Regelungen in der Hinsicht zu schaffen, dass wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen möglichst nicht zu Tage treten, damit sich ein reibungsloser Ablauf marktwirtschaftlicher Prozesse vollziehen kann. Über den Begriff der allgemeinen Marktbeherrschung existiert in der wirtschaftswissenschaftlichen und juristischen Literatur weitgehender Konsens. Das Konstrukt der kollektiven Marktbeherrschung hingegen ist insofern als schwierig anzusehen, als dass zwecks Mangel an (ökonomischer) Theorie keine klaren Normen und Maßregeln anzuwenden sind. Nachdem Fragestellungen zu oligopolistischer Marktbeherrschung in der Vergangenheit zumeist eher sekundär betrachtet wurden, rückte die Frage kollektiver Marktbeherrschung in den 1990er Jahren stärker in den Vordergrund. Dies erfolgte, da Fälle auftraten, bei denen die Europäische Kommission (EK) darüber zu entscheiden hatte, ob Zusammenschlüssen von Unternehmen, die nach Fusion eine potentiell marktbeherrschende Stellung begründen könnten, zugestimmt werden kann oder ob diese abzulehnen sind, da es zu Widersprüchen mit den Grundsätzen des Wettbewerbes kommen könnte. Hierbei gestaltete es sich als schwierig, wissenschaftlich fundierte Hinweise dafür zu finden, ob eine kollektiv marktbeherrschende Stellung vorliegt bzw. vorliegen wird oder nicht, da keine klare rechtliche Norm im Sinne einer Legaldefinition hierfür existiert.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es, die theoretischen Aspekte einer kollektiven Marktbeherrschung und deren wettbewerbspolitische Erfassungsmöglichkeit darzustellen. Dabei soll versucht werden, die Frage zu beantworten, ob potentiell kollektiv marktbeherrschende Unternehmen die Möglichkeit besitzen, so am Markt zu agieren als seien sie eine einzelne Unternehmung . Hierzu werden im zweiten Kapitel die rechtlichen und im dritten Kapitel die wirtschaftstheoretischen Grundlagen dargestellt, wobei auch auf spieltheoretische Erklärungsmöglichkeiten eingegangen wird. Im Anschluss wird das Problem kollektiver Marktbeherrschung an drei Musterfällen der europäischen Fusionskontrolle exemplifiziert, woran sich das fünfte Kapitel mit den Erfassungsmöglichkeiten kollektiver Marktbeherrschung anschließt. Abschließend wird im sechsten Kapitel auf wettbewerbspolitische Maßnahmen eingegangen und im siebten Kapitel ein Resümee gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff der kollektiven Marktbeherrschung
- Begriffsdefinition
- Rechtliche Grundlagen
- Deutsches Recht
- EU-Recht
- FKVO
- Zuständigkeiten bei der Fusionskontrolle
- Wirtschaftstheoretische Grundlagen
- Oligopoltheorie
- Kurze Grundlagen
- Einseitige Effekte
- Koordinierte Effekte
- Einbeziehung der Oligopolproblematik in die Fusionskontrolle im Kontext kollektiver Marktbeherrschung
- Kurze Grundlagen
- Konkurrenz als iterativer Prozess
- Spieltheoretische Implikation und Neue Industrieökonomik
- Ausblick: Einbeziehung der evolutorischen Ökonomik in den Kontext kollektiver Marktbeherrschung
- Oligopoltheorie
- Musterfälle der europäischen Fusionskontrolle
- Der Fall Nestlé/Perrier
- Der Fall Kali & Salz/Mitteldeutsche Kali
- Der Fall Airtours/First Choice
- Erfassungsmöglichkeiten kollektiver Marktbeherrschung
- Marktvoraussetzungen
- Transparenz
- Abschreckung
- Reaktion von Wettbewerbern und Kunden
- Kollektive Marktbeherrschung und Kapazitätskoordination in Industrien mit großen irreversiblen Investitionen
- Testverfahren
- Marktvoraussetzungen
- Wettbewerbspolitische Konsequenzen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der kollektiven Marktbeherrschung. Ziel ist es, die theoretischen Aspekte dieses Konzepts und die Möglichkeiten seiner wettbewerbspolitischen Erfassung darzustellen. Die Arbeit versucht zu beantworten, ob Unternehmen, die potenziell eine kollektiv marktbeherrschende Stellung einnehmen, am Markt so agieren können, als seien sie eine einzelne Unternehmung.
- Rechtliche Grundlagen der kollektiven Marktbeherrschung im deutschen und EU-Recht
- Wirtschaftstheoretische Grundlagen der kollektiven Marktbeherrschung, insbesondere die Oligopoltheorie und Spieltheorie
- Analyse von Musterfällen der europäischen Fusionskontrolle im Hinblick auf kollektive Marktbeherrschung
- Erfassungsmöglichkeiten und Testverfahren zur Identifizierung kollektiver Marktbeherrschung
- Wettbewerbspolitische Konsequenzen und Herausforderungen im Umgang mit kollektiver Marktbeherrschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und den Aufbau der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen der kollektiven Marktbeherrschung im deutschen und EU-Recht vorgestellt. Kapitel drei behandelt die relevanten wirtschafts- und spieltheoretischen Grundlagen und beleuchtet die Problematik der kollektiven Marktbeherrschung im Kontext der Fusionskontrolle. Die Kapitel vier und fünf beleuchten die Problematik anhand von exemplarischen Fällen der europäischen Fusionskontrolle und gehen auf Erfassungsmöglichkeiten kollektiver Marktbeherrschung ein. Schließlich werden in Kapitel sechs wettbewerbspolitische Konsequenzen und in Kapitel sieben Schlussbemerkungen abgegeben.
Schlüsselwörter
Kollektive Marktbeherrschung, Oligopol, Spieltheorie, Fusionskontrolle, Marktbeherrschung, Wettbewerb, EU-Recht, FKVO, Markttransparenz, Kapazitätskoordination, Irreversibilität, Testverfahren, Wettbewerbspolitik, Rechtssicherheit, Preisabsprachen, stillschweigende Koordination
Häufig gestellte Fragen
Was ist kollektive Marktbeherrschung?
Sie beschreibt eine Situation in einem Oligopol, in der eine kleine Gruppe von Unternehmen gemeinsam den Wettbewerb behindern kann, ohne explizite Absprachen zu treffen.
Wie wird kollektive Marktbeherrschung rechtlich erfasst?
Die Erfassung erfolgt primär über die europäische Fusionskontrollverordnung (FKVO) und nationales Wettbewerbsrecht (GWB).
Welche Rolle spielt die Spieltheorie bei der Analyse?
Die Spieltheorie hilft zu erklären, warum Unternehmen in einem Oligopol ein koordiniertes Verhalten (stillschweigende Kollusion) entwickeln können.
Welche Marktvoraussetzungen begünstigen kollektive Dominanz?
Hohe Markttransparenz, Markteintrittsbarrieren und die Möglichkeit zur gegenseitigen Abschreckung sind wesentliche Faktoren.
Welche bekannten Fälle gab es in der EU-Fusionskontrolle?
Wichtige Musterfälle sind Nestlé/Perrier, Kali & Salz sowie Airtours/First Choice.
- Arbeit zitieren
- Marcel Hartmann (Autor:in), 2006, Kollektive Marktbeherrschung - Theoretische Aspekte und Möglichkeiten ihrer wettbewerbspolitischen Erfassung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83151