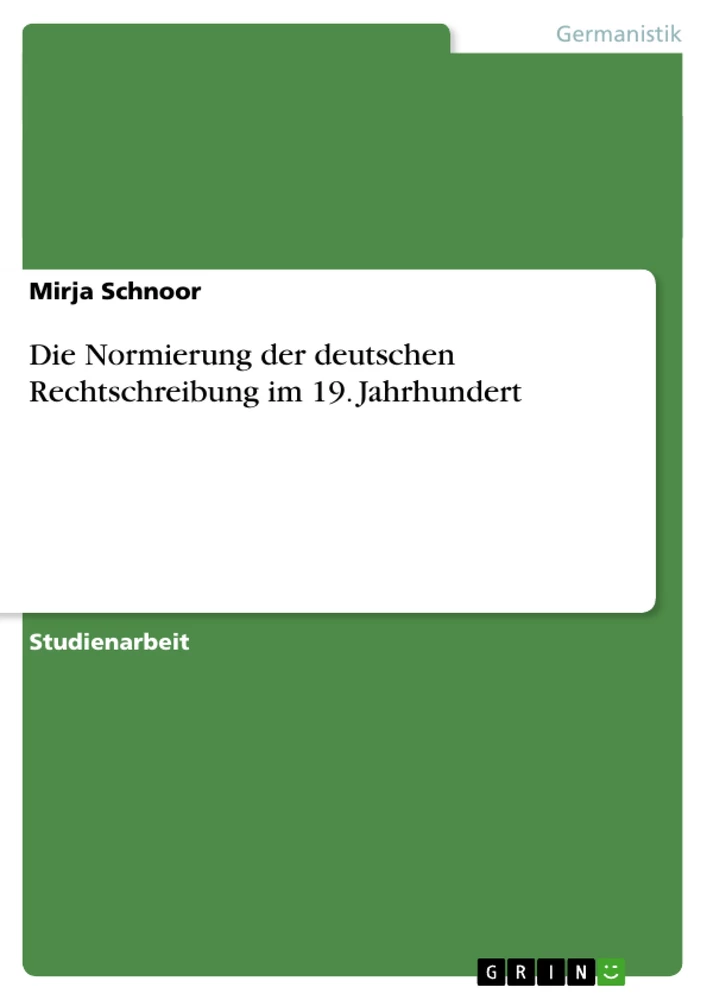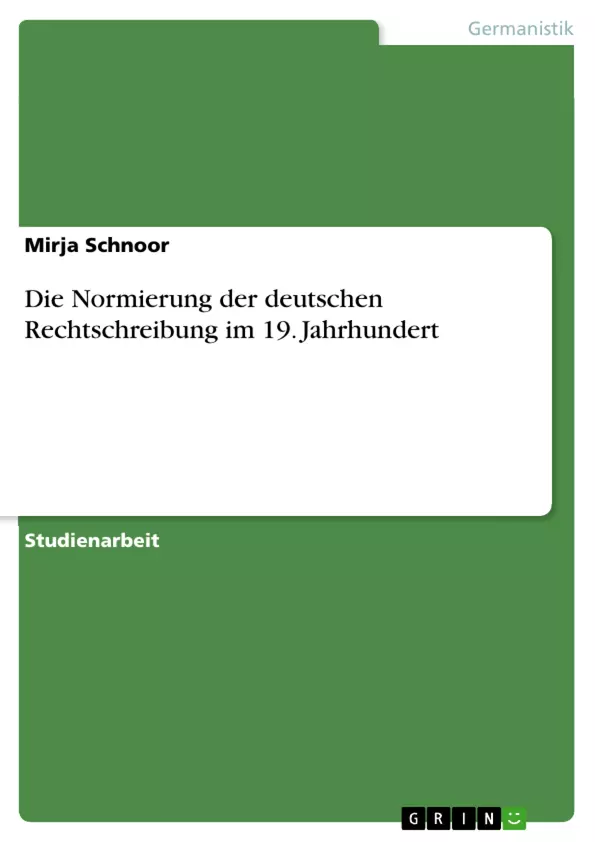Eine weit verbreitete Annahme besteht darin, dass unsere Sprache sich ‚einfach so′ im Laufe der Zeit entwickelt habe. Das mag für die Anfänge von Sprache auch zutreffen, aber im Laufe der Zeit sind eine Vielzahl von Normierungen an der deutschen Sprache vorgenommen worden.
Die romantische sprachtheorie, nach der die sprache ein organisch gewachsenes darstellt, kann mit recht als überholt betrachtet werden. Gerade die Entwicklung der letzten hundert jahre hat gezeigt, dass die sprache - in schrift und lautung - als ein produkt expliziter regulierungsvorgänge anzusehen ist, in deren rahmen varianten auf dem weg zur standardisierten norm ausgeschieden sind (BRAMMANN 1987, S. 7).
Das 19. Jahrhundert stellt in dieser Entwicklung einen Höhepunkt da - am Anfang des 19. Jahrhunderts steht eine erstmals relativ einheitliche deutsche Rechtschreibung, am Ende die gesetzliche Festlegung derselben. Eine Besonderheit des 19. Jahrhunderts ist es auch, dass sich erstmals die Obrigkeit in Belange der Rechtschreibung einmischte. Sprachnormierung war bis dahin meist durch Vorbild von Schreibenden (Luther, Goethe etc.) entstanden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts begannen immer mehr Sprachwissenschaftler, sich mit der Suche nach der ‚richtigen′ deutschen Orthographie zu beschäftigen und ihre Konzepte in Regelwerken darzulegen. Am Ende des Normierungsprozesses waren es jedoch die Behörden, die sich für die deutsche Einheitsorthographie ein- und sie letztendlich auch durchsetzten.
Dieser Prozess der Entstehung der einheitlichen deutschen Orthographie soll im Folgenden näher untersucht werden. Dabei wird der nahe verwandte Bereich ‚Lautung′ nicht explizit beleuchtet, da sich die ‚richtige′ Aussprache schwerlich per Gesetz regeln lässt und die Diskussion darüber folglich nie so stark geführt wurde. Nichtsdestotrotz ist auch die ‚richtige′ Aussprache ein Bereich, der oft Ziel von Normierungsbestrebungen war - allerdings eher durch subsistente Normen wie gesellschaftliches Ansehen bzw. gesellschaftliche Ächtung eines Dialekts etc. als durch in Form von Gesetzen statuierte Normen.
Eine chronologische Vorgehensweise erscheint mir bei der Beschäftigung mit der Schaffung der deutschen Einheitsorthographie am geeignetsten, da so die verschiedenen Stufen der Entwicklung deutlich werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Begriffe „Sprachnorm" und „Sprachnormierung"
- 2. Vorgeschichte - Die Grammatiker
- 3. Reforminitiativen im 19. Jahrhundert
- 3. 1 Gründe für das Streben nach Normierung
- 3. 2 Die historische Richtung
- 3. 3 Die phonetische Richtung
- 3. 3. 1 Der führende Vertreter der phonetischen Richtung: Rudolf von Raumer
- 4. Staatliche Normierungsbestrebungen
- 4. 1 Normierungsversuche der Schulbehörden einzelner Städte und Staaten
- 4. 2 Normierungsbestrebungen auf Reichsebene
- 4. 2. 1 Die I. Orthographische Konferenz (1876)
- 4. 2. 2 Die preußische Schulorthographie und die Schreibung des BGB
- 4. 2. 3 Die II. Orthographische Konferenz (1901)
- 5. Die Durchsetzung der deutschen Einheitsorthographie
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der deutschen Einheitsorthographie im 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Entstehung und Durchsetzung einer einheitlichen deutschen Rechtschreibung, ausgehend von den Anfängen des 19. Jahrhunderts, wo eine erstmals relativ einheitliche Rechtschreibung existierte, bis hin zur gesetzlichen Festlegung derselben Ende des Jahrhunderts.
- Die Rolle der Grammatiker im 19. Jahrhundert und deren Einfluss auf die Verbreitung orthographischer Anweisungen
- Die verschiedenen Reforminitiativen des 19. Jahrhunderts und die unterschiedlichen Ansätze zur Normierung der deutschen Sprache
- Die Einmischung der Obrigkeit in die Rechtschreibung und die Entstehung von staatlichen Normierungsbestrebungen
- Die Bedeutung der Orthographischen Konferenzen für die Entwicklung der Einheitsorthographie
- Die Durchsetzung der deutschen Einheitsorthographie durch Behörden
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Sprachnormierung in der Entwicklung der deutschen Sprache dar und setzt den Fokus auf die Relevanz des 19. Jahrhunderts in diesem Prozess.
- 1. Die Begriffe „Sprachnorm" und „Sprachnormierung": Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen Arten von Sprachnormen und fokussiert auf die Bedeutung von statuierten Normen für die Rechtschreibung.
- 2. Vorgeschichte - Die Grammatiker: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Grammatikern wie Heyse, Becker und Adelung in der Entwicklung einer einheitlichen deutschen Orthographie im 18. und frühen 19. Jahrhundert.
- 3. Reforminitiativen im 19. Jahrhundert: Das Kapitel analysiert die verschiedenen Reforminitiativen des 19. Jahrhunderts, darunter die historische und die phonetische Richtung. Es zeigt die Gründe für das Streben nach Normierung auf.
- 4. Staatliche Normierungsbestrebungen: Dieses Kapitel schildert die zunehmenden Bemühungen der Behörden, die Rechtschreibung zu standardisieren. Es beleuchtet Normierungsversuche auf lokaler Ebene sowie auf Reichsebene, inklusive der Orthographischen Konferenzen.
- 5. Die Durchsetzung der deutschen Einheitsorthographie: Das Kapitel beschreibt, wie die deutsche Einheitsorthographie, die durch die Behörden gefördert wurde, sich schließlich durchsetzte.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Deutsche Rechtschreibung, Sprachnormierung, Einheitsorthographie, Grammatik, Reforminitiativen, Staatliche Normierung, Orthographische Konferenzen.
- Arbeit zitieren
- Mirja Schnoor (Autor:in), 2002, Die Normierung der deutschen Rechtschreibung im 19. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8320