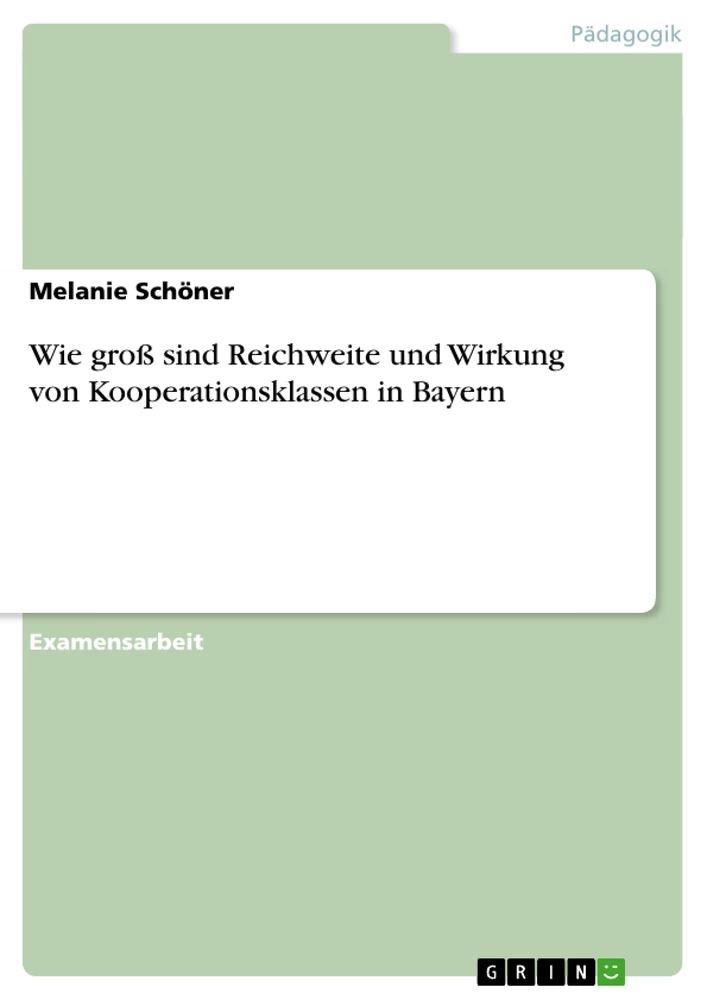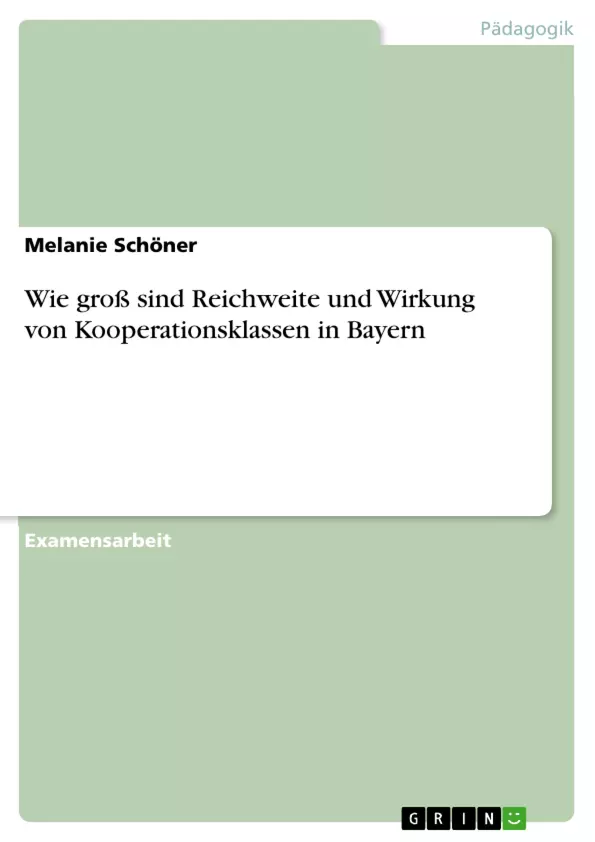Neben verschiedenen anderen Elementen rückt im Bereich der Integration das Modell der Kooperationsklasse immer mehr in den Blickpunkt. Während es im Schuljahr 2003/2004 erst 190 Kooperationsklassen in Bayern gab, steigerte sich die Zahl im Schuljahr 2006/2007 auf 418 Kooperationsklassen (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2006, S. 6). Die Notwendigkeit dieser Entwicklung wird im theoretischen Teil der Arbeit anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse dargestellt. Die Herausbildung des Integrationsgedankens im Laufe der Jahre, dazu die Veränderung der Gesetzeslage in Bayern und aktuell expandierende Integrationsformen werden danach beschrieben. Im Schwerpunkt der Arbeit geht es speziell um die Integrationsform ‚Kooperationsklasse’. Nach einer Begriffsdefinition wird die pädagogische Zielsetzung geklärt, die ihr, als „Klasse für besondere pädagogische Aufgaben“ (BayEUG Art. 43 Abs. 2 Satz 1), zukommt. Die Gelegenheiten der Zusammenarbeit zwischen Sonderschullehrern, Lehrern der allgemeinen Schule und der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste gilt es dann zu erläutern sowie organisatorische Rahmenbedingungen und normative Voraussetzungen darzustellen, die für eine pädagogisch effektive Arbeit unabdingbar sind. Anschließend wird auf die Frage eingegangen, welchen Anforderungen der Unterricht in Kooperationsklassen in didaktischer und methodischer Hinsicht genügen muss. Zusätzlich sind die Formen der Leistungserhebung und Leistungsbewertung in Kooperationsklassen, unter Berücksichtigung der Möglichkeit des ‚Nachteilsausgleichs’, zu beleuchten. Danach werden die Kriterien zur Schülerauswahl dargestellt. Zum Abschluss der theoretischen Überlegungen ist es nötig, die strukturellen Aspekte zur Bildung einer Kooperationsklasse zum Ausdruck zu bringen, wie die Genehmigung und Einrichtung von Kooperationsklassen und die Bestimmung der Gruppengröße.
Im Praxisteil gilt es, mittels einer Lehrerbefragung, herauszuarbeiten, inwieweit die alltägliche pädagogische Arbeit in Kooperationsklassen den theoretischen Ansprüchen gerecht wird. Dazu wird die Einschätzung der Befragten anhand von Schaubildern dargestellt und analysiert. Die vergleichende Gegenüberstellung zwischen den gewonnenen Daten aus der Schulpraxis und den theoretischen Grundlagen gibt schließlich den Blick auf Möglichkeiten einer weiteren Optimierung frei.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretische Grundlagen
- 1.0 Begründungen für gemeinsames Lernen
- 1.1 Wissenschaftliche Erkenntnisse
- 1.2 Schulversuche
- 1.3 Ethisch-normative Begründungen
- 1.4 Gesetzliche Verankerung
- 2.0 Aktuell expandierende integrative Schulformen in Bayern
- 2.1 Übersicht
- 2.1 Aussenklasse
- 2.2 Öffnung der Förderschulen
- 2.3 Einzelintegration
- 3.0 Kooperationsklassen
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 3.2. Rechtliche Grundlagen
- 3.3 Pädagogische Zielsetzung
- 3.4. Kooperationspartner
- 3.4.1 Lehrpersonal
- 3.4.2 Unterstützung durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste (MSD)
- 3.5 Organisatorische Rahmenbedingungen
- 3.6 Normative Voraussetzungen
- 3.7 Anforderungen an den Unterricht in Kooperationsklassen
- 3.8 Kriterien zur Auswahl der Kooperationsschüler
- 3.9 Leistungsfeststellung und –bewertung
- 3.10. Strukturelle Aspekte
- 3.10.1 Genehmigung und Einrichtung
- 3.10.2 Bestimmung der Lerngruppe
- III. Praxis
- 4.0 Darstellung und Analyse der Ergebnisse zur Lehrerbefragung
- 4.1 Vorbemerkung
- 4.2. Lehrer, Schüler, Eltern
- 4.2.1 Beweggründe zur Übernahme einer Kooperationsklasse
- 4.2.2 Klassengröße
- 4.2.3 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- 4.2.4 Soziale Integration
- 4.2.5 Unterstützung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch deren Eltern
- 4.2.6 Einstellung der Schülereltern ohne sonderpädagogischem Förderbedarf
- 4.3 Organisation
- 4.3.1 Zeitpunkt des Schulwechsels
- 4.3.2 Auswahlkriterien für eine Kooperationsklasse
- 4.3.3 Unterstützung der Lehrer
- 4.3.4 Förderung durch die MSD
- 4.4 Lehrplan
- 4.4.1 Didaktik und Methodik
- 4.4.2 Zeitliche Aufwendungen
- 4.5 Leistungserhebung
- 4.5.1 Curriculare Anschlussfähigkeit
- 4.5.2 Leistungsüberprüfung
- 4.6 Bewertung der Integrationsform
- 4.6.1 Vorzüge des Modells
- 4.6.2 Persönliche Belastungen
- 4.6.3 Verbesserungsmöglichkeiten
- IV. Perspektive
- 5.0 Reflexion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie groß Reichweite und Wirkung von Kooperationsklassen in Bayern sind. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des Integrationsmodells Kooperationsklasse darzustellen und die Praxis anhand einer Lehrerbefragung zu beleuchten.
- Ethisch-normative Begründungen für gemeinsames Lernen
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Bildung von Kooperationsklassen
- Pädagogische Zielsetzungen von Kooperationsklassen
- Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und MSD
- Anforderungen an den Unterricht in Kooperationsklassen
Zusammenfassung der Kapitel
- Im ersten Kapitel wird die Aktualität des Themas Kooperationsklasse in Bayern aufgezeigt und die Gliederung der Arbeit erläutert.
- Kapitel Zwei beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Integrationsmodells. Hier werden wissenschaftliche Erkenntnisse, Schulversuche, ethisch-normative Begründungen und die gesetzliche Verankerung beleuchtet. Außerdem werden die in Bayern gängigen Integrationsformen wie Außenklasse, Öffnung der Förderschulen und Einzelintegration dargestellt. Im Mittelpunkt steht die Definition, die rechtlichen Grundlagen, die pädagogischen Ziele und die Bedeutung der Kooperationspartner im Modell der Kooperationsklasse.
- Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse einer Lehrerbefragung über die Praxis an Kooperationsklassen dargestellt und analysiert. Die Schwerpunkte liegen auf den Beweggründen der Lehrer zur Übernahme einer Kooperationsklasse, der Klassengröße, den Schülerzahlen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, der sozialen Integration, der Unterstützung der Schüler durch ihre Eltern, der Einstellung der Eltern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, den zeitlichen Bedingungen, der Unterrichtsgestaltung und der Leistungserhebung. Die Vorzüge und Nachteile des Modells für die Lehrer, die Schule, die Schüler und die Eltern werden im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Bayern. Es werden die verschiedenen Integrationsformen, insbesondere die Kooperationsklasse, analysiert. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen auf den rechtlichen Grundlagen, den pädagogischen Zielen, den Kooperationspartnern und den Anforderungen an den Unterricht. Die Lehrerbefragung beleuchtet die Praxis an Kooperationsklassen und ermöglicht einen kritischen Blick auf die Reichweite und Wirkung des Modells.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Kooperationsklasse in Bayern?
Eine Kooperationsklasse ist eine Form der schulischen Integration, bei der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit Schülern ohne Förderbedarf an einer Regelschule unterrichtet werden.
Welche Rolle spielen die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste (MSD)?
Die MSD unterstützen die Lehrer der Regelschule durch Beratung, Diagnostik und gezielte Förderung der Integrationsschüler.
Wie hat sich die Zahl der Kooperationsklassen entwickelt?
Die Zahl stieg in Bayern deutlich an, von 190 Klassen im Schuljahr 2003/2004 auf 418 im Jahr 2006/2007.
Was ist der "Nachteilsausgleich"?
Ein Instrument der Leistungsbewertung, das sicherstellt, dass Schüler mit Förderbedarf aufgrund ihrer Beeinträchtigung bei Prüfungen nicht benachteiligt werden.
Wie bewerten Lehrer das Modell der Kooperationsklasse?
Die Arbeit enthält eine Praxisbefragung, die Vorzüge wie soziale Integration, aber auch persönliche Belastungen und organisatorische Herausforderungen für die Lehrkräfte aufzeigt.
- 4.0 Darstellung und Analyse der Ergebnisse zur Lehrerbefragung
- 1.0 Begründungen für gemeinsames Lernen
- Quote paper
- Melanie Schöner (Author), 2007, Wie groß sind Reichweite und Wirkung von Kooperationsklassen in Bayern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83230