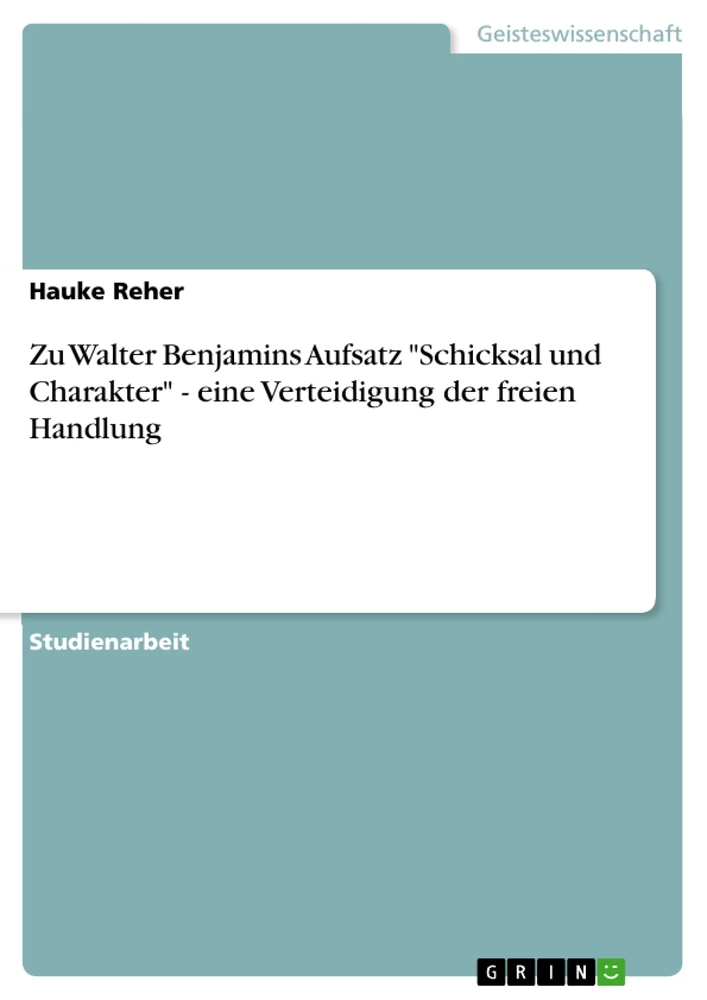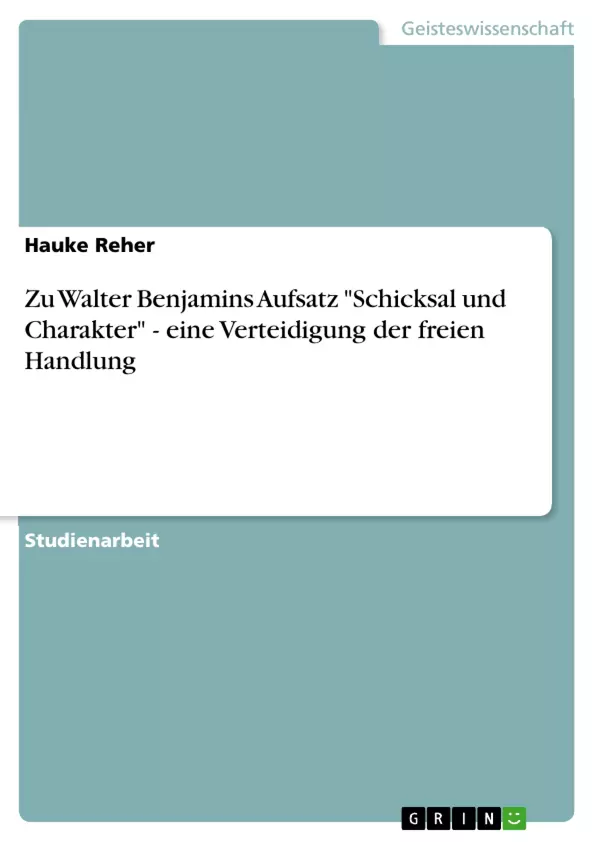Benjamins Aufsatz von 1919 ist von einem für ihn typischen Ansatz gekennzeichnet. Nicht unmittelbar stürzt er sich in die Wirrungen des ausgewählten Sujets, sondern er lädt den Leser ein, sich mit ihm auf eine Erkenntnisreise zu begeben. Mittels der Darbietung von allgemeinen Meinungen, wie in „Schicksal und Charakter“, oder einer Schilderung von grundlegenden Thesen nimmt er den Leser, selbst sich als Leser offenbarend, an die Hand. Nicht aus den Fachbüchern, sondern aus dem Leben, aus dem Volk, aus den Büchern für das Volk hat er abgelesen. Allerdings hat er sich mit dem Ablesen nicht zufrieden gegeben, denn Benjamin wollte vom Ablesen zum Lesen selber kommen , zu dem, was ihm das Innere einer Sache selbst zu berichten hat. Der Ort der Wahrheit ist nach Benjamin nicht das Gemeine, welches zur Vermischung von Sphären neigt. Jede Existenz hat eine ihr eigene Authentizität, und die Wahrheit ist nicht eine Tatsache, die sich aus den Verbindungen ergibt .
Was Benjamin im angesprochenen Aufsatz motiviert, ist die Erfahrung von einem Sein, von etwas, was er in sich vorfindet, doch das diese Existenz sich nicht deckt mit dem gängigen Verständnis. So scheinen seine Einleitungen gleichzeitig Erklärungen für sein Vorhaben zu sein. Gerade wo Benjamin Ungerechtigkeiten vermutet, wird sein Verlangen nach Wahrheit, nach der Innerlichkeit eines Sachverhalts lebendig. Er strebt, den Gehalt auszuleuchten, das, was die Zeit überdauert und über den gegenwärtigen Konstellationen liegt. Dabei ist der Inhalt nicht an die Darstellung gebunden, sondern Wörter und Namen sollen „etwas mitteilen (außer sich selbst).“
Nur der Umweg, so Benjamins Methode, führt aus dem Alltäglichen in die Welt der Ideen. Und dieser Umweg muss nicht selten fälschliche Annahmen wie Geröll aus dem Weg räumen, um in die reineren Gefilde vordringen zu können. Zumindest bis an die Grenze, wo das Konkrete an das nicht mehr Mitteilbare stößt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorbemerkungen
- II. Benjamins Hinführung
- II.1 Kausalität und Vorhersage
- II.2 Vom Wirken und Walten im Menschenleben
- III. Schicksal
- III.1 Irrtümliche Verbindungen
- III.2 Fehlendes Glück, Religiosität und Recht als Überrest
- III.3 Held der Tragödie
- IV. Charakter
- IV.1 Ethik des Charakters oder Moral der Handlung
- IV.2 Charakter der komischen Person
- IV.3 Sonne am farblosen Himmel
- V. Der Schicksalsbegriff in weiteren Schriften Benjamins
- VI. Nachwort
- VI.1 Die Phänomenologie und der Begriff eidos bei Benjamin
- VI.2 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Walter Benjamins Aufsatz „Schicksal und Charakter" zielt darauf ab, die beiden titelgebenden Begriffe, die im modernen Sprachgebrauch kaum mehr Verwendung finden, neu zu beleuchten und zu rehabilitieren. Benjamin beleuchtet die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext der Philosophie und der gesellschaftlichen Veränderungen des frühen 20. Jahrhunderts.
- Die Abkehr vom Schicksalsbegriff in der säkularisierten Welt
- Die Ambivalenz des Begriffs „Charakter" in der Philosophie und Psychologie
- Die Suche nach Authentizität und Wahrheit in der modernen Welt
- Die Rolle des Individuums im Kontext von Schicksal und Charakter
- Die Bedeutung von Sprache und Kultur für die philosophische Betrachtung von Schicksal und Charakter
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorbemerkungen
Benjamin stellt fest, dass die Begriffe Schicksal und Charakter im modernen Sprachgebrauch kaum mehr Verwendung finden. Er begründet dies mit der säkularisierten Welt und den Einflüssen der postmodernen Philosophie.
II. Benjamins Hinführung
Benjamin beschreibt seinen Ansatz in der philosophischen Arbeit und betont die Notwendigkeit eines „Umwegs", um in die Welt der Ideen vorzudringen. Er führt den Leser in die Thematik ein und vermittelt seine Motivation, die Begriffe Schicksal und Charakter neu zu betrachten.
III. Schicksal
Benjamin untersucht die Rolle des Schicksals in der abendländischen Kultur und Philosophie. Er kritisiert die deterministische Konnotation des Begriffs und plädiert für eine differenziertere Betrachtung. Weiterhin beleuchtet er die Verbindung zwischen Schicksal und Religiosität sowie die Rolle des Schicksals in der Tragödie.
IV. Charakter
Benjamin analysiert den Begriff des Charakters, der in der modernen Psychologie und Philosophie eine neue Bedeutung erlangt. Er hinterfragt die Vorstellung von festen Charakterzügen und thematisiert die Vielschichtigkeit des individuellen Charakters. Die philosophische Frage nach dem „Selbst" und der Bedeutung des Körpers im Kontext des Charakters werden ebenfalls angesprochen.
V. Der Schicksalsbegriff in weiteren Schriften Benjamins
Benjamin vertieft die Diskussion um den Schicksalsbegriff anhand weiterer Schriften, die in seiner Arbeit „Schicksal und Charakter" eine wichtige Rolle spielen.
Schlüsselwörter
Schicksal, Charakter, Säkularisierung, Postmoderne, Authentizität, Wahrheit, Individuum, Sprache, Kultur, Philosophie, Psychologie, Tragödie, Selbst, Körper
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Walter Benjamins Aufsatz "Schicksal und Charakter"?
Benjamin untersucht die philosophische Bedeutung der Begriffe Schicksal und Charakter und kritisiert deren oberflächliche Verwendung in einer säkularisierten Welt.
Warum lehnt Benjamin ein rein kausales Verständnis von Schicksal ab?
Benjamin sieht im Schicksal keinen bloßen Determinismus, sondern verbindet es mit religiösen und rechtlichen Überresten, die in der modernen Welt oft missverstanden werden.
Welche Rolle spielt die Tragödie in Benjamins Analyse?
Der "Held der Tragödie" dient Benjamin als Beispiel, um das Wirken des Schicksals im Gegensatz zur moralischen Handlung zu verdeutlichen.
Wie definiert Benjamin den Begriff Charakter?
Er hinterfragt die Vorstellung von festen Charakterzügen und betrachtet den Charakter eher im Kontext von Ethik und der komischen Person.
Was versteht Benjamin unter der Methode des "Umwegs"?
Für Benjamin führt die Wahrheit nicht über den direkten Weg des Gemeinplatzes, sondern über einen reflexiven Umweg, der fälschliche Annahmen beiseite räumt.
- Arbeit zitieren
- Hauke Reher (Autor:in), 2007, Zu Walter Benjamins Aufsatz "Schicksal und Charakter" - eine Verteidigung der freien Handlung , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83262