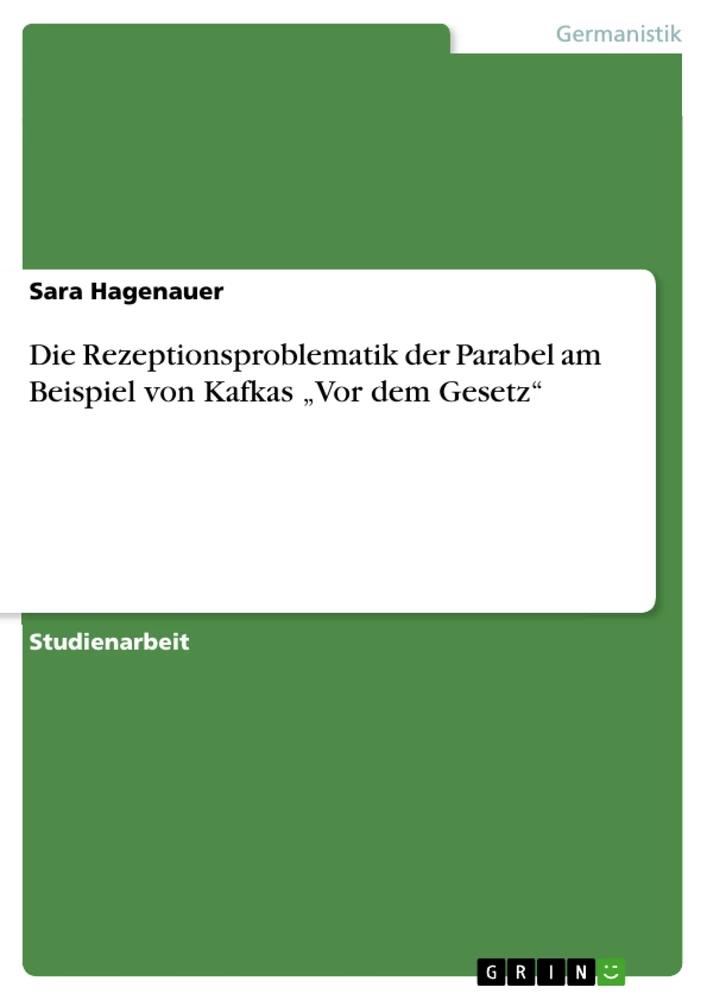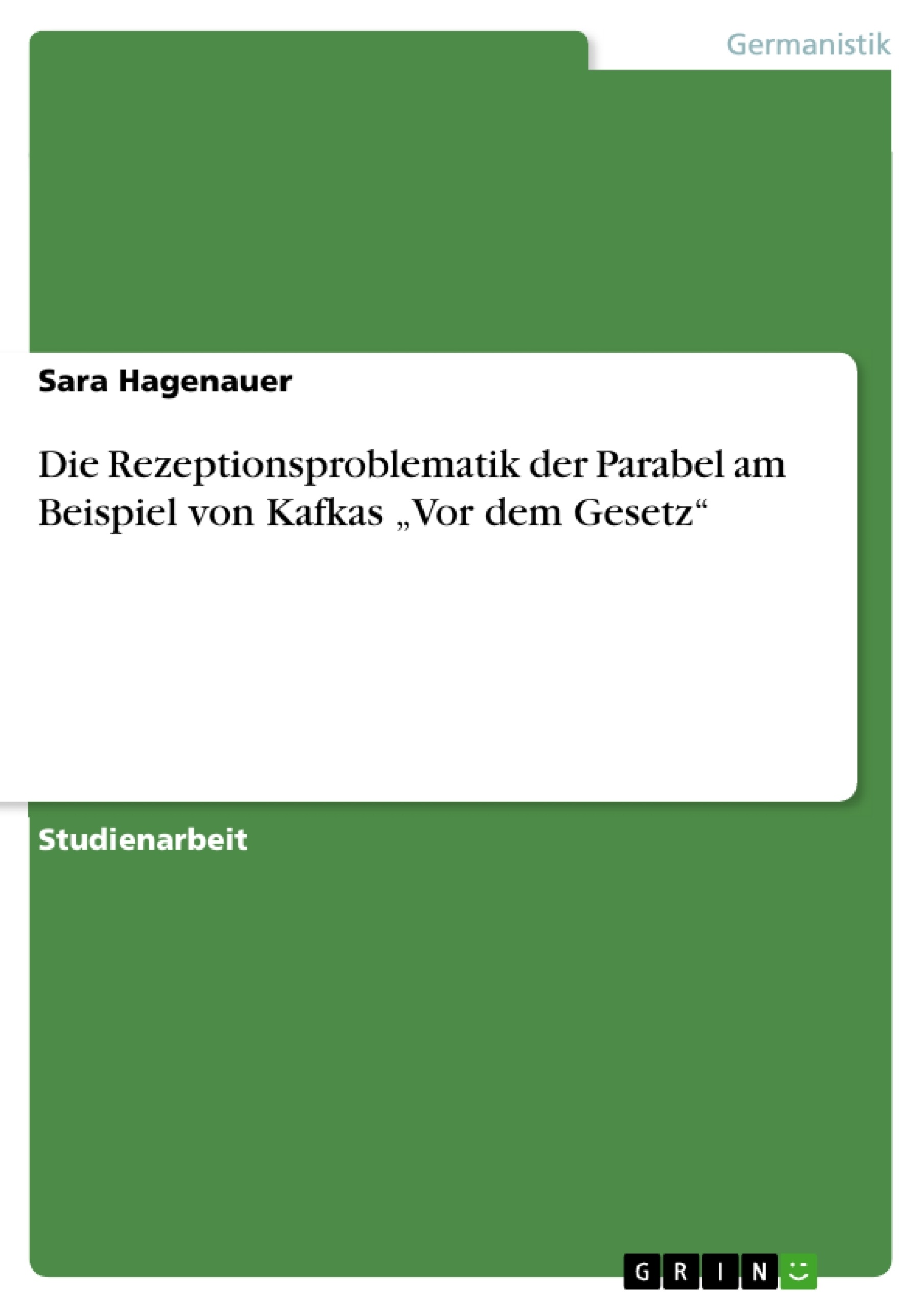Die Parabel ist eine Schriftform, deren Abgrenzung zu anderen Textsorten immer noch ebenso umstritten ist wie ihre Existenz als eigenständige literarische Gattung. Obwohl schon im Mittelalter Schriftstücke mit parabelartigen Zügen existierten fiel die Parabel selbst seit ihrer Etablierungsphase ab 1646 immer wieder dem aktuellen Zeitgeist zum Opfer, so dass ihre Geschichte nie von kontinuierlicher Präsenz geprägt war. Erst seit ihrer Erneuerungsphase ab 1913 hat die Parabel wieder verstärkte Aufmerksamkeit erlangt. Trotzdem ist eine vollständige Etablierung der Parabel als eigenständige Literaturgattung heutzutage nach wie vor umstritten.
Mit verantwortlich hierfür ist sicherlich die Rezeptionsproblematik der Parabel. Durch die Eigenart, das Erzählte stets symbolisch auf eine sehr verrätselte Art und Weise darzustellen, stoßen die Leser bei der Deutung solcher Texte oftmals auf Schwierigkeiten. Die Rückkehr der Parabel ab 1913 ist zumindest zum Teil dem Wirken Franz Kafkas zuzuschreiben.
Die Rezeptionsprobleme der Parabel sind sicherlich auch bei den Werken Kafkas gegeben. Die von ihm verfassten Texte, die sich als Parabeln klassifizieren lassen, sind durch ihre besondere Fremdartigkeit und die Zulassung vieler möglicher Interpretationsansätze gekennzeichnet. Sie bieten daher ein gutes Beispiel zur genaueren Analyse der Rezeptionsschwierigkeiten der Parabel. Trotz einiger Ansätze bezüglich dieser Thematik ist eine gründliche Untersuchung der Rezeptionsproblematik der Parabel in der Forschungsliteratur bisher weitestgehend vernachlässigt worden. Im Laufe der vorliegenden Arbeit sollen daher untersucht werden, worin genau die Rezeptionsprobleme der Parabel liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gattungstheorie der Parabel
- Definition des Begriffs „Parabel“
- Allgemeine Rezeptionstheorien
- Anwendung der Theorien auf Kafkas „Vor dem Gesetz“
- Klassifizierung des Textes als Parabel
- Rezeptionsanalytische Interpretation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeptionsproblematik der Parabel anhand Franz Kafkas „Vor dem Gesetz“. Ziel ist es, die Schwierigkeiten bei der Interpretation von Parabeln zu analysieren und zu verstehen, warum diese literarische Form oft als schwierig empfunden wird. Die Arbeit beleuchtet die gattungstheoretischen Grundlagen der Parabel und wendet diese dann auf Kafkas Text an.
- Definition und Merkmale der Parabel
- Allgemeine Rezeptionstheorien der Parabel
- Klassifizierung von Kafkas „Vor dem Gesetz“ als Parabel
- Rezeptionsanalytische Interpretation von Kafkas „Vor dem Gesetz“
- Die Schwierigkeiten der Interpretation parabolischer Texte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Rezeptionsproblematik der Parabel ein. Sie betont die Uneinheitlichkeit in der Definition der Parabel als literarische Gattung und deren wechselhafte Geschichte. Die Arbeit konzentriert sich auf die Schwierigkeiten, die Leser bei der Interpretation parabolischer Texte haben und wählt Kafkas „Vor dem Gesetz“ als Fallbeispiel aufgrund seiner besonderen Fremdartigkeit und der Vielzahl möglicher Interpretationen. Der Fokus liegt auf der Klärung der Rezeptionsprobleme, wobei die Einleitung bereits die methodische Vorgehensweise der Arbeit skizziert.
2. Die Gattungstheorie der Parabel: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Rezeptionsproblematik der Parabel dar. Es beginnt mit der Definition des Begriffs „Parabel“, wobei die Uneinheitlichkeit in der Forschungsliteratur hervorgehoben wird. Es werden die wichtigsten Merkmale identifiziert, die in den meisten Untersuchungen übereinstimmen, wie die bildhafte Erzählung, die metaphorische Ausdrucksweise und das Erfordernis der Deutung. Der Text beschreibt die Sachebene und die Bildebene der Parabel und die Rolle des Tertium comparationis. Der Rezipient wird als notwendiges drittes Glied im Deutungsprozess betrachtet. Schließlich wird die oft diskutierte, aber nicht zwingende, Kürze der Parabel als Kriterium erwähnt.
Schlüsselwörter
Parabel, Rezeption, Interpretation, Franz Kafka, „Vor dem Gesetz“, Gattungstheorie, Rezeptionstheorie, bildhafte Erzählung, Metapher, Symbol, Deutung, Tertium comparationis.
Häufig gestellte Fragen zu Kafkas "Vor dem Gesetz"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rezeptionsproblematik der Parabel am Beispiel von Franz Kafkas "Vor dem Gesetz". Sie untersucht die Schwierigkeiten bei der Interpretation von Parabeln und beleuchtet die gattungstheoretischen Grundlagen, um diese Schwierigkeiten zu verstehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Merkmale der Parabel, allgemeine Rezeptionstheorien, die Klassifizierung von Kafkas "Vor dem Gesetz" als Parabel, eine rezeptionsanalytische Interpretation des Textes und die Schwierigkeiten der Interpretation parabolischer Texte im Allgemeinen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Gattungstheorie der Parabel, einem Kapitel zur Anwendung der Theorien auf Kafkas "Vor dem Gesetz" und einem Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die methodische Vorgehensweise. Das Kapitel zur Gattungstheorie definiert den Begriff "Parabel" und beschreibt wichtige Merkmale. Das Kapitel zu Kafkas "Vor dem Gesetz" wendet die theoretischen Grundlagen auf den Text an.
Wie wird Kafkas "Vor dem Gesetz" in dieser Arbeit behandelt?
Kafkas "Vor dem Gesetz" dient als Fallbeispiel, um die Rezeptionsprobleme von Parabeln zu illustrieren. Die Arbeit klassifiziert den Text als Parabel und bietet eine rezeptionsanalytische Interpretation, um die Schwierigkeiten der Deutung zu analysieren. Die besondere Fremdartigkeit und die Vielzahl möglicher Interpretationen des Textes machen ihn zu einem besonders geeigneten Beispiel.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Parabel, Rezeption, Interpretation, Franz Kafka, "Vor dem Gesetz", Gattungstheorie, Rezeptionstheorie, bildhafte Erzählung, Metapher, Symbol, Deutung und Tertium comparationis.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Schwierigkeiten bei der Interpretation von Parabeln zu analysieren und zu verstehen, warum diese literarische Form oft als schwierig empfunden wird. Sie untersucht, wie Rezeptionstheorien helfen können, diese Schwierigkeiten zu bewältigen.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert gattungstheoretische Ansätze mit rezeptionsanalytischen Methoden, um die Interpretationsprobleme von Kafkas "Vor dem Gesetz" zu beleuchten. Die Einleitung skizziert die methodische Vorgehensweise detaillierter.
- Quote paper
- Sara Hagenauer (Author), 2007, Die Rezeptionsproblematik der Parabel am Beispiel von Kafkas „Vor dem Gesetz“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83386