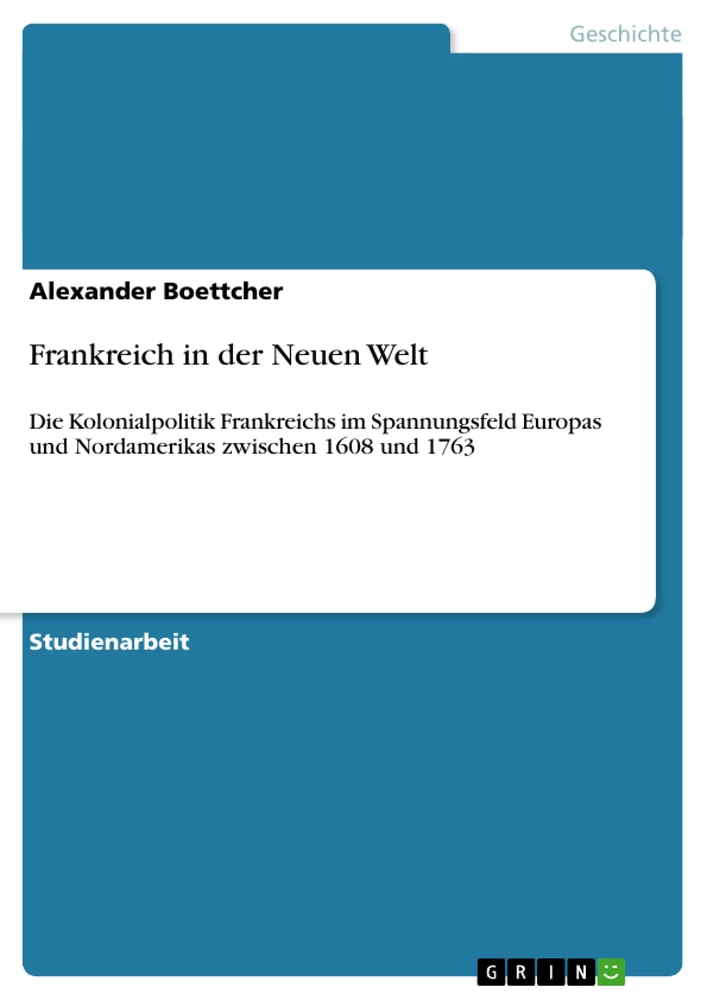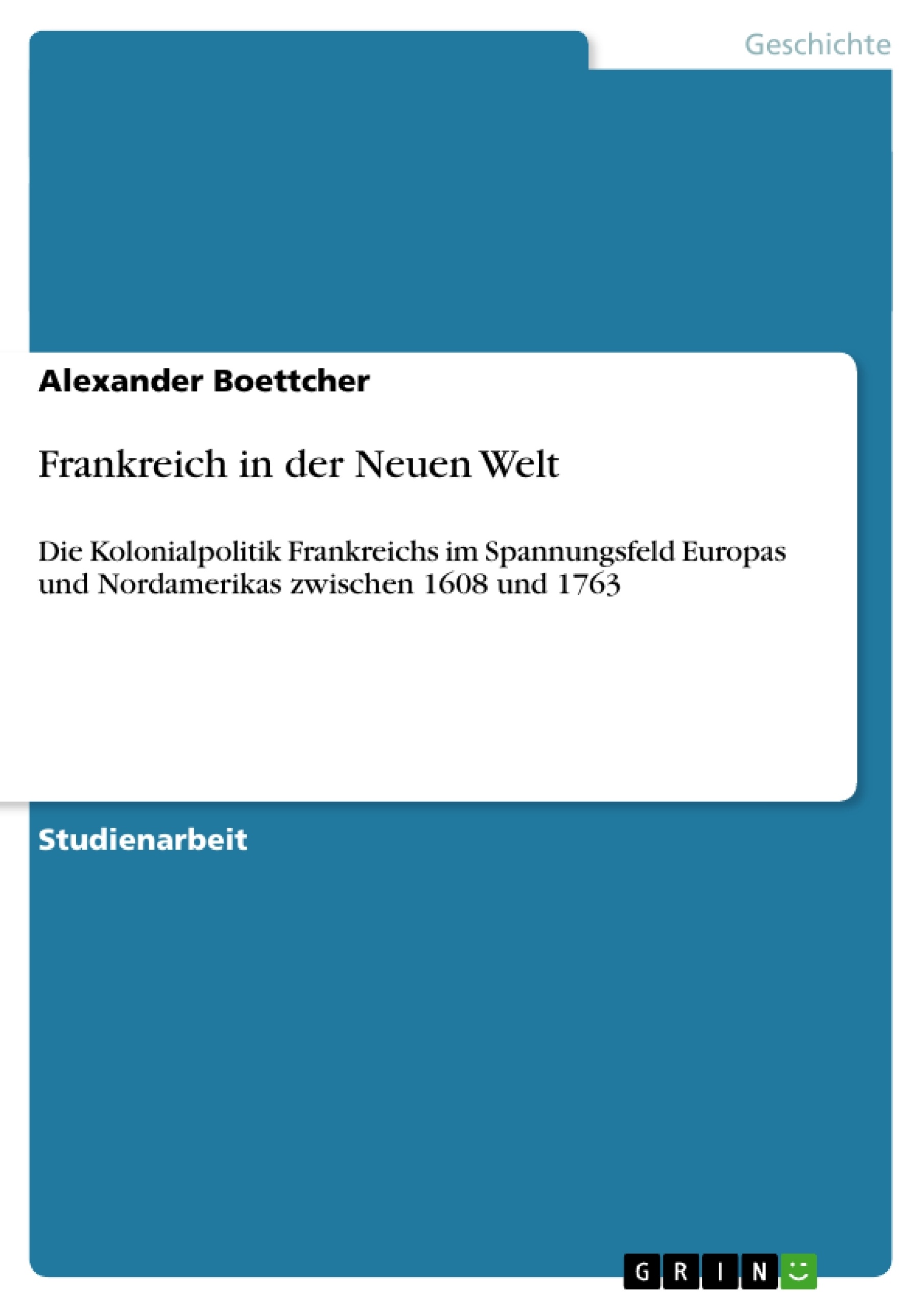Ein rotes Ahornblatt auf weiß-rotem Grund ziert die Fahne Kanadas. Amtssprachen sind Englisch und Französisch. Man könnte sagen, Kanada besitzt zwei Seelen, eine englische und eine französische, die zusammen eine einmalige Symbiose bilden. Tradition ist daher für den Großteil der kanadischen Bevölkerung von großer Be-deutung. Besonders ausgeprägt ist dieses historische Verständnis in Québec. Noch heute ziert die weiße Lilie auf blauem Grund, das alte Symbol der französischen Könige, die Flagge Québecs und ist bezeichnend für das Selbstverständnis deren Einwohner. Québec ist heute nicht nur eine der größten Provinzen Kanadas, es war auch das Kerngebiet, welches 1608 durch die Gründung der namensgleichen Stadt Québec durch den Franzosen Samuel de Champlain die Grundlage eines französischen Kolonialreiches in Nordamerika bildete. Ausgehend von hier, der Stadt am St. Lorenzstrom, schickte sich das Frankreich des 17. Jahrhunderts an, Kolonial-macht in der Neuen Welt zu werden. Während sich Spanien und Portugal die Welt zu Beginn des 16. Jahrhunderts aufteilten, lag das Interesse Frankreichs noch in Europa. Der neuentdeckten Welt wurde zunächst kaum Aufmerksamkeit geschenkt, befand sich Frankreich doch in ständigen Kleinkriegen mit den Habsburger Mächten Spanien und Österreich. Gleichzeitig tobten im inneren Frankreich religiöse Konflikte, die ein imperialistisches Engagement zusätzlich verhinderten. Erst mit einem zunehmenden Erstarken seiner machtpolitischen Stellung in Europa, einer umdenkenden Führungs-schicht und den wachsenden kolonialen Bemühungen des jahrhundertelangen Konkurrenten England, wuchs in Frankreich nicht nur die Bereitschaft zu einem Kolonialreich, sondern auch die Erkenntnis von dessen Notwendigkeit. Der scheinbare Erfolg und das Prestige das Spanien, Portugal, England und sogar Holland dabei erlangten, ist dabei eine wichtige Grundlage, die die kolonialen Bestrebungen Frankreichs als bloße Reaktion eines zu spät Gekommenen erscheinen lassen. Gewinn erwirtschaftete Frankreich mit seinen Kolonien kaum, im Gegenteil, es war ein Minusgeschäft, was William John Eccles folgendermaßen auf den Punkt bringt: „Canada under the French regime was a small colony, seemingly of little importance in the greater world or European civilization in an age of imperial expansion.” (Eccles 1999: xv). Letztlich führten Frankreichs Ambitionen in der Alten und Neuen Welt nicht nur zum Verlust seines ersten Kolonialreiches, sondern mündeten ebenso in der Französischen Revolution. Dabei verfolgte Frankreich keine schlechte Kolonialpolitik; doch trotz seiner überragenden wirtschaftlichen und militärischen Potenz, stellte sich kein endgültiger Erfolg ein. Die Entwicklung der französischen Kolonien von ihrer Gründung 1608 bis zum Verlust 1763, im Spannungsfeld zwischen Neuer und Alter Welt, ist Gegenstand dieser Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frankreich in der Neuen Welt von 1608 bis 1700
- Frankreichs Stellung in Europa zu Beginn des 16. Jahrhunderts
- Gründungen und Entwicklung der französischen Kolonie ab 1608
- Pfeiler französischer Kolonialpolitik
- Das Ende des ersten französischen Kolonialreiches von 1700 bis 1763
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Kolonialpolitik Frankreichs in Nordamerika im Zeitraum von 1608 bis 1763. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich Frankreich im Spannungsfeld zwischen europäischer Machtpolitik und den Realitäten der Neuen Welt stellte, und untersucht, warum das französische Kolonialreich schließlich scheiterte.
- Frankreichs Position in Europa im 16. Jahrhundert und die damit verbundenen Herausforderungen
- Die Anfänge der französischen Kolonialisierung in Nordamerika und die Entwicklung des Kolonialreiches
- Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele der französischen Kolonialpolitik
- Der Einfluss der europäischen Konkurrenz auf die französische Kolonialpolitik
- Die Faktoren, die zum Niedergang des französischen Kolonialreiches führten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die These der Hausarbeit vor: Frankreichs ständiges Engagement im Kampf um die Vorherrschaft in Europa und die damit verbundene inkonsequente Kolonialpolitik führten zum Scheitern seines Kolonialreiches in Nordamerika. Sie führt in die historische und politische Situation Frankreichs zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein und zeigt auf, warum die Neue Welt zunächst nicht im Fokus der französischen Könige stand.
- Kapitel 2 beleuchtet Frankreichs Position in Europa im frühen 16. Jahrhundert und erklärt, warum das Land erst spät an der Kolonialisierung Nordamerikas teilnahm. Es analysiert die Bedeutung der Pelzmode in Europa für die französische Expansion in Nordamerika und schildert die Anfänge der französischen Kolonie ab 1608.
Schlüsselwörter
Frankreich, Kolonialgeschichte, Nordamerika, Pelzhandel, europäische Machtpolitik, Konkurrenz, Scheitern, Québec, Samuel de Champlain.
Häufig gestellte Fragen
Wann begann die französische Kolonialisierung in Nordamerika?
Die Grundlage wurde 1608 mit der Gründung der Stadt Québec durch Samuel de Champlain gelegt.
Warum interessierte sich Frankreich erst spät für die "Neue Welt"?
Frankreich war im 16. Jahrhundert durch Kleinkriege mit den Habsburgern und innere religiöse Konflikte gebunden, während Spanien und Portugal bereits Kolonialreiche aufbauten.
Welche wirtschaftliche Bedeutung hatte der Pelzhandel?
Die Pelzmode in Europa war ein Hauptantrieb für die französische Expansion und bildete das wirtschaftliche Rückgrat der Kolonie Kanada.
Warum scheiterte das erste französische Kolonialreich 1763?
Gründe waren die inkonsequente Kolonialpolitik, die ständige Konkurrenz mit England und die Priorisierung der europäischen Machtpolitik gegenüber den Überseegebieten.
Was symbolisiert die weiße Lilie auf der Flagge Québecs?
Die weiße Lilie (Fleur-de-Lis) ist das alte Symbol der französischen Könige und zeugt noch heute vom historischen Selbstverständnis der Einwohner Québecs.
- Quote paper
- Alexander Boettcher (Author), 2007, Frankreich in der Neuen Welt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83396