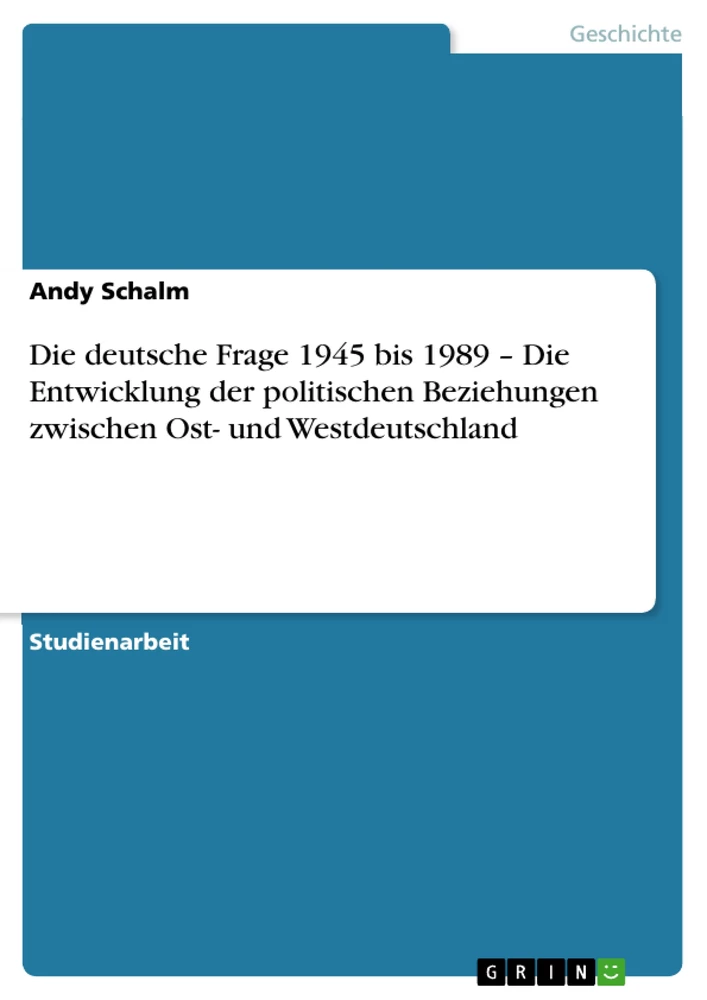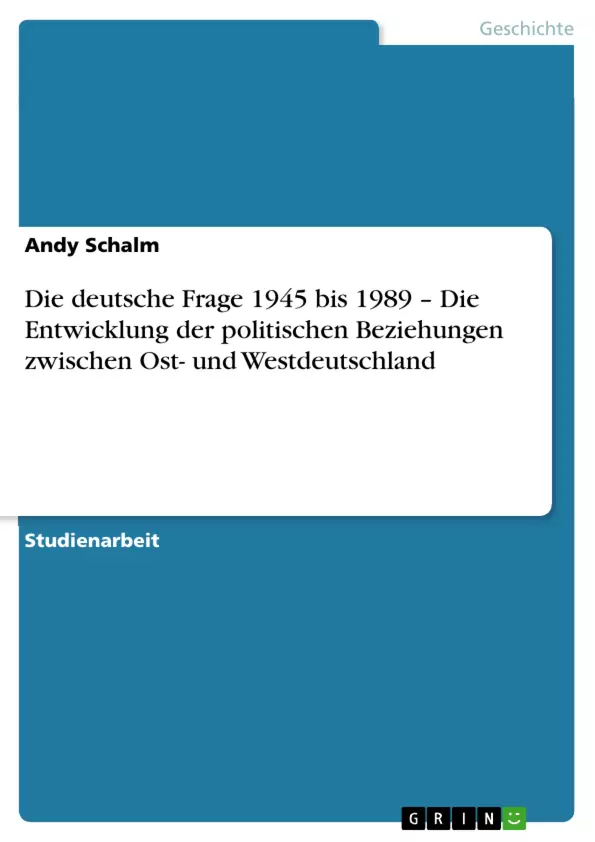Das vorherrschende Bild von den Deutschen in Europa war lange Zeit bestimmt von Militarismus, „politischer Zügellosigkeit und dem Mangel an Gespür für die Ängste […] anderer“ . Diese Sichtweise entstand durch den Verlauf der europäischen Geschichte zwischen 1871 und 1945, die maßgeblich von Deutschland bestimmt wurde. Da die Historie zu beweisen schien, dass die Mentalität der Deutschen, sobald das Land eine gewisse Größe und Dynamik aufwies, einem stabilen Staatensystem nicht zuträglich zu sein schien, wurde die Aussicht auf ein erneut geeintes Deutschland in der Zeit nach 1945 von vielen Seiten eher kritisch beurteilt. Die Neigung zu politischer Aggressivität wurde vielfach als eine typische Eigenart der Deutschen angesehen. Nach dem zweiten Weltkrieg schien diese Bedrohung gebannt und aufgrund der zuvor beschriebenen Einschätzung sowie der Einbindung der beiden deutschen Staaten in die politischen Verwicklungen zweier Großmächte war eine Wiedervereinigung kein leichtes Unterfangen.
Der Weg zum Fall der Mauer und zur Einigung 1990 soll in dieser Arbeit beschrieben und die Frage beantwortet werden, ob dieser ein unausweichlich zu beschreitender war. Wer arbeitete daraufhin, wer dagegen und inwiefern wurde in Ost und West eine konsequente Politik in die eine oder andere Richtung betrieben? Welchen Wandlungen und Einflüssen war die „deutsche Frage“ unterworfen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gründung von DDR und BRD - Das Wiedervereinigungsgebot
- Adenauers Politik der Westbindung - Hallsteindoktrin und Alleinvertretungsanspruch
- Die Stalin-Note von 1952
- Der Mauerbau und seine Folgen
- Der Innerdeutsche Grundlagenvertrag von 1972 - Die besondere Beziehung der beiden deutschen Staaten
- Verfassungsrechtliche Positionswechsel und die „Geraer Forderungen“
- Deutschlandpolitik unter der Regierung Kohl
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der politischen Beziehungen zwischen Ost- und Westdeutschland von 1945 bis 1989, mit dem Fokus auf den Weg zum Fall der Mauer und der Wiedervereinigung 1990. Sie untersucht, ob die Wiedervereinigung ein unausweichlich zu beschreitender Weg war, wer dafür und wer dagegen gearbeitet hat und inwieweit in Ost und West eine konsequente Politik in die eine oder andere Richtung betrieben wurde.
- Die Entstehung der beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Rolle der Großmächte im Wiedervereinigungsprozess
- Die Entwicklung der deutschen Frage in der internationalen Politik
- Die Auswirkungen des Kalten Krieges auf die deutsche Teilung
- Die Bedeutung des Mauerbaus und des Innerdeutschen Grundlagenvertrags
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit setzt sich mit dem vorherrschenden Bild von den Deutschen in Europa auseinander, das von Militarismus und politischer Zügellosigkeit geprägt war, und beleuchtet die kritische Beurteilung der Aussicht auf ein erneut geeintes Deutschland nach 1945.
- Die Gründung von DDR und BRD - Das Wiedervereinigungsgebot: Das Ende des Zweiten Weltkriegs brachte den Deutschen das vorläufige Ende als Staatsnation und die Kriegsgegner sahen in der territorialen Aufsplitterung des Landes die dauerhafteste Lösung des deutschen Problems. Stalin, Churchill und Roosevelt sahen in einem einheitlichen Deutschland eine Bedrohung und befürworteten die Teilung. Obwohl die Teilung nicht das ursprüngliche Ziel der Großmächte war, wurde Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt, bevor 1949 die beiden deutschen Staaten entstanden. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe der Teilung und die Frage, ob eine Wiedervereinigung zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen wäre.
- Adenauers Politik der Westbindung - Hallsteindoktrin und Alleinvertretungsanspruch: Dieses Kapitel behandelt die Politik der Bundesrepublik Deutschland unter Konrad Adenauer und die strategische Entscheidung, sich dem Westen anzuschließen. Es wird die Hallsteindoktrin, die den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik für ganz Deutschland verkörperte, und die Bedeutung der Westbindung für die deutsche Frage näher betrachtet.
- Die Stalin-Note von 1952: Dieses Kapitel analysiert die „Stalin-Note“, ein sowjetisches Angebot zur Wiedervereinigung Deutschlands, das jedoch mit der Bedingung einer Neutralität Deutschlands und einer Beendigung der militärischen Zusammenarbeit mit dem Westen verbunden war.
- Der Mauerbau und seine Folgen: Dieses Kapitel behandelt die Errichtung der Berliner Mauer und die damit einhergehende Verschärfung der deutschen Teilung. Es beleuchtet die internationalen Reaktionen auf den Mauerbau und die Folgen für die politische und gesellschaftliche Situation in Deutschland.
- Der Innerdeutsche Grundlagenvertrag von 1972 - Die besondere Beziehung der beiden deutschen Staaten: Dieses Kapitel analysiert den Innerdeutschen Grundlagenvertrag, der die Grundlage für eine „besondere Beziehung“ zwischen der Bundesrepublik und der DDR schuf. Es werden die wichtigsten Inhalte des Vertrags und seine Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten behandelt.
- Verfassungsrechtliche Positionswechsel und die „Geraer Forderungen“: Dieses Kapitel beleuchtet die verfassungsrechtlichen Positionswechsel der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf die Wiedervereinigung. Es werden die „Geraer Forderungen“ von 1989, die eine grundlegende Änderung in der deutschen Wiedervereinigungspolitik signalisierten, vorgestellt.
- Deutschlandpolitik unter der Regierung Kohl: Dieses Kapitel analysiert die Deutschlandpolitik der Bundesregierung unter Helmut Kohl und die Rolle der Bundesrepublik im Prozess der Wiedervereinigung. Es behandelt die Verhandlungen mit der DDR und die Gestaltung des Vereinigungsprozesses.
Schlüsselwörter
Die deutschen Frage, Wiedervereinigung, Teilung Deutschlands, Kalter Krieg, Großmächte, Westbindung, Hallsteindoktrin, Alleinvertretungsanspruch, Mauerbau, Innerdeutscher Grundlagenvertrag, Geraer Forderungen, Deutschlandpolitik, Helmut Kohl.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der „deutschen Frage“?
Die deutsche Frage bezeichnet das Problem der staatlichen Einheit Deutschlands und dessen Stellung im europäischen Gleichgewicht zwischen 1945 und 1990.
Welche Rolle spielte Konrad Adenauer bei der Westbindung?
Adenauer setzte konsequent auf die Integration der Bundesrepublik in das westliche Bündnis (NATO, EWG), um Souveränität zu gewinnen und eine Wiedervereinigung aus einer Position der Stärke anzustreben.
Was war die Hallsteindoktrin?
Die Hallsteindoktrin besagte, dass die Bundesrepublik die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Staaten als unfreundlichen Akt betrachtete, die die DDR offiziell anerkannten.
Was regelte der Innerdeutsche Grundlagenvertrag von 1972?
Er schuf die Basis für eine „besondere Beziehung“ zwischen BRD und DDR, ermöglichte erste Reiseerleichterungen und erkannte die faktische Existenz zweier Staaten bei gleichzeitiger Offenhaltung der nationalen Frage an.
War die Wiedervereinigung im Jahr 1990 unausweichlich?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch und beleuchtet die Wandlungen der Politik sowie die Einflüsse der Großmächte im Kalten Krieg.
- Quote paper
- Andy Schalm (Author), 2007, Die deutsche Frage 1945 bis 1989 – Die Entwicklung der politischen Beziehungen zwischen Ost- und Westdeutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83445