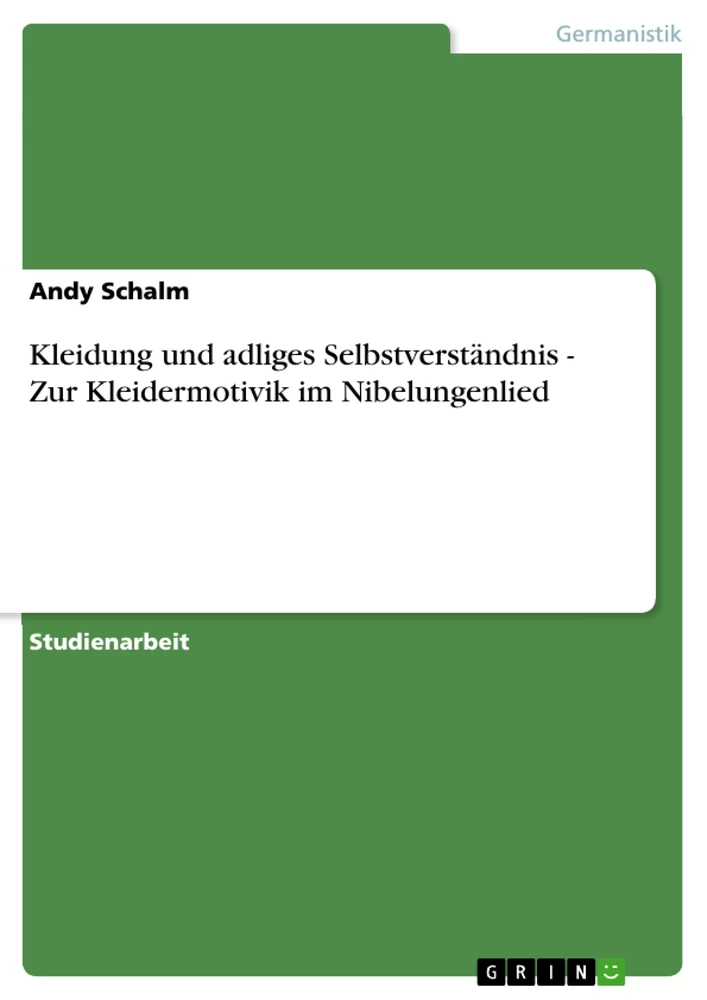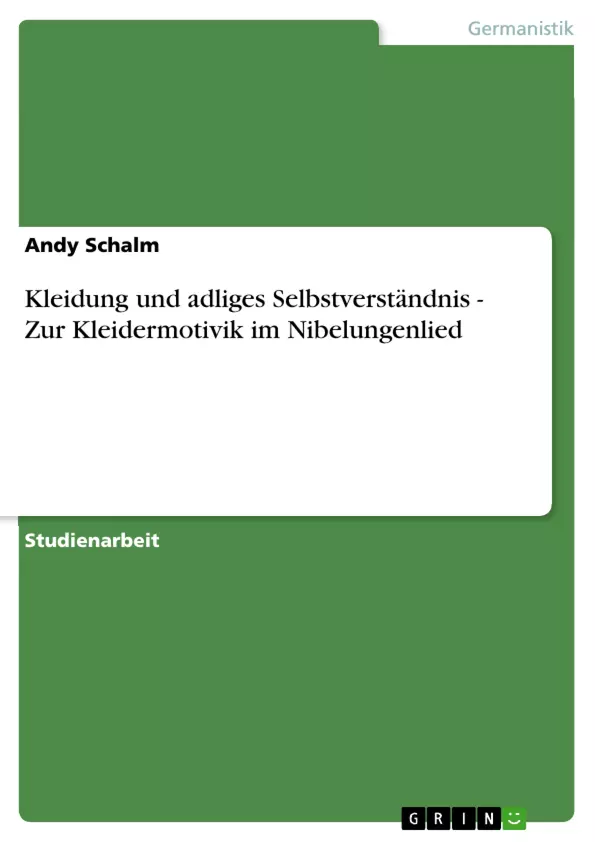War zu Zeiten Karls des Großen prächtige Kleidung noch eher ein Hinweis auf Eitelkeit und die Seidenkleidung ein Privileg der Priester, so war im späten Mittelalter „das adlige Hofpublikum an der Absicherung seiner Kleidervorrechte interessiert“ , denn im 12./13. Jahrhundert sind teure Kleider ein Anzeichen für Stolz und Würde der ritterlichen Hofgesellschaft geworden. In der zeitgenössischen höfischen Dichtung findet dies seinen Einschlag dergestalt, dass viele Verse dafür aufgewendet werden, den Luxus der gebrauchten Materialien hervorzuheben und teure Importwaren in den Mittelpunkt zu rücken, welche die adligen Protagonisten am Leibe tragen. Schon die Fülle von Gewandbeschreibungen in der höfischen Literatur lässt erahnen, welche besondere Bedeutung die Kleidung für den mittelalterlichen Menschen besaß. Helden und Heldinnen der höfischen Romane werden in kostbaren Gewändern dargestellt, wobei bis ins Detail die einzelnen Stücke sowie auch Schmuck, Haartracht und sonstiger Putz geschildert werden. Die Dichter jener Zeit ließen vor den Augen ihres Publikums die höfische Pracht einer Ideal- und Wunschwelt lebendig werden.
Seit Veldeke seine Dido in ihrem Jagdkostüm zu einer höfisch-modischen Edeldame stilisierte , gehörten längere, idealisierte Gewanddeskriptionen zu den konstitutiven Elementen der mittelhochdeutschen höfische Epik.
Auch im Nibelungenlied wird eine – teilweise äußerst differenzierte – Fachterminilogie der Textil- und Kostümkunde gebraucht und zwar so sehr, dass Heusler spöttisch äußert, es sähe bei der Brünhildenwerbung „eine zeitlang so [aus], als sei der Zweck der Freierfahrt die Schaustellung der schneeweißen, kleegrünen, rabenschwarzen Seidenkleider mit Fischotterbesatz und Edelsteinen in arabischem Gold“. Er übersah dabei nicht nur die Bedeutung der Kleiderpracht für die höfische Gesellschaft, sondern auch die Tatsache, dass der Dichter des Nibelungenliedes Stoffe und Kleider nicht nur fade aufzählt, sondern sie zu wichtigen Requisiten macht und in den Dienst der Handlung stellt. Wie dies geschieht, soll den Mittelpunkt dieser Arbeit bilden. Ebenso, inwiefern Personen durch Kleidung ihren Stand markieren und im Text Aussehen und Inneres von Figuren in Kongruenz stehen. Es soll bewiesen werden, dass der Dichter bestimmte Stoffe und Aufmachungen nutzt, um mit ihnen die Geschichte voranzutreiben, um so zu zeigen, dass Kleidung im Nibelungenlied eine weit größere Bedeutung trägt, als lediglich „zur Schau gestellt“ zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Das höfische Zeremoniell
- Teure Stoffe aus dem Orient – Kleidung als Statussymbol
- Die Wechselbeziehung zwischen Inner- und Äußerlichkeit – Kleidung im Dienst der Personenbeschreibung
- Das Motiv des Kleiderlohns
- Erzählen mit der Kleidung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Kleidung im Nibelungenlied. Ziel ist es, aufzuzeigen, dass Kleidung weit mehr als nur ein optisches Element ist, sondern handlungsrelevant und wichtig für die Charakterisierung der Figuren ist. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Kleidung, sozialem Status und der Darstellung innerer Werte.
- Kleidung als Statussymbol im höfischen Kontext
- Die Beziehung zwischen äußerer Erscheinung (Kleidung) und innerer Wesensart der Figuren
- Die Funktion von Kleidung in der Handlung des Nibelungenliedes
- Kleidung als Mittel der Kommunikation und Selbstdarstellung
- Die Rolle des Kleiderlohns in der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Das höfische Zeremoniell: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss der Kreuzzüge auf die höfische Kultur des 12./13. Jahrhunderts. Die Begegnung mit fremden Kulturen und der damit verbundene Reichtum führten zu einem gesteigerten Interesse an luxuriöser Kleidung als Ausdruck des sozialen Status. Das Nibelungenlied, als Beispiel höfischer Literatur, zeigt eine adlige Gesellschaft, in der Feste, Turniere und Jagden nach strengem Zeremoniell ablaufen, wobei die Kleidung eine zentrale Rolle spielt. Die materielle, gesellschaftliche und ideelle Dimension der höfischen Kultur greifen in der Darstellung der Kleidung stark ineinander.
Teure Stoffe aus dem Orient – Kleidung als Statussymbol: Dieses Kapitel (angenommen, da es im Inhaltsverzeichnis aufgeführt ist) würde sich vermutlich mit der Verwendung von kostbaren Stoffen und Textilien im Nibelungenlied auseinandersetzen. Es würde die Bedeutung von Kleidung als Statussymbol analysieren und die Rolle von importierten, luxuriösen Stoffen als Ausdruck von Reichtum und Macht untersuchen. Die detaillierten Beschreibungen der Kleidung im Epos könnten als Beleg für die gesellschaftliche Bedeutung von Kleidung als Repräsentation von Status und Ansehen dienen. Der Fokus läge auf der Analyse der verwendeten Materialien, ihrer Herkunft und ihrer Bedeutung im Kontext der Handlung.
Die Wechselbeziehung zwischen Inner- und Äußerlichkeit – Kleidung im Dienst der Personenbeschreibung: Dieser Abschnitt (angenommen, da es im Inhaltsverzeichnis aufgeführt ist) würde die enge Verbindung zwischen der Kleidung der Figuren und ihrer Persönlichkeit im Nibelungenlied untersuchen. Es würde analysiert werden, wie der Dichter durch die Beschreibung der Kleidung die Charaktere darstellt und ihre inneren Eigenschaften vermittelt. Die Kongruenz von äußerem Schein (Kleidung) und innerem Wesen könnte exemplarisch an verschiedenen Figuren des Epos verdeutlicht werden. Der Zusammenhang zwischen Kleidung und Charakterentwicklung im Verlauf der Handlung wäre ein weiterer wichtiger Aspekt.
Das Motiv des Kleiderlohns: (Angenommen, da es im Inhaltsverzeichnis aufgeführt ist) Dieses Kapitel würde die Bedeutung des „Kleiderlohns“ als Motiv im Nibelungenlied untersuchen. Es würde die symbolische Bedeutung des Kleiderlohns im Kontext der Handlung analysiert werden. Der Fokus läge auf der Frage, inwieweit dieser Aspekt die Beziehungen zwischen den Figuren beeinflusst, und welche Rolle er in Bezug auf Machtverhältnisse und soziale Dynamiken spielt. Der Kleiderlohn könnte als ein Spiegelbild der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen der dargestellten Zeit interpretiert werden.
Erzählen mit der Kleidung: (Angenommen, da es im Inhaltsverzeichnis aufgeführt ist) In diesem Kapitel würde die Funktion der Kleidung als erzählerisches Mittel untersucht werden. Die Analyse würde beleuchten, wie der Dichter durch die gezielte Beschreibung und Verwendung von Kleidung die Handlung vorantreibt, Spannung erzeugt oder bestimmte Aspekte der Geschichte hervorhebt. Es würde aufgezeigt werden, wie Kleidung als Symbol, Metapher oder als Mittel der Charakterisierung dient um die Erzählung zu strukturieren und zu gestalten.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Kleidung, höfische Kultur, Statussymbol, Personenbeschreibung, mittelalterliche Literatur, Textilien, Kostümkunde, Handlung, Erzähltechnik.
Häufig gestellte Fragen zum Nibelungenlied und der Bedeutung von Kleidung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung von Kleidung im Nibelungenlied. Sie geht über die rein optische Darstellung hinaus und untersucht die Handlungsrelevanz und die Rolle der Kleidung bei der Charakterisierung der Figuren. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Kleidung, sozialem Status und der Darstellung innerer Werte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Kleidung als Statussymbol im höfischen Kontext; die Beziehung zwischen äußerer Erscheinung (Kleidung) und innerer Wesensart der Figuren; die Funktion von Kleidung in der Handlung des Nibelungenliedes; Kleidung als Mittel der Kommunikation und Selbstdarstellung; und die Rolle des Kleiderlohns in der Erzählung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Das höfische Zeremoniell (Einfluss der Kreuzzüge, Bedeutung von Kleidung in höfischen Ritualen); Teure Stoffe aus dem Orient – Kleidung als Statussymbol (Analyse der verwendeten Stoffe, Bedeutung importierter Textilien); Die Wechselbeziehung zwischen Inner- und Äußerlichkeit – Kleidung im Dienst der Personenbeschreibung (Zusammenhang zwischen Kleidung und Persönlichkeit der Figuren); Das Motiv des Kleiderlohns (symbolische Bedeutung und Einfluss auf Beziehungen); und Erzählen mit der Kleidung (Kleidung als erzählerisches Mittel).
Wie wird die Bedeutung von Kleidung im Nibelungenlied untersucht?
Die Untersuchung analysiert die detaillierten Beschreibungen von Kleidung im Epos. Es werden die verwendeten Materialien, ihre Herkunft und ihre Bedeutung im Handlungskontext untersucht. Die Arbeit beleuchtet, wie der Dichter durch die Beschreibung der Kleidung die Charaktere darstellt und ihre inneren Eigenschaften vermittelt. Die Funktion der Kleidung als erzählerisches Mittel, zur Spannungssteigerung und zur Strukturierung der Handlung wird ebenfalls analysiert.
Welche Rolle spielt der Kleiderlohn?
Das Kapitel zum Kleiderlohn untersucht dessen symbolische Bedeutung im Kontext der Handlung. Es analysiert den Einfluss des Kleiderlohns auf die Beziehungen zwischen den Figuren und seine Rolle in Bezug auf Machtverhältnisse und soziale Dynamiken. Der Kleiderlohn wird als Spiegelbild der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen der dargestellten Zeit interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nibelungenlied, Kleidung, höfische Kultur, Statussymbol, Personenbeschreibung, mittelalterliche Literatur, Textilien, Kostümkunde, Handlung, Erzähltechnik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte zeigen, dass Kleidung im Nibelungenlied weit mehr als nur ein optisches Element ist. Sie ist handlungsrelevant und wichtig für die Charakterisierung der Figuren. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Kleidung, sozialem Status und der Darstellung innerer Werte.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Nibelungenlied auf strukturierte und professionelle Weise.
- Arbeit zitieren
- Andy Schalm (Autor:in), 2007, Kleidung und adliges Selbstverständnis - Zur Kleidermotivik im Nibelungenlied, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83451