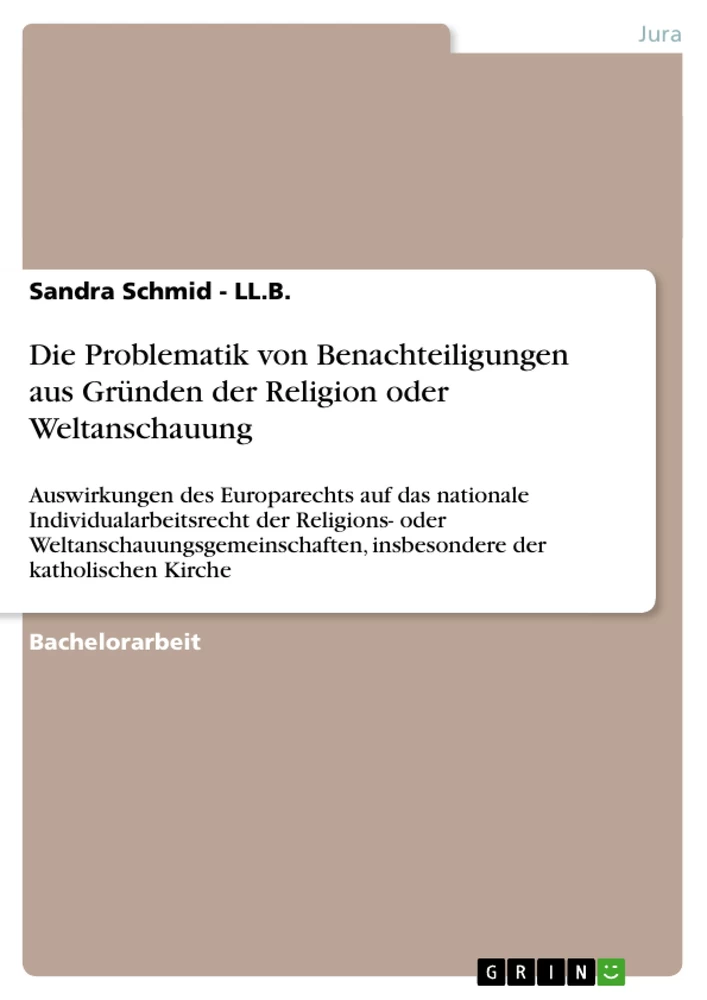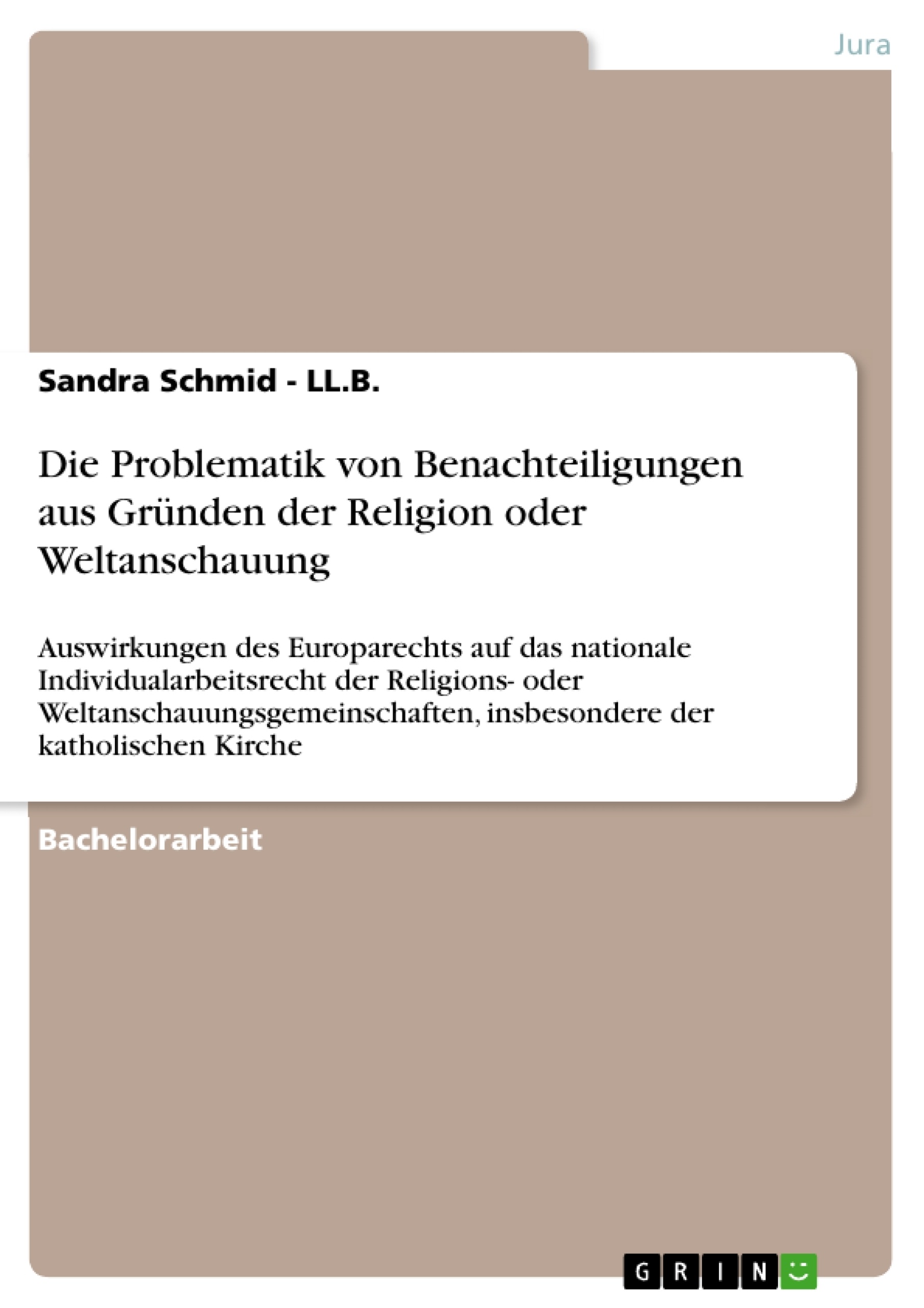Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik von Benachteiligung aus Gründen der Religion oder Weltanschauung im kirchlichen Individualarbeitsrecht. Ziel ist es, dem Leser einen Überblick darüber zu geben, welche Auswirkungen der europäische Diskriminierungsschutz auf die zukünftige Rechtslage der Kirchen, anderer Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, insb. der katholischen Kirche, haben könnte. Das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“, das u.a. die europäische Richtlinie 2000/78/EG „des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf“ in nationales Recht umsetzt, ist nach h.M. als ein „für alle geltendes Gesetz“ eine Schranke der korporativen Religionsfreiheit, der nach Art. 4 Abs.1 & Abs.2, Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV geschützten Organisationen. Die eigentliche Problematik eines kirchlichen Arbeitsrechts besteht darin, dass dieses sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene auf zwei großen Grundsäulen beruht, die sich gegenseitig beeinflussen.. Die grds. auch für den kirchlichen Arbeitgeber geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften werden nämlich in vielerlei Hinsicht durch das nationale Staatskirchenrecht bzw. das auf allgemeinen Rechtsgrundsätzen und Gemeinschaftsgrundrechten beruhende europäische „Gemeinschaftskirchenrecht“ modifiziert. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, inwieweit das Gemeinschaftsrecht auf das weitreichende verfassungsrechtlich garantierte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen einwirkt bzw. auch nationales Verfassungsrecht verdrängt. Überdies muss der Frage nachgegangen werden, ob das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ in seiner derzeit gültigen Fassung mit der ihm zugrundeliegenden Richtlinie vereinbar ist. Dieser Untersuchung folgt auch der Aufbau der Bachelorarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- A.) Einführung
- B.) Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und das kirchliche Arbeitsrecht in Deutschland vor in Kraft treten des AGG
- I. Das Verhältnis von Staat und Kirche: allgemeine Grundsätze
- II. Kirchliches Selbstbestimmungsrecht
- III. Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts
- C.) Das kirchliche Arbeitsrecht im europäischen Kontext
- I. Gemeinschaftsrechtliche Grundlagen des kirchlichen Arbeitsrechts
- II. Art. 13 EG und die Richtlinie 2000/78/EG
- D.) Die Umsetzung der Richtlinie in das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ und deren Auswirkung auf die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts
- I. Das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- II. Auswirkungen des europäischen Antidiskriminierungsrechts auf das kirchliche Arbeitsrecht
- E.) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Problematik von Benachteiligungen aus Gründen der Religion oder Weltanschauung im kirchlichen Arbeitsrecht. Sie analysiert die Auswirkungen des Europarechts, insbesondere der Richtlinie 2000/78/EG, auf das nationale Individualarbeitsrecht der Religionsgemeinschaften, fokussiert auf die katholische Kirche. Die Arbeit beleuchtet den Spannungsbogen zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz.
- Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen im deutschen Recht
- Die Relevanz des EU-Rechts (Richtlinie 2000/78/EG) für das kirchliche Arbeitsrecht
- Die Umsetzung der Richtlinie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Der Konflikt zwischen kirchlichem Selbstbestimmungsrecht und Antidiskriminierungsrecht
- Auswirkungen auf die Praxis des kirchlichen Arbeitsrechts
Zusammenfassung der Kapitel
A.) Einführung: Dieses einführende Kapitel legt den Fokus der Arbeit dar: die Untersuchung der Problematik von Benachteiligungen aus Gründen der Religion oder Weltanschauung im Kontext des kirchlichen Arbeitsrechts und der Auswirkungen des Europarechts darauf. Es skizziert den Forschungsstand und die Methodik der Arbeit, um den Leser auf die folgenden Kapitel vorzubereiten.
B.) Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und das kirchliche Arbeitsrecht in Deutschland vor in Kraft treten des AGG: Dieses Kapitel beleuchtet das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen im deutschen Recht vor Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Es analysiert das Verhältnis von Staat und Kirche, die grundsätzlichen Prinzipien des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts und die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts, einschließlich der Loyalitätsobliegenheiten. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Rechtslage vor der europäischen Harmonisierung im Antidiskriminierungsbereich.
C.) Das kirchliche Arbeitsrecht im europäischen Kontext: Dieses Kapitel untersucht die gemeinschaftsrechtlichen Grundlagen des kirchlichen Arbeitsrechts im europäischen Kontext. Es analysiert Art. 13 EG und die Richtlinie 2000/78/EG im Detail, einschließlich ihres Anwendungsbereichs und der Definition von Diskriminierung. Die verschiedenen Arten der Diskriminierung, die Möglichkeiten der Rechtfertigung und die Kollision mit nationalem Verfassungsrecht werden eingehend untersucht. Besonderes Augenmerk wird auf die Auslegung der Richtlinie und deren potentielle Auswirkungen auf das kirchliche Arbeitsrecht gelegt.
D.) Die Umsetzung der Richtlinie in das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ und deren Auswirkung auf die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts: Dieses Kapitel analysiert die Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und deren Auswirkungen auf das kirchliche Arbeitsrecht. Es werden die Zielsetzung, der Anwendungsbereich und die Benachteiligungsverbote des AGG im Detail untersucht, mit besonderem Fokus auf die Rechtfertigungsgründe im Kontext religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen. Die komplexe Interaktion zwischen nationalem Recht und EU-Recht im Bereich der Diskriminierung wird ausführlich diskutiert.
Schlüsselwörter
Kirchliches Arbeitsrecht, Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, Religionsfreiheit, Antidiskriminierungsrecht, Richtlinie 2000/78/EG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Europarecht, nationales Recht, Loyalitätsobliegenheiten, Benachteiligung, Diskriminierung, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, katholische Kirche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Kirchliches Arbeitsrecht und Antidiskriminierungsrecht
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Problematik von Benachteiligungen aus Gründen der Religion oder Weltanschauung im kirchlichen Arbeitsrecht in Deutschland. Sie analysiert insbesondere die Auswirkungen des europäischen Antidiskriminierungsrechts, speziell der Richtlinie 2000/78/EG und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), auf das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen.
Welche Aspekte des kirchlichen Arbeitsrechts werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen im deutschen Recht, die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts (einschließlich Loyalitätsobliegenheiten), den Einfluss des europäischen Rechts (Richtlinie 2000/78/EG und AGG) darauf, und den Konflikt zwischen kirchlichem Selbstbestimmungsrecht und dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Der Fokus liegt auf der katholischen Kirche.
Welche Rolle spielt das Europarecht in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Relevanz der Richtlinie 2000/78/EG und ihre Umsetzung im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) für das kirchliche Arbeitsrecht. Es wird untersucht, wie das europäische Antidiskriminierungsrecht den nationalen Rechtsrahmen beeinflusst und welche Konflikte zwischen EU-Recht und nationalem Recht bestehen.
Wie wird der Konflikt zwischen Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und Antidiskriminierungsrecht behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Spannungsbogen zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Sie untersucht, wie dieser Konflikt in der Praxis des kirchlichen Arbeitsrechts gelöst werden kann und welche Auslegung der Richtlinie 2000/78/EG und des AGG relevant ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Eine Einführung, ein Kapitel über das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und das kirchliche Arbeitsrecht vor dem AGG, ein Kapitel zum kirchlichen Arbeitsrecht im europäischen Kontext (mit Fokus auf Art. 13 EG und Richtlinie 2000/78/EG), ein Kapitel zur Umsetzung der Richtlinie im AGG und deren Auswirkungen, und abschließend ein Fazit. Jedes Kapitel analysiert einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit der historischen Entwicklung bis hin zu den aktuellen Rechtsfragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kirchliches Arbeitsrecht, Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, Religionsfreiheit, Antidiskriminierungsrecht, Richtlinie 2000/78/EG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Europarecht, nationales Recht, Loyalitätsobliegenheiten, Benachteiligung, Diskriminierung, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, katholische Kirche.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Rechtswissenschaften, insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts und des Kirchenrechts, sowie für Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Fragen des kirchlichen Arbeitsrechts und des Antidiskriminierungsrechts auseinandersetzen.
- Quote paper
- Sandra Schmid - LL.B. (Author), 2007, Die Problematik von Benachteiligungen aus Gründen der Religion oder Weltanschauung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83569