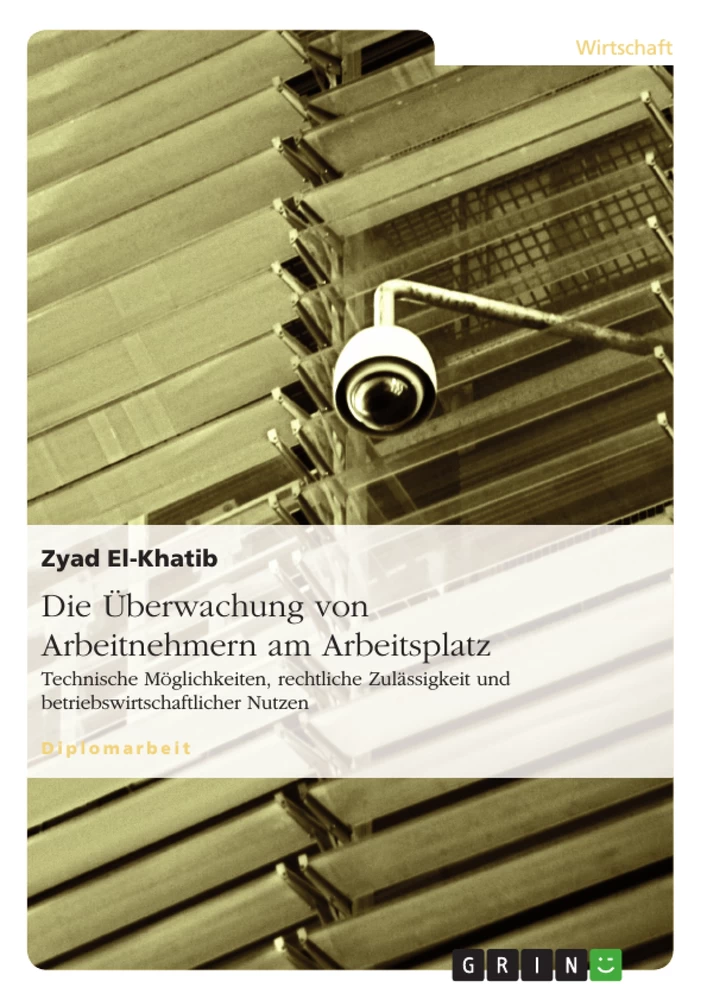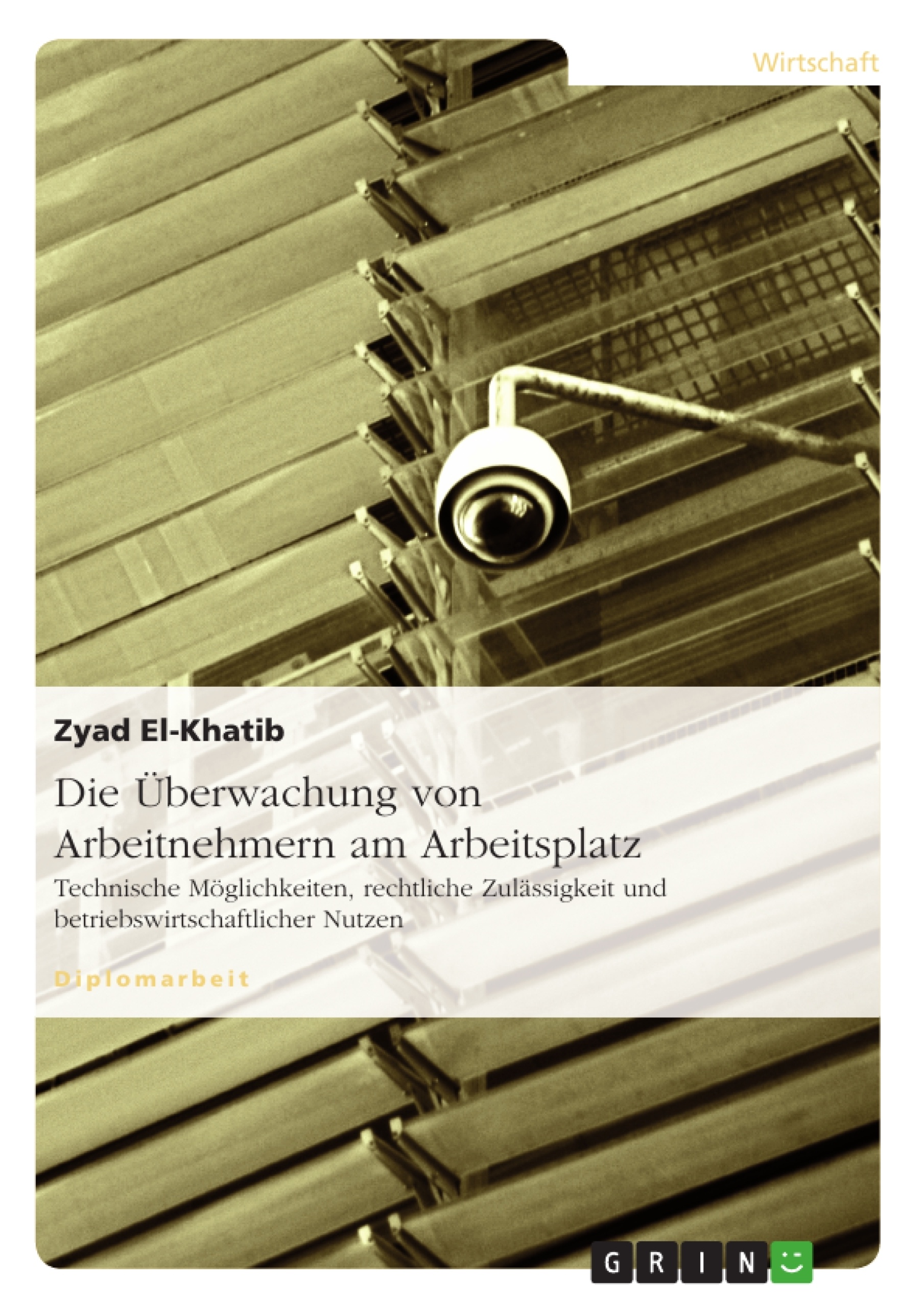Die Überwachung von Arbeitnehmern durch technische Einrichtungen ist ein Thema, das aufgrund der rasanten Entwicklung im Bereich der Mikroelektronik aktuell ist wie nie zuvor: Der Verhaltens- und Leistungskontrolle am Arbeitsplatz sind heute faktisch kaum noch Grenzen gesetzt. Gemeint ist u.a. der Einsatz von Videokameras am Arbeitsplatz, an Zeiterfassung mittels Chipkarten, an computerisierte Telefonanlagen, die sämtliche Gesprächsdaten elektronisch erfassen, oder an die Möglichkeit der Kontrolle der E-Mail und Internetnutzung. Detlef Borchers hat prägnant zusammengefasst, welche Gefahren von den vielfältigen Überwachungsmöglichkeiten ausgehen: „Stellen Sie sich vor, auf Ihrem Rechner ist ein unsichtbares Tool installiert, das all Ihre Tastatureingaben und benutzten Programme protokolliert, Emails speichert, besuchte Web-Adressen und Passwörter sammelt, beim Instant Messenger mitliest, den Bildschirminhalt abfotografiert und Sie obendrein filmt - mit Ihrer eigenen Webcam. Das ist kein Horrorszenario, sondern in vielen Unternehmen Realität.“
Doch was veranlasst Unternehmen dazu, mit immer neuen Überwachungstechnologien das Verhalten ihrer Mitarbeiter auszuspionieren, wo einst der gelegentliche Kontrollbesuch des Vorgesetzten als ausreichend galt? Die drastische Zunahme einer technisierten Kontrolle wird mit folgenden Argumenten begründet:
• Die Kontrolle stelle sicher, dass sich die durch die Nutzung des ITSystems verursachten Kosten in Grenzen halten und dass dieses auch nicht überlastet werde.
• Insbesondere E-Mails seien ein Mittel, um Geschäftsgeheimnisse zu verraten oder strafbare Handlungen wie zum Beispiel Beleidigungen zu begehen. Dies könne eine Überwachung weithin verhindern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Ist die technische Arbeitnehmerüberwachung wirtschaftlich begründbar?
- 1.2. Auswirkungen auf die Mitarbeiter
- 1.3. Gang der Bearbeitung
- 2. Arten der technischen Arbeitnehmerüberwachung
- 2.1. Zeiterfassungs- und Zugangskontrollsysteme
- 2.2. Personalinformationssysteme
- 2.3. Videoüberwachung
- 2.4. Telefonüberwachung
- 2.5. Computerüberwachung
- 2.5.1. Überwachung der Internet- und Intranetnutzung
- 2.5.2. E-Mailüberwachung
- 2.6. Zwischenergebnis
- 3. Rechtliche Bewertung der einzelnen Überwachungsarten
- 3.1. Vorüberlegung: Zum Problem der Grundrechtsbindung von Arbeitsvertragsparteien
- 3.1.1. Lehre von der unmittelbaren Drittwirkung
- 3.1.2. Lehre von der mittelbaren Drittwirkung
- 3.1.3. Lehre von der Schutzpflichtfunktion
- 3.2. Grundrechte der Arbeitnehmer
- 3.2.1. Der Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG)
- 3.2.2. Das Grundrecht der freien Persönlichkeitsentfaltung (Art. 2 Abs. 1 GG)
- 3.2.3. Das Gleichheitsgebot (Art. 3 Abs. 1 GG)
- 3.3. Grundrechte der Arbeitgeber
- 3.3.1. Das Recht auf Entfaltung der unternehmerischen Freiheit (Art. 12 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 14 GG)
- 3.3.2. Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (Art. 14 GG)
- 3.4. Zeiterfassungs- und Zugangskontrollsysteme
- 3.5. Personalinformationssysteme
- 3.6. Videoüberwachung
- 3.6.1. Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume
- 3.6.2. Videoüberwachung nicht öffentlich zugänglicher Räume
- 3.6.2.1. Repressive Videoüberwachung nicht öffentlich zugänglicher Räume
- 3.6.2.2. Präventive Videoüberwachung nicht öffentlich zugänglicher Räume
- 3.7. Telefonüberwachung
- 3.7.1. Abhören von dienstlichen Telefongesprächen
- 3.7.2. Mithören von dienstlichen Telefongesprächen
- 3.7.3. Aufzeichnung von dienstlichen Telefongesprächen
- 3.7.4. Erfassung von Verbindungsdaten
- 3.7.5. Inhaltskontrolle privater Telefongespräche
- 3.8. Computerüberwachung
- 3.9. Internetüberwachung
- 3.9.1. Überwachung durch Standardsoftware bei privatem Nutzungsverbot
- 3.9.2. Überwachung durch Standardsoftware bei erlaubter Privatnutzung
- 3.9.3. Überwachung durch spezielle Überwachungssoftware
- 3.9.4. Private Internetnutzung als Kündigungsgrund
- 3.10. E-Mailüberwachung
- 3.10.1. Inhaltskontrolle bei dienstlicher Nutzung
- 3.10.2. Inhaltskontrolle bei privater Nutzung
- 3.10.3. Kontrolle der Rahmendaten
- 3.11. Praxistipp für den Umgang mit Internet und E-Mail am Arbeitsplatz
- 3.1. Vorüberlegung: Zum Problem der Grundrechtsbindung von Arbeitsvertragsparteien
- 4. Betriebswirtschaftliche Aspekte der technischen Arbeitnehmerüberwachung
- 4.1. Telekommunikationskosten
- 4.2. Arbeitszeitverlust durch privates Surfen
- 4.3. Gefährdung der Systemsicherheit / Kapazitätsprobleme
- 4.4. Missbrauch des Unternehmensnetzwerks
- 4.5. Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Arbeitnehmerüberwachung am Arbeitsplatz. Ziel ist es, die wirtschaftliche Begründbarkeit, die rechtliche Zulässigkeit und den betriebswirtschaftlichen Nutzen verschiedener technischer Überwachungsmethoden zu analysieren.
- Wirtschaftliche Aspekte der Arbeitnehmerüberwachung
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Grundrechte
- Verschiedene Arten der technischen Überwachung (z.B. Videoüberwachung, Internetüberwachung)
- Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation und -produktivität
- Abwägung zwischen Arbeitgeberinteressen und Arbeitnehmerrechten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der technischen Arbeitnehmerüberwachung ein und skizziert die Fragestellungen der Arbeit. Es beleuchtet die wirtschaftlichen Beweggründe für Überwachung und deren potenziellen Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Der methodische Ansatz und der Aufbau der Arbeit werden ebenfalls vorgestellt.
2. Arten der technischen Arbeitnehmerüberwachung: Kapitel zwei bietet einen detaillierten Überblick über verschiedene Methoden der technischen Überwachung von Arbeitnehmern. Es werden Zeiterfassungssysteme, Personalinformationssysteme, Videoüberwachung, Telefonüberwachung und vor allem die Computerüberwachung (inkl. Internet- und E-Mail-Überwachung) beschrieben und ihre jeweiligen Funktionsweisen erläutert. Der Fokus liegt auf der technischen Beschreibung und Differenzierung der verschiedenen Überwachungsmöglichkeiten.
3. Rechtliche Bewertung der einzelnen Überwachungsarten: Kapitel drei befasst sich umfassend mit der rechtlichen Bewertung der in Kapitel zwei beschriebenen Überwachungsmethoden. Es analysiert die relevanten Grundrechte der Arbeitnehmer (Menschenwürde, Persönlichkeitsentfaltung, Gleichbehandlung) und Arbeitgeber (unternehmerische Freiheit) im Kontext des Arbeitsverhältnisses. Die verschiedenen Rechtslehren zur Drittwirkung von Grundrechten werden diskutiert und auf die einzelnen Überwachungsmethoden angewendet. Die Kapitel beschreibt die rechtlichen Grenzen der Arbeitnehmerüberwachung und differenziert je nach Art der Überwachung und Kontext (öffentlicher vs. nicht-öffentlicher Raum, dienstliche vs. private Nutzung).
4. Betriebswirtschaftliche Aspekte der technischen Arbeitnehmerüberwachung: Dieses Kapitel untersucht die betriebswirtschaftlichen Implikationen der Arbeitnehmerüberwachung. Es analysiert Kostenfaktoren (z.B. Telekommunikationskosten), den potenziellen Arbeitszeitverlust durch private Internetnutzung, Risiken für die Systemsicherheit und den möglichen Missbrauch des Unternehmensnetzwerks. Ein zentraler Punkt ist die Analyse der Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation und -produktivität. Es werden die Vor- und Nachteile der Überwachung aus betriebswirtschaftlicher Sicht gegeneinander abgewogen.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmerüberwachung, Datenschutz, Grundrechte, Arbeitsrecht, Videoüberwachung, Internetüberwachung, E-Mail-Überwachung, Telefonüberwachung, Betriebswirtschaft, Mitarbeitermotivation, Rechtliche Zulässigkeit, Wirtschaftlichkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Technische Arbeitnehmerüberwachung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Arbeitnehmerüberwachung am Arbeitsplatz. Sie analysiert die wirtschaftliche Begründbarkeit, die rechtliche Zulässigkeit und den betriebswirtschaftlichen Nutzen verschiedener technischer Überwachungsmethoden.
Welche Arten der technischen Arbeitnehmerüberwachung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Überwachungsmethoden, darunter Zeiterfassungs- und Zugangskontrollsysteme, Personalinformationssysteme, Videoüberwachung, Telefonüberwachung und Computerüberwachung (inkl. Internet- und E-Mail-Überwachung). Jede Methode wird detailliert beschrieben und ihre Funktionsweise erläutert.
Welche rechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die rechtliche Bewertung der Überwachungsmethoden steht im Mittelpunkt. Die Arbeit analysiert die relevanten Grundrechte der Arbeitnehmer (Menschenwürde, Persönlichkeitsentfaltung, Gleichbehandlung) und Arbeitgeber (unternehmerische Freiheit). Verschiedene Rechtslehren zur Drittwirkung von Grundrechten werden diskutiert und auf die einzelnen Überwachungsmethoden angewendet. Die rechtlichen Grenzen der Arbeitnehmerüberwachung werden differenziert nach Art der Überwachung und Kontext (öffentlicher vs. nicht-öffentlicher Raum, dienstliche vs. private Nutzung) beschrieben.
Welche betriebswirtschaftlichen Aspekte werden untersucht?
Die betriebswirtschaftlichen Implikationen der Arbeitnehmerüberwachung werden ebenfalls analysiert. Dies umfasst Kostenfaktoren (z.B. Telekommunikationskosten), potenziellen Arbeitszeitverlust durch private Internetnutzung, Risiken für die Systemsicherheit, Missbrauch des Unternehmensnetzwerks und die Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation und -produktivität. Vor- und Nachteile der Überwachung aus betriebswirtschaftlicher Sicht werden gegeneinander abgewogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Arten der technischen Arbeitnehmerüberwachung, Rechtliche Bewertung der einzelnen Überwachungsarten und Betriebswirtschaftliche Aspekte der technischen Arbeitnehmerüberwachung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die wirtschaftliche Begründbarkeit, die rechtliche Zulässigkeit und den betriebswirtschaftlichen Nutzen verschiedener technischer Überwachungsmethoden zu analysieren und die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern abzuwägen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arbeitnehmerüberwachung, Datenschutz, Grundrechte, Arbeitsrecht, Videoüberwachung, Internetüberwachung, E-Mail-Überwachung, Telefonüberwachung, Betriebswirtschaft, Mitarbeitermotivation, Rechtliche Zulässigkeit, Wirtschaftlichkeit.
- Quote paper
- Zyad El-Khatib (Author), 2007, Die Überwachung von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83572