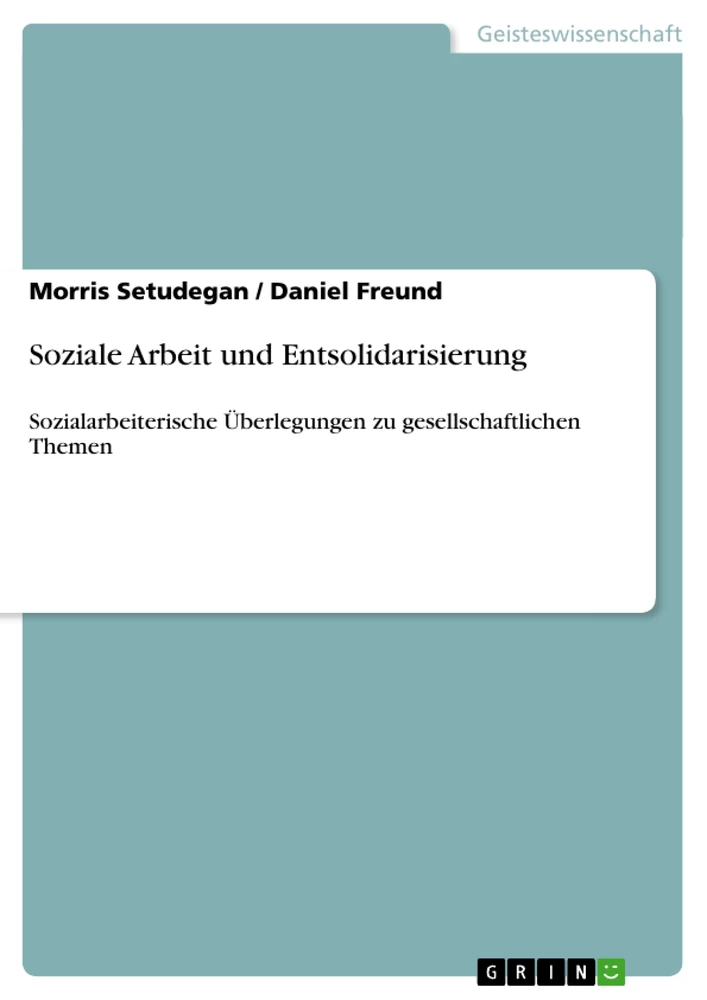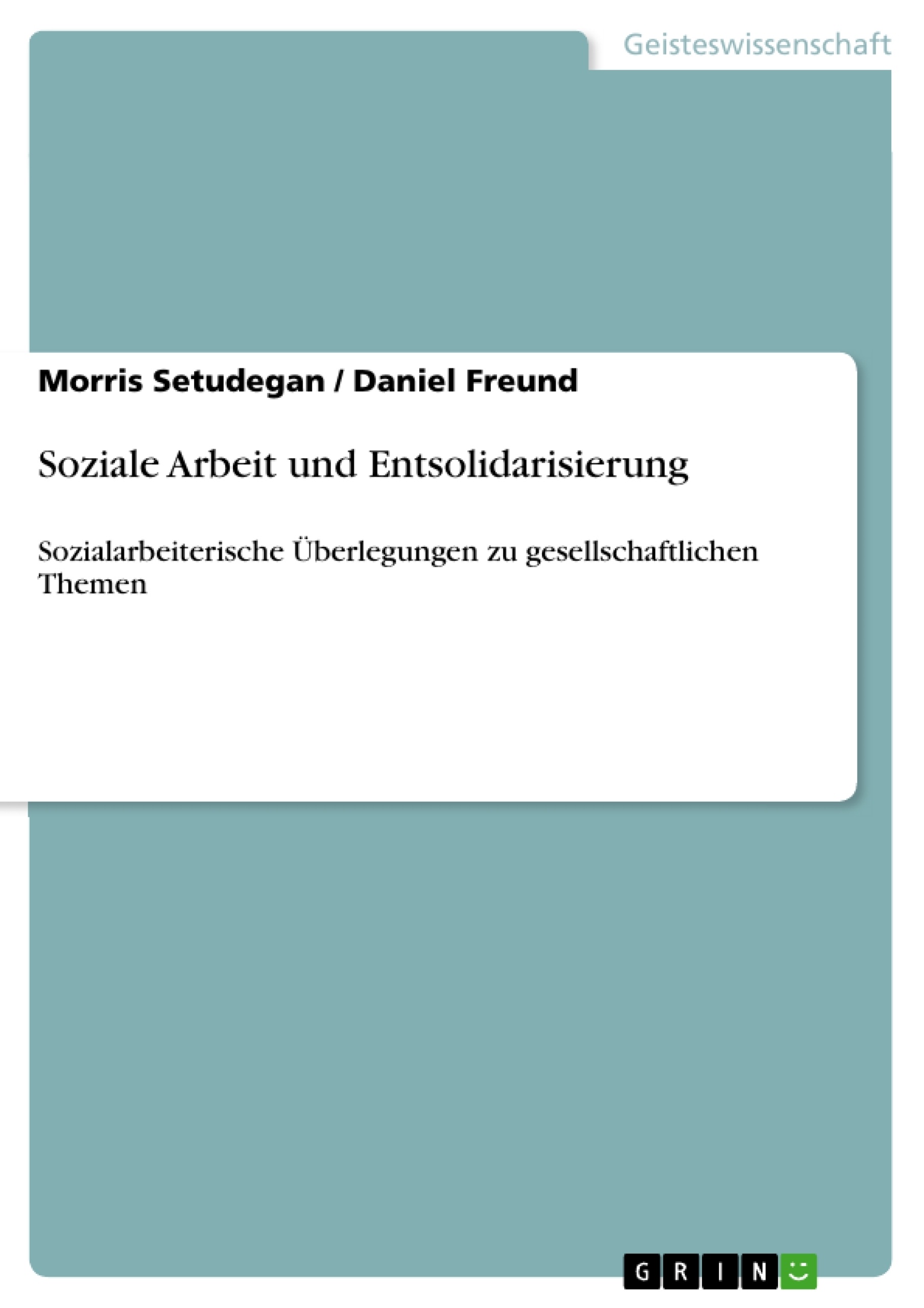Wie kann die Sozialarbeit im Suchtbereich der Entsolidarisierung in der Gesell¬schaft begegnen? - Dies ist die Fragestellung, welche wir durch unsere Recherche beantworten möchten. Die Idee, das Phänomen der Entsolidarisierung als Erklärungsansatz auf die uns seit langem beschäftigende Frage zu wählen, entstand im Laufe der Diskussion zur Themenwahl.
Als Ausgangspunkt unserer Arbeit sehen wir die persönliche Frage, wieweit das Phänomen der Entsolidarisierung in Zusammenhang mit der Suchtmittelabhängigkeit steht und wo, wie oder womit die Soziale Arbeit positive Veränderungen bewirken könnte. Unser persönliches Anliegen ist es auch, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge aufzuzeigen und an deren Wichtigkeit zu erinnern.
Mit unserer Recherchen wollen wir uns dieser Herausforderung annehmen. Wir möchten den Begriff der Solidarität beziehungsweise Entsolidarisierung klären, die verschiedenen Ursachen, heutigen Ausprägungen und möglichen Zukunftsszenarios der Entsolidarisierung erläutern, Überlegungen zu den Auswirkungen des Entsolidarisierungsprozesses auf die Soziale Arbeit anstellen und zu guter letzt Vorschläge ausarbeiten, wie die Soziale Arbeit im Suchtbereich einer immer unsolidarischer werdenden Gesellschaft begegnen soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Die Themenwahl
- 1.2 Unsere Fragestellung und Ziele
- 1.3 Unsere Hypothesenthesen
- 1.4 Eine Definition für die Solidarität
- 1.5 Nun eine Definition für Entsolidarisierung
- 2 Das Phänomen Entsolidarisierung
- 2.1 Ursachen der Entsolidarisierung
- 2.1.1 Leistungsdenken
- 2.1.2 Konsumismus
- 2.1.3 Individualisierung
- 2.1.4 Institutionalisierung
- 2.1.5 Zusammenfassung der Kernaussagen
- 2.2 Wirkungen / Heutige Zeichen der Entsolidarisierung
- 2.2.1 Fehlender Solidaritätsgedanke bei Versicherungen
- 2.2.2 Fehlender Solidaritätsgedanke in Unternehmen / bei Fusionen
- 2.2.3 Fehlender Solidaritätsgedanke gegenüber Randgruppen
- 2.3 Zukunftsszenarios
- 2.3.1 Abbau des Sozialstaates unter Weiterverfolgung der kapitalistischen und individualistischen Ideale
- 2.3.2 Reform des Sozialstaates
- 2.3.3 Wiederentdecken der Verbundenheit
- 2.3.4 Zusammenfassung der Zukunftsszenarios
- 3 Entsolidarisierung und Soziale Arbeit
- 3.1 Einleitende Klärung
- 3.2 Entsolidarisierungshindernde Soziale Arbeit
- 3.2.1 Sprachrohr der Randgruppen
- 3.2.2 Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit
- 3.2.3 Unterstützung des Integrationsprozesses
- 3.2.4 Unterstützung von kleinen Netzen
- 3.3 Entsolidarisierungsfördernde Soziale Arbeit
- 3.3.1 Unterstützung der Werte des Zeitgeistes
- 3.3.2 Übernahme betriebswirtschaftlicher Denkmuster
- 3.3.3 Zunehmende Bürokratisierung und Spezialisierung
- 3.3.4 Entmündigung der Klientel
- 3.4 Auswertung der Arbeitshypothese
- 3.5 Momentaner Standpunkt der Sozialen Arbeit
- 3.5.1 Opportunistische Soziale Arbeit
- 3.5.2 Doppelmandat als Dilemma der Sozialen Arbeit
- 3.6 Mängel der aktuellen Sozialen Arbeit
- 4 Entsolidarisierung und Soziale Arbeit im Suchtbereich
- 4.1 Soziale Arbeit im Suchtbereich heute
- 4.1.1 Vier-Säulen-Politik
- 4.1.2 Statistische Fakten zum Drogenproblem
- 4.1.3 Bestehende Einrichtungen im Suchtbereich
- 4.2 Standpunkt der Sozialen Arbeit im Suchtbereich
- 4.2.1 Abhängigkeit der Sozialen Arbeit im Suchtbereich
- 4.2.2 Erfolge der Sozialen Arbeit im Suchtbereich
- 4.3 Vorschläge zum Umgang mit der Entsolidarisierung
- 4.3.1 Bewusstseinsförderung für gesellschaftliche Zusammenhänge
- 4.3.2 Verbindungsstiftende Projekte
- 4.3.3 Emanzipation der Klientel
- 4.3.4 Veränderung im gesellschaftlichen System
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Entsolidarisierung in der Gesellschaft und deren Auswirkungen auf die Soziale Arbeit. Ziel ist es, die Ursachen der Entsolidarisierung zu analysieren und deren Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche aufzuzeigen. Besonders wird der Fokus auf die Rolle der Sozialen Arbeit gelegt, sowohl in Bezug auf die mögliche Förderung als auch Hemmung von Entsolidarisierungsprozessen.
- Ursachen der Entsolidarisierung (Leistungsdenken, Konsumismus, Individualisierung, Institutionalisierung)
- Auswirkungen der Entsolidarisierung auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche
- Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Bewältigung von Entsolidarisierung
- Zukunftsszenarien im Hinblick auf Solidarität und Entsolidarisierung
- Soziale Arbeit im Suchtbereich als Beispiel für die Herausforderungen der Entsolidarisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Entsolidarisierung und der Rolle der Sozialen Arbeit ein. Es definiert die zentralen Begriffe, formuliert die Forschungsfragen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Autoren legen ihre methodischen und theoretischen Herangehensweisen dar und geben einen Ausblick auf die zu erwartenden Ergebnisse.
2 Das Phänomen Entsolidarisierung: Dieses Kapitel analysiert das Phänomen der Entsolidarisierung umfassend. Es untersucht verschiedene Ursachen wie Leistungsdenken, Konsumismus, Individualisierung und Institutionalisierung und deren Zusammenwirken. Die Kapitel erörtern die Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche und skizzieren mögliche Zukunftsszenarien, die von einem weiteren Abbau des Sozialstaates bis hin zu einem Wiederentdecken von Verbundenheit reichen. Die einzelnen Unterkapitel belegen die These der zunehmenden Entsolidarisierung mit Beispielen aus dem Versicherungssektor, der Wirtschaft und im Umgang mit Randgruppen.
3 Entsolidarisierung und Soziale Arbeit: Der Kern dieses Kapitels liegt in der Auseinandersetzung mit der ambivalenten Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext der Entsolidarisierung. Die Autoren differenzieren zwischen entsolidarisierungshindernden und -fördernden Aspekten sozialarbeiterischen Handelns. Beispiele für hindernde Aspekte sind die Vertretung von Randgruppeninteressen, Öffentlichkeitsarbeit und die Unterstützung von Integrations- und Netzwerkprozessen. Fördernde Aspekte werden in der Übernahme betriebswirtschaftlicher Denkmuster, Zunahme von Bürokratie und Spezialisierung sowie der potenziellen Entmündigung der Klient*innen gesehen. Das Kapitel endet mit einer kritischen Betrachtung des aktuellen Standpunkts Sozialer Arbeit und seiner Defizite im Umgang mit dem Thema Entsolidarisierung.
4 Entsolidarisierung und Soziale Arbeit im Suchtbereich: Dieses Kapitel spezialisiert die allgemeine Betrachtung auf den Suchtbereich. Es beschreibt die aktuelle Situation der Sozialen Arbeit im Suchtbereich, analysiert die Abhängigkeit der Sozialen Arbeit von den bestehenden Strukturen und bewertet die bisherigen Erfolge. Anschließend werden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Entsolidarisierung im Suchtbereich unterbreitet, die von der Bewusstseinsbildung über verbindungsstiftende Projekte bis hin zu systemischen Veränderungen reichen. Der Fokus liegt hier auf der Emanzipation der Klient*innen und der Stärkung von gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Schlüsselwörter
Entsolidarisierung, Solidarität, Soziale Arbeit, Leistungsdenken, Konsumismus, Individualisierung, Institutionalisierung, Randgruppen, Sozialstaat, Sucht, Integration, Emanzipation, gesellschaftliche Zusammenhänge, Zukunftsszenarien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entsolidarisierung und Soziale Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen der Entsolidarisierung in der Gesellschaft und deren Auswirkungen auf die Soziale Arbeit. Sie analysiert die Ursachen der Entsolidarisierung und deren Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Sozialen Arbeit – sowohl in Bezug auf die Förderung als auch die Hemmung von Entsolidarisierungsprozessen.
Welche Ursachen für Entsolidarisierung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Ursachen für Entsolidarisierung, darunter Leistungsdenken, Konsumismus, Individualisierung und Institutionalisierung. Diese Faktoren werden im Detail analysiert und deren Zusammenwirken beleuchtet.
Welche Auswirkungen der Entsolidarisierung werden betrachtet?
Die Auswirkungen der Entsolidarisierung werden auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche betrachtet, beispielsweise im Versicherungssektor, in Unternehmen/Fusionen und im Umgang mit Randgruppen. Konkrete Beispiele illustrieren die These einer zunehmenden Entsolidarisierung.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit im Kontext der Entsolidarisierung?
Die Arbeit untersucht die ambivalente Rolle der Sozialen Arbeit. Sie unterscheidet zwischen entsolidarisierungshindernden (z.B. Vertretung von Randgruppen, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung von Integrationsprozessen) und -fördernden Aspekten (z.B. Übernahme betriebswirtschaftlicher Denkmuster, Bürokratisierung, Entmündigung von Klient*innen). Kritisch wird der aktuelle Standpunkt und Defizite der Sozialen Arbeit beleuchtet.
Welche Zukunftsszenarien werden im Hinblick auf Solidarität und Entsolidarisierung skizziert?
Die Arbeit skizziert verschiedene Zukunftsszenarien, die von einem weiteren Abbau des Sozialstaates bis hin zu einem Wiederentdecken von Verbundenheit reichen. Diese Szenarien werden diskutiert und ihre Wahrscheinlichkeit abgeschätzt.
Wie wird der Suchtbereich in die Analyse einbezogen?
Der Suchtbereich dient als Fallbeispiel, um die Herausforderungen der Entsolidarisierung zu verdeutlichen. Die Arbeit analysiert die aktuelle Situation der Sozialen Arbeit im Suchtbereich, die Abhängigkeit von bestehenden Strukturen und die bisherigen Erfolge. Konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Entsolidarisierung im Suchtbereich werden unterbreitet (Bewusstseinsbildung, verbindungsstiftende Projekte, systemische Veränderungen).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Entsolidarisierung, Solidarität, Soziale Arbeit, Leistungsdenken, Konsumismus, Individualisierung, Institutionalisierung, Randgruppen, Sozialstaat, Sucht, Integration, Emanzipation, gesellschaftliche Zusammenhänge, Zukunftsszenarien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Das Phänomen Entsolidarisierung, Entsolidarisierung und Soziale Arbeit, und Entsolidarisierung und Soziale Arbeit im Suchtbereich. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik und baut aufeinander auf.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit legt ihre methodischen und theoretischen Herangehensweisen in der Einleitung dar. Die genauen Methoden werden nicht im FAQ detailliert beschrieben, sind aber innerhalb des Haupttextes ersichtlich.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Text der Arbeit (Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen etc.)
- Quote paper
- Prof. Social Manager M.A. Morris Setudegan (Author), Daniel Freund (Author), 2005, Soziale Arbeit und Entsolidarisierung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83575