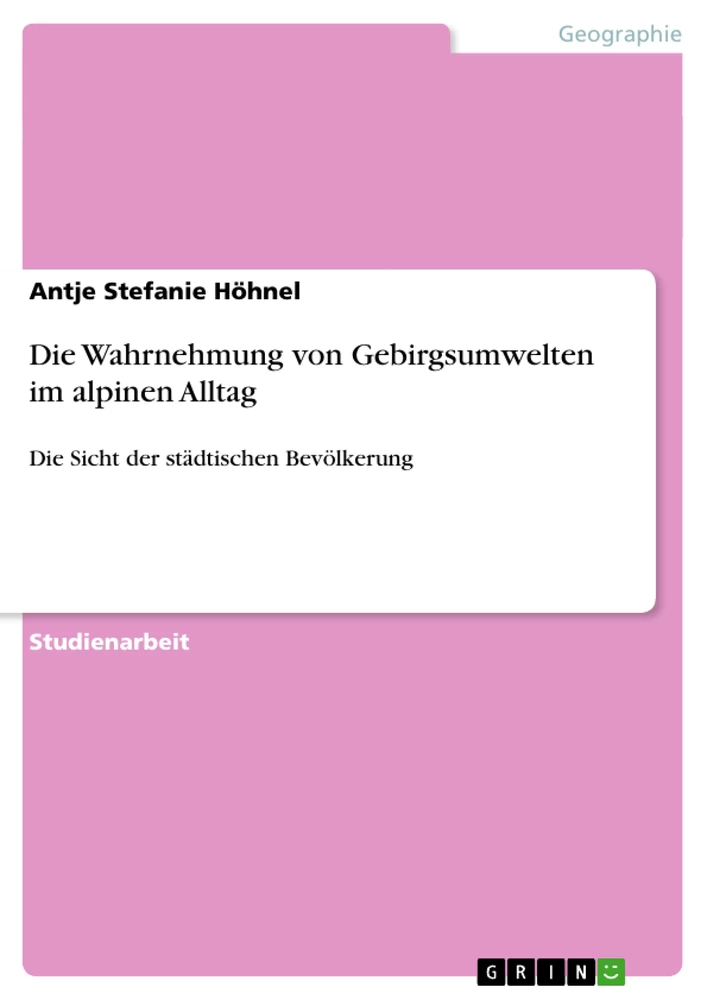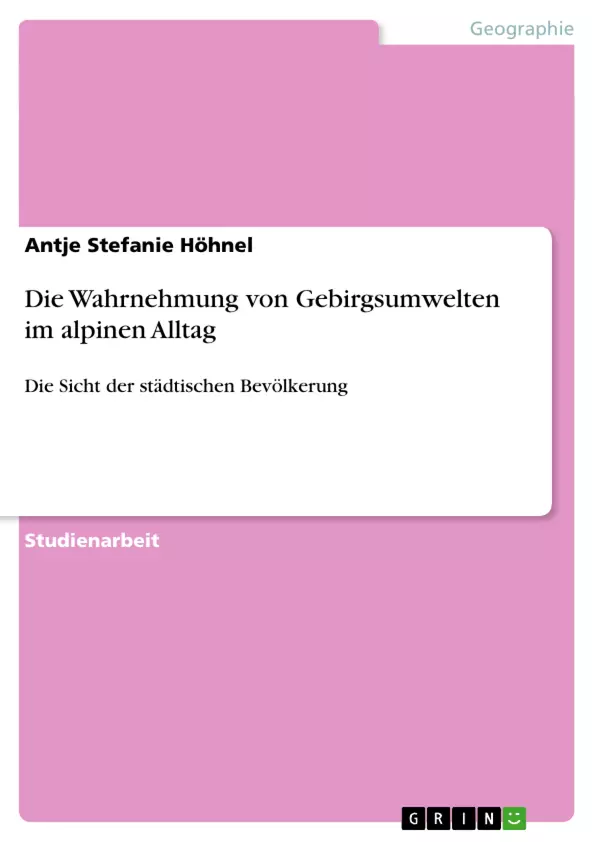«Jedes Jahrhundert hat nicht nur seine Weltanschauung,
sondern seine eigene Landschaftsanschauung.»
Dieses Zitat von W. H. Riehl aus dem Jahre 1859 weist bereits auf einen Aspekt bei der Analyse von Wahrnehmungsunterschieden hin, denn man kann nicht von der Landschaftsanschauung oder der Landschaftswahrnehmung sprechen, sondern muss differenzieren.
Zum einen gilt es zu unterscheiden zwischen der Wahrnehmung in unterschiedlichen
Jahrhunderten. Die Wahrnehmung verändert sich abhängig von politischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Faktoren. Damit verbunden ist auch die Entwicklung der Landschaftsanschauung.
Ein weiteres Kriterium der Unterscheidung ist die kulturelle Zugehörigkeit, denn
unterschiedliche Kulturen und Völker haben verschiedenartige Bezüge zu Landschaften, in diesem Fall zu den Bergen. So hat die Bevölkerung in Asien und Lateinamerika, die am Fuße der großen Gebirge lebt und den Naturgewalten ausgesetzt ist, eine ganz andere Beziehung zu einem Berg oder zu der Landschaft an seinem Fuß als z.B. ein Bergsteiger, der seine Grenzen sucht oder ein Bergwanderer, für den der Anblick der Gebirgsumwelten Balsam für die gestresste Seele ist. Für indigene Völker jedoch sind Berge in erster Linie Symbole spiritueller Kraft, Wohnstätten der Götter und wichtige Wallfahrtsziele. Soll es der Menschheit gut gehen, müssen die Gottheiten bei Laune gehalten werden. Die Entweihung oder Verschmutzung der Berge macht sie unglücklich oder gar ärgerlich. Außerdem muss unterschieden werden zwischen Menschen, die in und mit oder von den Gebirgen leben und zwischen denjenigen, die z.B. fernab vom Gebirge und dazu noch in Städten leben. Letztere haben eine andere Beziehung zu Bergen, die aus den abweichenden Lebensformen und –stilen resultiert.
Der Focus in dieser Arbeit liegt in der Suche nach Schlüsselindikatoren, die die
Wahrnehmung von Gebirgsumwelten im alpinen städtischen Alltag bestimmen. Zunächst werden jedoch die Begriffe Alpenstadt, Alltag und alpiner Alltag, Gebirgsumwelt und Wahrnehmung geklärt.
Die Begriffe Alpen, Berge und Gebirge werden, wenn nicht in explizit anderem Kontext,
als Synonyme verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wahrnehmung von Gebirgsumwelten im alpinen Alltag
- Zur Klärung einiger Begriffe
- Alpenstadt
- Alltag, städtischer Alltag und alpiner Alltag
- Was sind Gebirgsumwelten?
- (Landschafts-) Wahrnehmung
- „Die Alpen im Kopf“
- Von den schrecklichen zu den schrecklich schönen Alpen
- Wahrnehmung von Gebirgsumwelten im alpinen Alltag aus der Sicht der städtischen Bevölkerung
- Alpenwahrnehmung heute – vielfach bloßes Klischeedenken
- Sympathiewerbung Alpen
- Die Alpen in der Produktwerbung
- Von StädterInnen die z'Alp gehen
- Alpbilder vor dem Alpsommer
- Wahrnehmung von Gebirgsumwelten während des Alpsommers
- Wahrnehmung von Gebirgsumwelten nach dem Alpsommer
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Wahrnehmung von Gebirgsumwelten im alpinen Alltag aus der Sicht der städtischen Bevölkerung. Dabei werden die Unterschiede zwischen städtischem und alpinem Alltag beleuchtet und die Entwicklung der Landschaftsanschauung im Laufe der Zeit diskutiert.
- Die Definition und Abgrenzung der Begriffe „Alpenstadt“, „Alltag“, „alpiner Alltag“ und „Gebirgsumwelt“
- Die Entwicklung der Wahrnehmung von Gebirgsumwelten im alpinen Raum
- Der Einfluss von Klischees und Produktwerbung auf die Wahrnehmung der Alpen
- Die Beziehung von StädterInnen zu den Alpen, insbesondere während des Alpsommers
- Die Herausforderungen und Chancen einer nachhaltigen Entwicklung im Alpenraum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Wahrnehmung von Gebirgsumwelten im alpinen Alltag heraus und definiert die zentralen Begriffe der Arbeit. Im zweiten Kapitel wird die Definition der Alpenstadt anhand von verschiedenen Kriterien beleuchtet, darunter die Bevölkerungszahl, die Wirtschaftsstruktur und die soziale und kulturelle Bedeutung. Außerdem werden die Begriffe „Alltag“, „städtischer Alltag“ und „alpiner Alltag“ differenziert und im Kontext der Landschaftswahrnehmung analysiert. Im dritten Kapitel werden die historischen Entwicklungen der Wahrnehmung von Gebirgsumwelten beleuchtet und verschiedene Perspektiven und Deutungen der Alpenlandschaft dargestellt. Der vierte Abschnitt widmet sich der aktuellen Wahrnehmung von Gebirgsumwelten im alpinen Alltag aus der Sicht der städtischen Bevölkerung. Dabei werden die Auswirkungen von Sympathiewerbung, Produktwerbung und Klischees auf die Landschaftswahrnehmung untersucht.
Schlüsselwörter
Alpenstadt, Alltag, alpiner Alltag, Gebirgsumwelt, Wahrnehmung, Landschaftsanschauung, Klischeedenken, Produktwerbung, Alpsommer, StädterInnen, nachhaltige Entwicklung.
- Citation du texte
- Antje Stefanie Höhnel (Auteur), 2006, Die Wahrnehmung von Gebirgsumwelten im alpinen Alltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83580