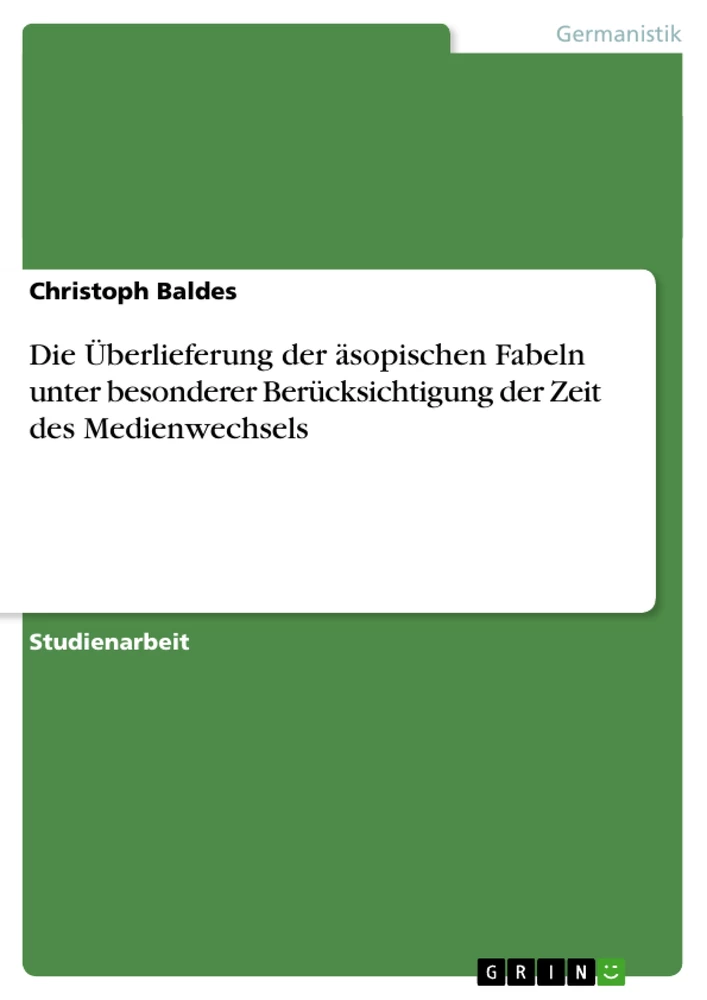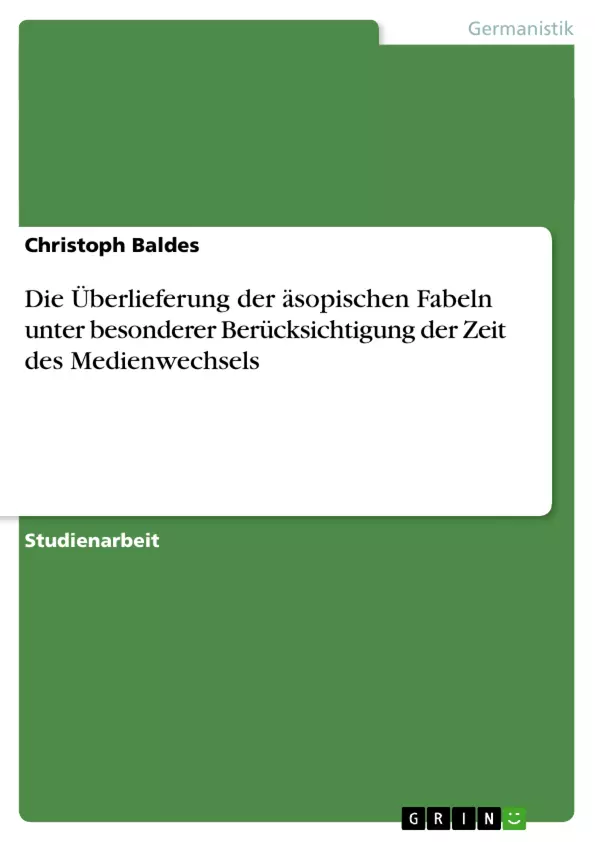Der Begriff „äsopische Fabeln“ lässt zunächst eine Sammlung von Fabeln vermuten, die von einem Autor namens Äsop verfasst wurde. Tatsächlich wird man in der Literatur fündig, geht man von dieser Überlegung aus. Die Schaffenszeit Äsops wird auf das 6. Jahrhundert vor Christus datiert; obwohl über zweieinhalbtausend Jahre vergangen sind, sind noch heute fast alle seine Fabeln bekannt. Dabei stellen sie kein Nischenwissen dar, sondern sind äußerst populär. Deshalb wird in der Arbeit ein Blick auf die lange Überlieferungsgeschichte der äsopischen Fabeln geworfen werden. Dabei steht die Frage im Vordergrund, inwieweit die Überlieferung kontinuierlich verläuft oder ob und wann es Brüche gibt. Eine besondere Rolle spielt dabei das Zeitalter des sog. „Medienwechsels“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Was sind „äsopische Fabeln“?
- 1.2 Hinführung zum Thema
- 1.3 Vorgehensweise
- 2. Die Überlieferung der äsopischen Fabeln
- 2.1 Handschriftliche Überlieferungen
- 2.1.1 Die Fabel in der Antike: Babrios und Phaedrus
- 2.1.2 Überlieferung in der Spätantike: Avian und Romulus
- 2.1.3 Äsopische Fabeln im frühen Mittelalter: Herger, Stricker, Trimberg
- 2.1.4 Deutsche Äsopübertragungen im 13./14. Jahrhundert: von Minden, Boner
- 2.2 Druck-Überlieferungen
- 2.2.1 Der Äsop in seinen ersten Druckausgaben: Boner, Steinhöwel, Brant
- 2.2.2 Fabelsammlungen zur Zeit der Reformation: Luther, Alberus, Waldis
- 2.2.3 Die zweite Blütezeit im 18. Jahrhundert: Breitinger, Lessing, Fischer
- 2.3 Gründe für den Erfolg der Fabel
- 2.3.1 Der inhaltliche Erfolg
- 2.3.2 Der buchhändlerische Erfolg
- 3. Schlussbetrachtung
- 3.1 Die Überlieferung der Fabel
- 3.2 Die Bedeutung der Fabel im Medienwechsel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Überlieferungsgeschichte der äsopischen Fabeln, insbesondere im Kontext des Medienwechsels vom Handschriftenwesen zum Buchdruck. Ziel ist es, die Kontinuität und Brüche in der Überlieferung aufzuzeigen und die Bedeutung der Fabel im Wandel der Medien zu beleuchten.
- Die Entwicklung der äsopischen Fabeln von ihren Ursprüngen bis ins 18. Jahrhundert.
- Der Einfluss des Medienwechsels auf die Verbreitung und Rezeption der Fabeln.
- Die verschiedenen Formen der Überlieferung (Handschrift, Druck).
- Die Rolle der jeweiligen Autoren und ihrer Intentionen bei der Gestaltung der Fabeln.
- Der Erfolg der Fabel als literarische Gattung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beginnt mit der Klärung des Begriffs „äsopische Fabeln“, wobei die Frage nach der tatsächlichen Existenz des Äsop thematisiert wird. Es wird die Hypothese diskutiert, dass Äsop eine fiktive Figur ist, die als Sammelbecken für griechische Fabeln dient. Anschließend wird die Zielsetzung der Arbeit erläutert: die Untersuchung der langen Überlieferungsgeschichte der Fabeln, insbesondere im Kontext des Medienwechsels (Übergang von Handschrift zum Buchdruck). Die Arbeit konzentriert sich auf deutschsprachige Sammlungen.
2. Die Überlieferung der äsopischen Fabeln: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die handschriftliche und gedruckte Überlieferung der äsopischen Fabeln. Es werden verschiedene Autoren und Sammlungen aus der Antike, dem Mittelalter und der frühen Neuzeit vorgestellt, ihre Bedeutung für die Weitergabe der Fabeltradition wird untersucht. Die Analyse umfasst Aspekte wie die sprachliche Gestaltung (Prosa, Vers, Volkssprache), die Zielgruppe der Sammlungen und die Intentionen der jeweiligen Autoren. Es wird ein Bogen von den frühen griechischen Fabeln bis zu den Sammlungen der Reformationszeit geschlagen. Die Untersuchung umfasst dabei die verschiedenen Formen der Präsentation, die jeweilige Zielgruppe und die Intentionen der Autoren.
Schlüsselwörter
Äsopische Fabeln, Überlieferungsgeschichte, Medienwechsel, Handschrift, Buchdruck, deutsche Literatur, Fabelsammlungen, Antike, Mittelalter, Reformation, volkstümliche Literatur, literarische Gattung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Überlieferungsgeschichte der Äsopischen Fabeln
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Überlieferungsgeschichte der äsopischen Fabeln, insbesondere den Übergang vom Handschriftenwesen zum Buchdruck. Sie beleuchtet Kontinuitäten und Brüche in der Überlieferung und die Bedeutung der Fabel im Wandel der Medien. Der Fokus liegt auf deutschsprachigen Sammlungen.
Welche Aspekte der Überlieferungsgeschichte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der äsopischen Fabeln von ihren Ursprüngen bis ins 18. Jahrhundert, den Einfluss des Medienwechsels auf Verbreitung und Rezeption, verschiedene Überlieferungsformen (Handschrift, Druck), die Rolle der Autoren und ihrer Intentionen, sowie den Erfolg der Fabel als literarische Gattung.
Welche Zeiträume und Autoren werden betrachtet?
Die Hausarbeit umfasst die Überlieferung der äsopischen Fabeln von der Antike (Babrios, Phaedrus) über die Spätantike (Avian, Romulus) und das Mittelalter (Herger, Stricker, Trimberg, von Minden, Boner) bis zur frühen Neuzeit (Boner, Steinhöwel, Brant, Luther, Alberus, Waldis) und dem 18. Jahrhundert (Breitinger, Lessing, Fischer).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur Überlieferung der äsopischen Fabeln (unterteilt in handschriftliche und Druck-Überlieferungen), und eine Schlussbetrachtung. Die Einführung klärt den Begriff "äsopische Fabeln" und die Zielsetzung der Arbeit. Das Hauptkapitel analysiert verschiedene Autoren und Sammlungen, ihre sprachliche Gestaltung, Zielgruppen und Intentionen. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen und beleuchtet die Bedeutung der Fabel im Medienwechsel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Äsopische Fabeln, Überlieferungsgeschichte, Medienwechsel, Handschrift, Buchdruck, deutsche Literatur, Fabelsammlungen, Antike, Mittelalter, Reformation, volkstümliche Literatur, literarische Gattung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie sich die äsopischen Fabeln im Laufe der Geschichte und durch den Medienwechsel vom Handschriftenwesen zum Buchdruck verändert und weiterentwickelt haben, und welche Bedeutung die Fabel in diesem Wandel erlangt hat.
Welche Hypothese wird in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Hypothese, dass Äsop möglicherweise eine fiktive Figur ist, die als Sammelbecken für griechische Fabeln dient.
- Citar trabajo
- Christoph Baldes (Autor), 2003, Die Überlieferung der äsopischen Fabeln unter besonderer Berücksichtigung der Zeit des Medienwechsels, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83622