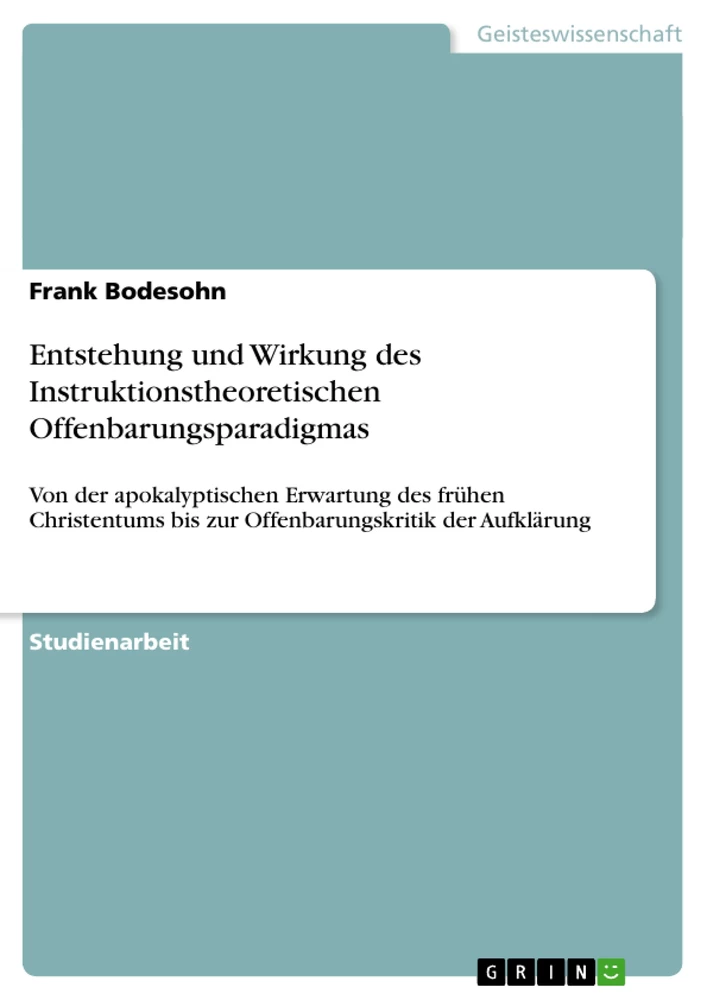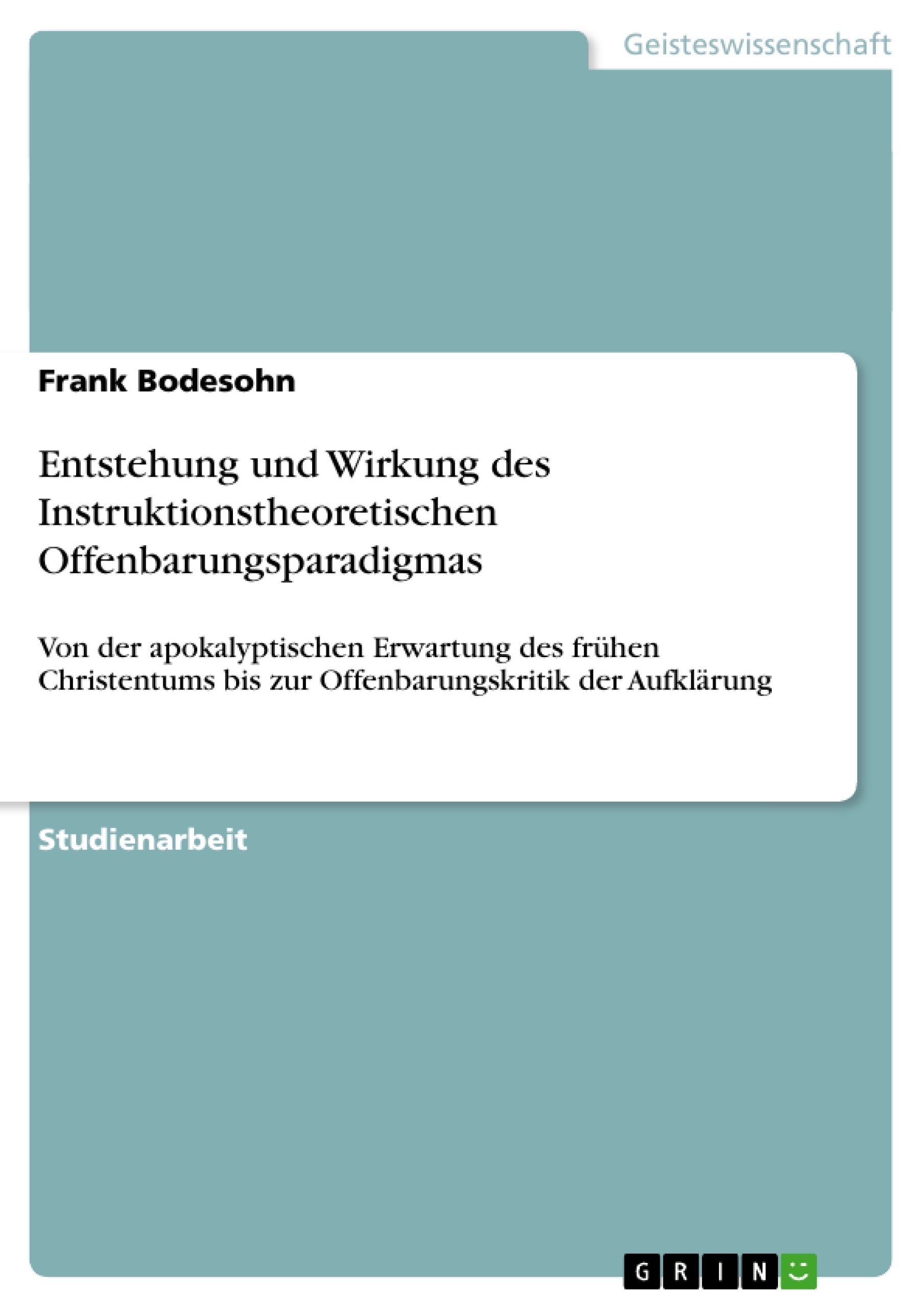Das Christentum war in seiner Geschichte und der seiner Glaubensdogmen einschneidenden Veränderungen unterworfen. Die Gründe dafür waren unterschiedlicher Art.
Die jeweilige Glaubensmeinung der christlichen Theologie ist stark verknüpft mit dem Offenbarungsbegriff, der zur gleichen Zeit vorherrschend war. Ebenso war das Verständnis von Offenbarung bestimmend für die Sichtweise, in welchem Verhältnis der Mensch zu Gott steht. Gegen die jeweilige theologische Definition von Offenbarung wurden mehrmals in der Geschichte des Christentums innerhalb und außerhalb der Kirche Zweifel laut und ergänzende und entgegengesetzte Meinungen konstruiert. Die gravierendsten Änderungen erlebte der Offenbarungsbegriff um das 17. Jahrhundert, als sich viele Theologen und Philosophen mit dem Selbstverständnis des Christentums und seiner Legitimation beschäftigten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Offenbarung?
- Offenbarungsvorstellungen von Jesus bis zur Aufklärung
- Das epiphanische Paradigma
- Die Offenbarung im Neuen Testament
- Das Offenbarungsverständnis der Alten Kirche
- Die Parusieverzögerung und ihre Folgen
- Das instruktionstheoretische Paradigma
- Das epiphanische Paradigma
- Die Offenbarungskritik der Aufklärung
- Kritik an der übernatürlichen Erkenntnis
- Kritik am Inhalt der geoffenbarten Erkenntnis
- Kritik an der Heilsnotwendigkeit der Offenbarung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entstehung und Wirkung des instruktionstheoretischen Offenbarungsparadigmas im Christentum zu untersuchen. Sie analysiert die Entwicklung des Offenbarungsbegriffs von der apokalyptischen Erwartung des frühen Christentums bis zur Offenbarungskritik der Aufklärung.
- Die Bedeutung des Offenbarungsbegriffs im Kontext der christlichen Theologie und Glaubensdogmen
- Die Entwicklung des Offenbarungsverständnisses von der Zeit Jesu bis zum Mittelalter
- Die Rolle des instruktionstheoretischen Paradigmas im christlichen Offenbarungsdenken
- Die Kritik an der Offenbarung im 17. Jahrhundert und ihre Auswirkungen auf das Selbstverständnis des Christentums
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf Offenbarung in Religionsphilosophie und Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und zeigt die Bedeutung des Offenbarungsbegriffs für die Entwicklung des Christentums. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff „Offenbarung“ in verschiedenen Perspektiven – religionsgeschichtlich, religionsphilosophisch und historisch-theologisch. Kapitel 3 widmet sich dem epiphanischen Paradigma, das die Offenbarungvorstellungen der ersten Jahrhunderte des Christentums prägte. Es werden die Offenbarungsvorstellungen des Neuen Testaments und der Alten Kirche analysiert. Kapitel 4 behandelt die Offenbarungskritik der Aufklärung und beleuchtet die Kritik an der übernatürlichen Erkenntnis, am Inhalt der geoffenbarten Erkenntnis und an der Heilsnotwendigkeit der Offenbarung. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Offenbarungsbegriff im Christentum, insbesondere mit der Entwicklung des instruktionstheoretischen Paradigmas. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Offenbarung, Epiphanie, Apokalyptik, Parusieverzögerung, Instruktionstheorie, Aufklärungskritik, Gottesrede, Heilsgeschichte, Theologie, Religionsphilosophie, transzendente Erfahrung, Selbstoffenbarung Gottes.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das instruktionstheoretische Offenbarungsparadigma?
Ein Verständnis von Offenbarung als Vermittlung von übernatürlichem Wissen oder Lehrsätzen durch Gott an den Menschen.
Wie unterschied sich die Sicht der Aufklärung auf die Offenbarung?
Die Aufklärung kritisierte die Vorstellung übernatürlicher Erkenntnis und forderte, dass religiöse Inhalte vor der Vernunft bestehen müssen.
Was bedeutet "Parusieverzögerung"?
Das Ausbleiben der erwarteten baldigen Wiederkunft Christi, was im frühen Christentum zu einer Neuausrichtung der Theologie und des Offenbarungsverständnisses führte.
Was ist das epiphanische Paradigma?
Ein älteres Verständnis, bei dem Offenbarung als direktes Erscheinen oder machtvolles Handeln Gottes in der Geschichte verstanden wird.
Warum ist der Offenbarungsbegriff für die Theologie zentral?
Er definiert die Grundlage des christlichen Glaubens und das Verhältnis zwischen göttlicher Autorität und menschlicher Erkenntnis.
- Citation du texte
- Frank Bodesohn (Auteur), 2006, Entstehung und Wirkung des Instruktionstheoretischen Offenbarungsparadigmas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83639