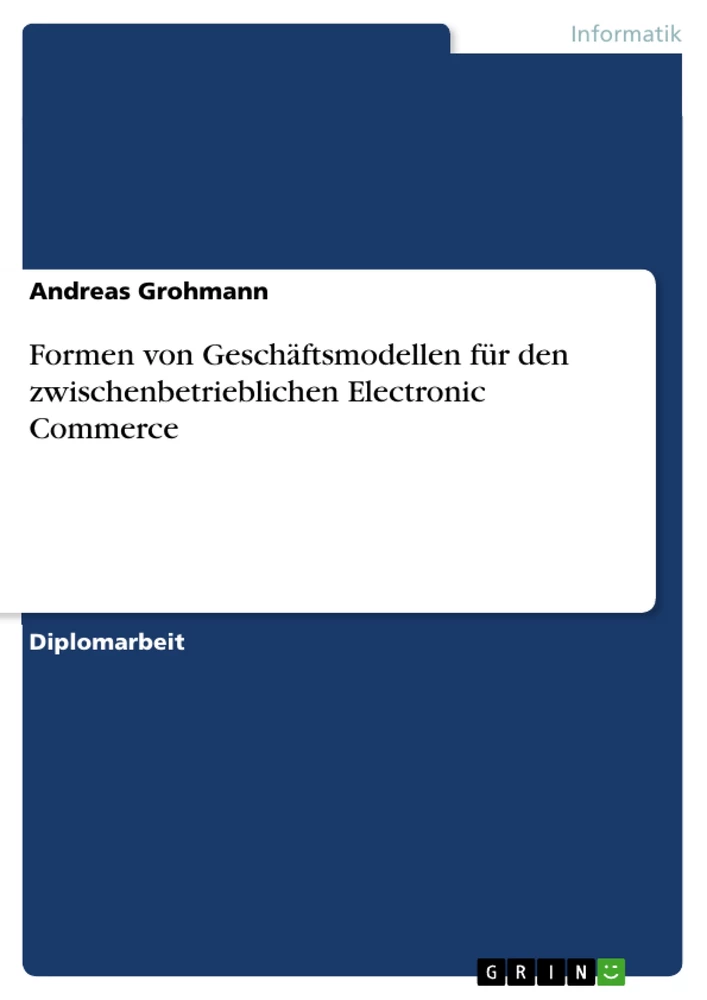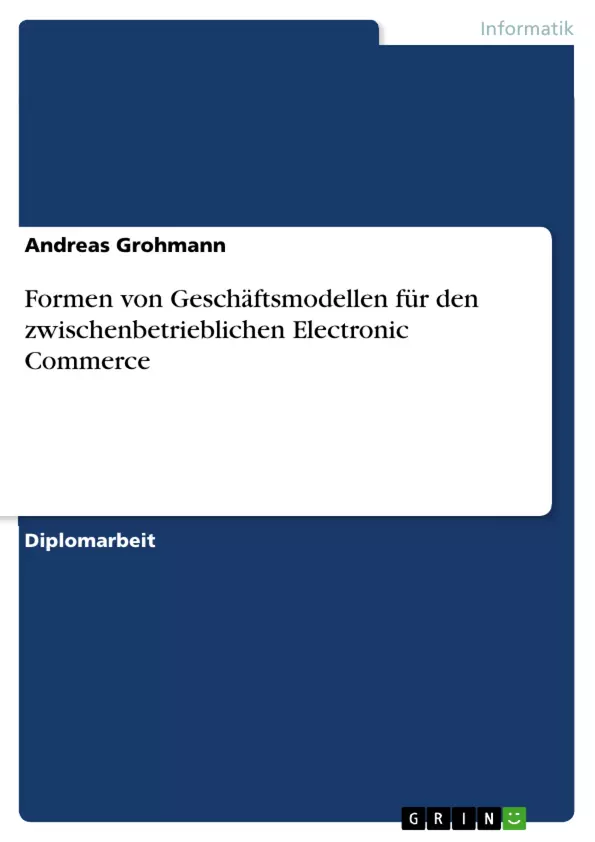Einleitung
„ As the century closed, the world became smaller. The public rapidly gained access to new and dramatically faster communication technologies. […] Every brought forth new technological advances to which old business models seemed no longer to apply.”(1)
1.1. Problemstellung
Der Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft verändert
zunehmend das wirtschaftliche Umfeld, in dem Unternehmen agieren.
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien erlangen immer
größere Relevanz im wirtschaftlichen Umfeld. Die wachsende Bedeutung der kommerziellen Nutzung des Internets ist Ausdruck dieser Entwicklung. Häufig werden die Aufhebung räumlicher und zeitlicher Einschränkungen,(2) sowie die Annäherung an das Ideal des vollkommenen Marktes(3) als markanteste Veränderungen im Zuge der Einführung des Electronic Commerce genannt. Im zwischenbetrieblichen Sektor wird die Erleichterung der unternehmensübergreifenden Prozessunterstützung als ein ergänzender Vorteil des Electronic Commerce angesehen.(4) Die angeführten Veränderungen haben in erster Linie Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation. Es kommt zu einem Wandel der Marktstrukturen und -größe.(5) Neben dem verstärkten Wettbewerb erlangt aber auch die Kollaboration zwischen Geschäftspartnern zunehmend an Bedeutung, da die Konzentration auf die Kernkompetenzen erleichtert wird.(6)
[...]
______
1 Vgl. SHAPIRO C.,VARIAN H. R. (1999), Information Rules, S. 1.
2 Vgl. TIMMERS, P., Electronic Commerce (1998), S. 11 – 13.
3 Malone und Yates führen in ihrem Beitrag aus, in welcher Form die elektronische Vernetzung die Transaktionskosten senkt. Die Absenkung der Transaktionskosten ist wiederum zurückzuführen auf eine Annäherung an das Ideal des vollkommenen Marktes.
Vgl. MALONE, T. W. et al., Electronic Markets (1987), S. 489.
4 Vgl. SAUTER, M., Strategische Herausforderungen (1999), S. 109.
5 Vgl. OECD, The Impact of Electronic Commerce (1999), S. 86.
6 Vgl. PHILLIPS, C., MEEKER, M., B2B Internet Report (2000), S. 13.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Vorgehensweise
- 2. GRUNDLAGEN DER INTERNET ÖKONOMIE
- 2.1. Definitionen
- 2.1.1. Definition Electronic Commerce
- 2.1.2. Definition elektronischer Markt
- 2.2. Ausprägungen des Electronic Commerce
- 2.3. Merkmale der Internet Ökonomie
- 2.3.1. Erhöhte Verfügbarkeit
- 2.3.2. Digitalisierung
- 2.3.3. Kostenpotentiale
- 2.3.4. Netzwerkexternalitäten und positives Feedback
- 2.4. Strategische Herausforderungen durch Electronic Commerce
- 2.4.1. Veränderung des Wettbewerbs
- 2.4.2. Transformation der Wertschöpfungsketten
- 2.4.3. Individualisierung des Angebots
- 2.5. Zusammenfassung
- 3. GRUNDLAGEN DER INTERNET GESCHÄFTSMODELLE
- 3.1. Definition von Geschäftsmodellen
- 3.2. Klassifizierung von B2B Internet Geschäftsmodellen
- 3.2.1. Stellung in der Wertkette
- 3.2.2. Interaktionsmuster
- 3.3. Merkmale von Internet Geschäftsmodellen
- 3.3.1. Gemeinsame Merkmale
- 3.3.2. Modellspezifische Merkmale
- 4. GESCHÄFTSMODELLFORMEN
- 4.1. Ausprägungen von Internet Geschäftsmodellen
- 4.1.1. Direkte Vertriebsformen
- 4.1.2. Elektronische Marktplätze
- 4.1.3. Dienstleistungsmodelle
- 4.1.4. Kommunikationsmodelle
- 4.1.5. Entwicklungsperspektiven der Grundformen
- 4.2. Hybride Geschäftsmodelle
- 4.2.1. Bedeutung von Mischformen
- 4.2.2. Portale
- 4.2.3. Fallbeispiele
- 4.2.4. Marktentwicklung im B2B Commerce
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Analyse von Geschäftsmodellen für den zwischenbetrieblichen Electronic Commerce. Das Hauptziel ist es, verschiedene Geschäftsmodellformen zu identifizieren, zu kategorisieren und in ihrer Bedeutung für die Gestaltung von Online-Geschäften zu bewerten. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Entwicklung von hybriden Geschäftsmodellen gelegt, die sich aus der Integration verschiedener Grundformen zusammensetzen.
- Definition und Ausprägung von Electronic Commerce
- Merkmale der Internet Ökonomie und ihre Auswirkungen auf Geschäftsmodelle
- Klassifizierung und Analyse von B2B Internet Geschäftsmodellen
- Entwicklung und Bedeutung hybrider Geschäftsmodellformen
- Strategische Herausforderungen und Chancen für Unternehmen im B2B Electronic Commerce
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Diplomarbeit ein, definiert die Problemstellung und formuliert die Zielsetzung. In Kapitel 2 werden die Grundlagen der Internet Ökonomie beleuchtet, wobei insbesondere die Definitionen von Electronic Commerce und elektronischen Märkten sowie die Merkmale der Internet Ökonomie im Vordergrund stehen. Zudem werden die strategischen Herausforderungen durch Electronic Commerce analysiert, die Unternehmen im Wettbewerbsumfeld bewältigen müssen.
Kapitel 3 befasst sich mit den Grundlagen von Internet Geschäftsmodellen. Hier werden die Definition von Geschäftsmodellen erläutert, sowie die Klassifizierung von B2B Internet Geschäftsmodellen anhand der Stellung in der Wertkette und der Interaktionsmuster. Die Merkmale von Internet Geschäftsmodellen, sowohl die gemeinsamen als auch die modellspezifischen, werden ebenfalls detailliert betrachtet.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit verschiedenen Formen von Internet Geschäftsmodellen. Hier werden die Ausprägungen von Geschäftsmodellen, wie direkte Vertriebsformen, elektronische Marktplätze, Dienstleistungsmodelle und Kommunikationsmodelle, sowie die Entwicklungsperspektiven der Grundformen untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf hybriden Geschäftsmodellen und deren Bedeutung im B2B Commerce. Schließlich wird die Marktentwicklung im B2B Commerce betrachtet.
Schlüsselwörter
Electronic Commerce, Internet Ökonomie, Geschäftsmodelle, B2B, Wertkette, Interaktionsmuster, hybride Geschäftsmodelle, Marktplätze, Portale, strategische Herausforderungen, Digitalisierung, Netzwerkexternalitäten, positives Feedback.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Diplomarbeit zum Electronic Commerce?
Ziel ist es, Geschäftsmodellformen für den zwischenbetrieblichen (B2B) E-Commerce zu identifizieren, zu kategorisieren und deren Bedeutung zu bewerten.
Welche Merkmale kennzeichnen die Internet-Ökonomie?
Zu den Merkmalen gehören erhöhte Verfügbarkeit, Digitalisierung, Kostenpotentiale sowie Netzwerkexternalitäten und positives Feedback.
Welche Grundformen von Internet-Geschäftsmodellen werden unterschieden?
Unterschieden werden direkte Vertriebsformen, elektronische Marktplätze, Dienstleistungsmodelle und Kommunikationsmodelle.
Was sind hybride Geschäftsmodelle im B2B-Bereich?
Hybride Modelle sind Mischformen, die verschiedene Grundformen integrieren, wie beispielsweise Portale, die Information und Handel kombinieren.
Wie beeinflusst E-Commerce die Wertschöpfungsketten?
E-Commerce führt zu einer Transformation der Wertschöpfungsketten, ermöglicht die Individualisierung von Angeboten und fördert die elektronische Vernetzung.
- Quote paper
- Andreas Grohmann (Author), 2000, Formen von Geschäftsmodellen für den zwischenbetrieblichen Electronic Commerce, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/837